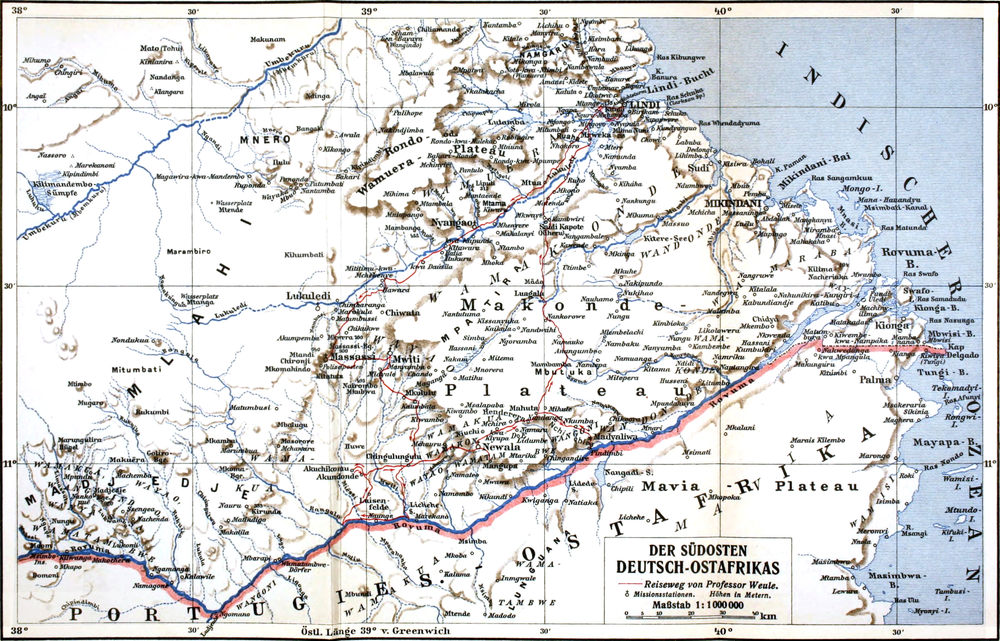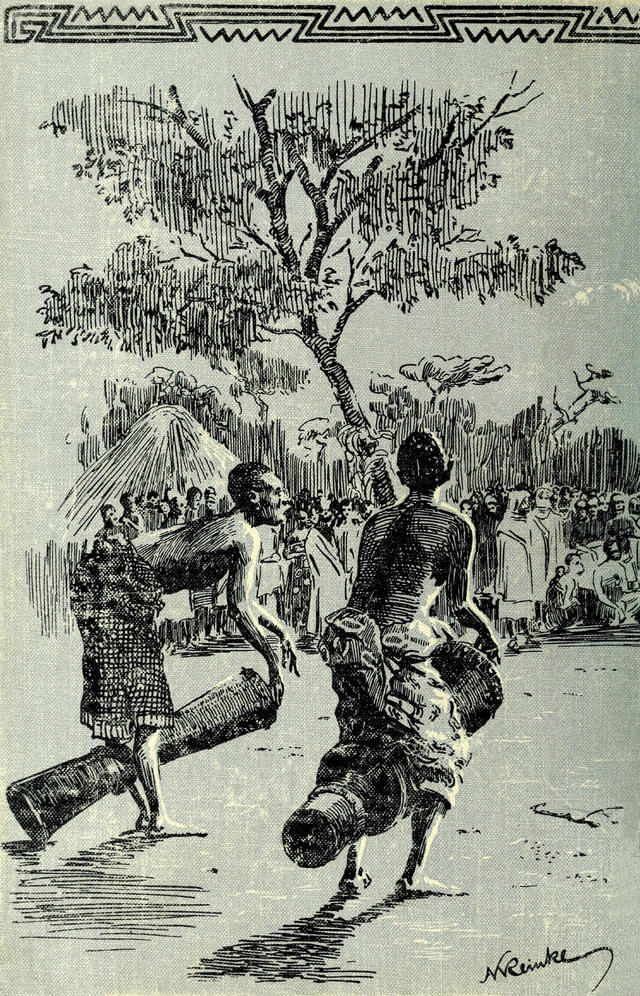Title: Negerleben in Ostafrika
Ergebnisse einer Ethnologischen Forschungsreise
Author: Karl Weule
Release date: November 14, 2023 [eBook #72124]
Language: German
Original publication: Leipzig: F. A. Brockhaus
Credits: Peter Becker, Jude Eylander, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1909 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
In der im Original gewählten Frakturschrift wird nicht zwischen den Großbuchstaben ‚I‘ und ‚J‘ unterschieden. Zur Übertragung in die heute üblichen Antiquaschriftarten wurden aber im Register die Einträge getrennt nach den beiden Anfangsbuchstaben aufgeführt.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv wiedergegeben. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Negerleben in Ostafrika.

Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise.
Von
Dr. Karl Weule
Professor an der Universität und Direktor des Museums für Völkerkunde in Leipzig.
Mit 196 Abbildungen, darunter 4 bunte Vollbilder, und einer Karte.
Zweite Auflage.

Leipzig:
F. A. Brockhaus.
1909.
[S. v]
„Ort, Datum, Adresse, kurz, ein Briefkopf — also die üblichen Reisebriefe!“ Gemach, mein Herr oder meine Gnädigste! Schon zwischen Brief und Brief besteht, trotzdem er heute den Charakter des Kunstwerks längst verloren hat, ein Unterschied; um wieviel mehr beim Reisebrief, dessen Form und Inhalt in ungleich höherem Grade durch die Umstände, aus denen heraus er entsteht, bedingt werden. Ehrlich will ich zudem — falls die Briefform nun einmal ein Verbrechen ist — gestehen, daß die Kapitel dieses Buches ihre jetzige Form erst in Leipzig angenommen haben. Meine Reise besaß auf Grund ihrer besonderen Ziele auch einen ganz besonderen Charakter. Ich sollte den Menschen erforschen, sollte in den Sitten und Gebräuchen, den Erzählungen und Mythen die Negerpsyche ergründen. Das bedingte einen unausgesetzten, innigen Verkehr mit den schwarzen Leuten. Masumgumso nennt der Suaheli die Tätigkeit, die ich ein halbes Jahr hindurch getrieben habe; unsere Wörterbücher übersetzen das mit „Unterhaltung“. Das trifft den Sinn meines Masumgumso nur so obenhin; dieses hatte stets den ernsten Hintergrund der wissenschaftlichen Forschung, nicht den des Zeitvertreibs. Maneno, Worte, waren es gleichwohl, aus denen es sich zusammensetzte. Kann nur der Leser eine geeignetere Form der Darstellung nennen als die von mir gewählte, die die gesamten Eindrücke eines bestimmten, soeben zum Abschluß gelangten Zeitraumes noch gänzlich unverwischt, dabei jedoch harmonisch ineinander verarbeitet und wissenschaftlich vollkommen verwertbar[S. vi] wiedergibt, ohne dabei in das trockne Einerlei des Tagebuches zu verfallen?
Meine Ostafrikareise liegt bereits um mehr als ein Jahr zurück; eine Unsumme von Berufsgeschäften hat mich an der sofortigen Herausgabe meiner Eindrücke gehindert. Der drohenden Gefahr des Verblassens dieser Eindrücke bin ich dadurch begegnet, daß ich über die Geschehnisse und Ergebnisse jener Reise genau Buch geführt, ja, wo es die Zeit zuließ, sogar Wortlaut und Tonfall des Masumgumso schriftlich festgehalten habe. Vieles habe ich gleichzeitig an Verwandte und Freunde berichtet, besonders an den trefflichen Alfred Kirchhoff, den ich leider nicht mehr wiedersehen sollte. Bei meiner Rückkehr am letzten Januar 1907 war er bereits schwer krank; am 8. Februar ist er verschieden.
Aus meinen gewissenhaften Aufzeichnungen habe ich das jetzige Buch zu komponieren vermocht, ohne den einzelnen Auftritten im Busch und im Urwald, auf dem Marsch und im Negerdorf Gewalt anzutun, und ohne die Milieustimmung zu verderben. Das ist wichtig, gerade bei jenen einzelnen Bausteinen, aus denen das große Gebäude der Wissenschaft vom Menschen von vielen Mitarbeitern nach und nach errichtet werden soll. Weltbewegende Ereignisse bleiben dem Negerleben im allgemeinen vorenthalten; da macht die Stimmung, aus der das kleine Geschehnis geboren wird, alles. Daß ich sie immer getroffen hätte, möchte ich nicht behaupten; im großen und ganzen wird der Leser indes mit mir zufrieden sein können; mir persönlich steigen jedenfalls beim Lesen meiner Zeilen alle die seltsamen Szenen, deren Zeuge ich gewesen bin, wieder mit einer Deutlichkeit vor das Auge, als hätte ich erst gestern vom dunkeln Weltteil Abschied genommen.
Zum nicht geringen Teil verdanken wir die Anschaulichkeit unseren modernen Forschungsmitteln. Die photographische Kamera ist freilich nicht mehr neu, doch bewährt auch sie sich noch immer, sogar weit besser, will mich dünken, als in der Hand der Reisenden früherer Jahrzehnte. Das bringen die feinen Objektive und die guten Platten[S. vii] mit sich. Auf meine mehr als tausend tadellosen Aufnahmen von Land und Leuten irgendwie stolz zu sein, habe ich darum keinerlei Ursache.
Neuer ist schon der Phonograph, und kaum erst in die exotische Völkerforschung eingeführt der Kinematograph. Die Leistungen der Sprech- und Singmaschine haben den Vorzug, auch den Lesern eines Buches zu Gesicht und zu Gehör gebracht werden zu können; ich habe darum wenigstens eine kleine Auswahl der von mir gesammelten Eingeborenenlieder abgedruckt. Der Kinematographenfilm ist das Demonstrationsmittel des Vortragssaals; zugleich ist er das Archiv der dahinschwindenden Sitten unserer Naturvölker. In dieser Eigenschaft sollte seine Anwendung mit allen Mitteln und in größter Ausdehnung angestrebt werden, solange es noch Zeit ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß er seinem eigenen Herrn, der ihn selbst mit den Szenen aus dem Eingeborenenleben bedeckt hat, am meisten erzählt; ihn versetzt er schon beim Aufblitzen des ersten Bildchens in das alte Forschungsgebiet zurück. Der Anschaulichkeit des Buches kommt damit auch er, wenn auch nur indirekt, zugute.
Mein gänzlicher Mangel an musikalischer Bildung hat die Transkription meiner Lieder durch musikalische Freunde bedingt; gern statte ich den Herren Dr. von Hornbostel in Berlin und Dr. Albert Thümmel in Leipzig den wohlverdienten Dank ab.
Nicht geringe Schwierigkeiten bereitet die Wiedergabe gewisser Bantusprachlaute durch unser deutsches Alphabet; am größten sind sie beim Laute „tschi“. So hart wie ihn unsere Sprechweise bedingt, ist der Laut nicht; das „t“ ist kaum hörbar; aus diesem Grunde habe ich vorgezogen, die Silbe nach dem Standardalphabet „chi“ zu schreiben.
Das Buch ist Stückwerk. Natürlich. Wie sollte es dem einzelnen Forscher auch möglich sein, die Gesamtheit der Lebensformen einer ganzen Rasse zu erfassen! Selbst einer Rasse wie der des Negers. Wir nennen den schwarzen Mann Naturvolk; für uns klebt[S. viii] er am Boden, mit dem er bei seiner offenkundigen Ruhelosigkeit gleichwohl nicht verwachsen scheint. Nur scheint; in Wirklichkeit ist er bodenständig wie kaum ein anderer Teil der Menschheit. Afrika ist Sitz und Heimat des Negers seit jeher; in seinen weiten Räumen ist er entstanden; dort ist er physisch zu dem geworden, was er heute ist; dort hat er auch seine Kultur entwickelt. Diese Kultur ist anders als die unsrige; sie ist sicherlich nicht so hoch; doch gewährt auch sie ein ganz bestimmtes, scharf umrissenes Bild. Ob es reizvoll ist, sich in dieses Bild zu vertiefen? Lies dies Buch: es hat in breiten, kräftigen Strichen eine Anzahl Züge jenes Bildes festzuhalten versucht. Nachher magst du selbst urteilen.
Leipzig, 19. September 1908.
K. Weule.
[S. ix]
|
Seite
|
|
|
Vorwort
|
|
|
Erstes Kapitel. Die Ausreise
|
|
|
Zweites Kapitel. Die Ziele
|
|
|
Drittes Kapitel. Es kommt anders
|
|
|
Viertes Kapitel. Lehrzeit an der
Küste
|
|
|
Fünftes Kapitel. Einmarsch ins
Innere. Die ersten Eindrücke
|
|
|
Sechstes Kapitel. Umschau
|
|
|
Siebentes Kapitel. Einleben ins
Volkstum
|
|
|
Achtes Kapitel. Marsch nach Süden.
Meine Karawane
|
|
|
Neuntes Kapitel. Bei Matola
|
|
|
Zehntes Kapitel. Mit und unter
den Yao
|
|
|
Elftes Kapitel. Weitere Ergebnisse
|
|
|
Zwölftes Kapitel. Rovuma-Idyll
und Zug ins Pori
|
|
|
Dreizehntes Kapitel. Unyago überall
|
|
|
Vierzehntes Kapitel. In voller Ernte
|
|
|
Fünfzehntes Kapitel. „Und will
sich nimmer erschöpfen und leeren“
|
|
|
Sechzehntes Kapitel. Schlußzeit in
Newala
|
|
|
Siebzehntes Kapitel. Wiederum zum
Rovuma
|
|
|
Achtzehntes Kapitel. Die Meisterzeit
|
|
|
Neunzehntes Kapitel. Zur Küste
zurück
|
|
|
Zwanzigstes Kapitel. Rückblick
|
|
|
Register
|
[S. x]
|
Seite
|
|
|
Karl Weule (Titelbild)
|
|
|
Kap Guardafui
|
|
|
Hafen von Daressalam
|
|
|
Eingeborenentanz in Daressalam
|
|
|
Straße im Eingeborenenviertel von Daressalam
|
|
|
Karte der großen Karawanenstraße. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Dolcefarniente in einem Hofe von Daressalam
|
|
|
Im Europäerviertel von Daressalam
|
|
|
Bucht von Lindi
|
|
|
Dampfer Rufidyi. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Mündungsgebiet des Lukuledi oberhalb Lindi
(Separatbild)
|
|
|
Reede von Lindi
|
|
|
Arabische Dhau. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Kettengefangene. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Seliman Mamba
|
|
|
Yao-Frauen von Mtua
(Separatbild)
|
|
|
Mädchen aus Lindi
|
|
|
Tanz der Weiber in Daressalam
|
|
|
Alter portugiesischer Turm in Lindi
|
|
|
Unter Palmen
|
|
|
Die Ngoma Liquata. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Makua-Frauen aus dem Lukuledi-Tal
(Separatbild)
|
|
|
Mueramann und Yao
|
|
|
Ruinen der Missionsstation Nyangao
|
|
|
Wamuerafrau
|
|
|
Muerajüngling
|
|
|
Muerafrau mit Unterlippenpflock
|
|
|
Lichte Baumgrassteppe mit Barra-barra
(Separatbild)
|
|
|
Massassiberge. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Inselberg von Massassi
|
|
|
Unsere Mtandibesteigung. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Buschbrand auf dem Makonde-Plateau
(bunte Tafel)
|
|
|
Wanyassa-Jäger mit Hund. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Studienbummel in der lichten Baumgrassteppe
|
|
|
Lager in Massassi
|
|
|
Am traulichen Herd. Hütteninneres in der Rovuma-Ebene
(Separatbild)
|
|
|
Taubenschlag und Speicher
|
|
|
Marschbereit vor Massassi
|
|
|
Rattenfalle
|
|
|
Antilopenfalle
|
|
|
Perlhuhnfalle
|
|
|
Falle für Großwild
|
|
|
Yaohütte
|
|
|
Meine Karawane auf dem Marsche. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Yao-Gehöft in Chingulungulu
(Separatbild)
|
|
|
Lager in Mwiti
|
|
|
Jalousie mit Swastika
|
|
|
Yaohäuptling Nakaam
|
|
|
Hofinneres in Mwiti
|
|
|
Ältere Makondefrau im Festschmuck
(Separatbild)
|
|
|
Hüttentypus der Rovuma-Ebene
|
|
|
Hüttengrundriß
|
|
|
Ruhelager und Herd Susas
|
|
|
Yaofrauen mit Nasenpflock
|
|
|
Makuakindergrab
|
|
|
Matolas Gehöft
|
|
|
[S. xi]
Matambwefrau mit reichem Narbenschmuck
(Separatbild)
|
|
|
Arm-Chronologie
|
|
|
Yaohäuptling Matola
|
|
|
An den Wasserlöchern von Chingulungulu
|
|
|
Makondefrauen von Mahuta
(Separatbild)
|
|
|
Pombegelage
|
|
|
Lager in Chingulungulu
|
|
|
Zwei Makuamütter
|
|
|
Frau am Mörser. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Mehlbereitung in einem Eingeborenengehöft
(bunte Tafel)
|
|
|
Plauderstündchen
|
|
|
Affenraubzug. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Barde Sulila
|
|
|
Yao-Ngoma in Chingulungulu
|
|
|
„Waldschule“ im Pori bei Chingulungulu
(Separatbild)
|
|
|
Yao im Masewekostüm
|
|
|
Yao-Masewe in Mtua
|
|
|
Elefantenherde. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Dorf des Wangonihäuptlings Makachu
(Separatbild)
|
|
|
Grab des Yaohäuptlings Maluchiro in Mwiti
|
|
|
Feuererzeugung
|
|
|
Fischtrocknen am Rovuma
|
|
|
Freske in Akundonde
|
|
|
Mein Begleiter Nils Knudsen
|
|
|
Zwei Matambwemütter
|
|
|
Bergbaufeld Luisenfelde
|
|
|
Flötenkonzert der Unyago-Knaben
(Separatbild)
|
|
|
Der Unglücksvogel Liquiqui. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Yaogräber in Akundonde
|
|
|
Daggara im Walde bei Akundonde
|
|
|
Der Festhüttenring Lisakassa im Walde bei Akundonde
|
|
|
Lachende Schönheiten
|
|
|
Mädchen-Unyago im Wamatambwedorf Mangupa. I.
(Separatbild)
|
|
|
Mädchen-Unyago im Wamatambwedorf Mangupa. II.
(Separatbild)
|
|
|
Der alte Medulla, sein Pfeifchen anbrennend
|
|
|
Mädchen-Unyago im Makondeweiler Niuchi
|
|
|
Tanz der Frauenmaske Njohowe in Newala
|
|
|
Stelzentänzer bei den Makonde. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Unser Lager in Newala
|
|
|
Der Verfasser im newalenser Winterkostüm
|
|
|
Zwei Gelehrte von Newala
|
|
|
Stelzentanz beim Mädchen-Unyago in Niuchi
(Separatbild)
|
|
|
Wasserschöpfende Makondefrauen. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Sandflohverheerungen am menschlichen Fuß
|
|
|
Negerpfad im Makondebusch
|
|
|
Die Urmutter. Holzskulptur eines Makondekünstlers
|
|
|
Der allgemein übliche Türverschluß
|
|
|
Türverschluß bei den Makonde von Jumbe Chauro
|
|
|
Auf der Suche nach dem Schlüsselloch
|
|
|
Gelbgießer beim Schmelzen des Messings
|
|
|
Wanyassa-Töpferei in Massassi
(Separatbild)
|
|
|
Makuatöpferei in Newala
|
|
|
Rindenstoffherstellung in Newala
|
|
|
Makua-Masewe in Newala
|
|
|
Makuafrauen
|
|
|
Kindertragart bei den Negermüttern. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Anwendung des Wurfstocks
|
|
|
Anwendung der Wurfschlinge
|
|
|
[S. xii]
Beim Naturaspiel
|
|
|
Natura
|
|
|
Kreiselspiel
|
|
|
Ikoma-Tanz beim Mädchen-Unyago in Akuchikomu
(Separatbild)
|
|
|
Am Xylophon Mgoromondo
|
|
|
Makondekinder
|
|
|
Negertelephon. Unasikia? Hörst
du auch?
|
|
|
Ndio! Jawohl!
|
|
|
Negertelephon
|
|
|
Drei Vegetarier vom Makuastamm
|
|
|
Kakallefestzug beim Unyagoschlußtag
|
|
|
Maskentanz beim Mädchen-Unyago in Niuchi
(Separatbild)
|
|
|
Wiedergabe eines Eingeborenenliedes durch den Phonographen
(bunte Tafel)
|
|
|
Frau aus dem Makondestamm
|
|
|
Grabbäume an der Boma von Newala
|
|
|
Mehlopfer
|
|
|
Rovumalandschaft
(Separatbild)
|
|
|
Knotenschnur
|
|
|
Rast meiner Soldaten in Hendereras Dorf
|
|
|
Ububa-Kranker
|
|
|
Madyaliwa, Saidi und Makachu
|
|
|
Blick von Nchichira auf den Rovuma
(bunte Tafel)
|
|
|
Matambwefischer. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Waldverwüstung im Rovumatal
|
|
|
Pfahlbau am Rovuma bei Nchichira
|
|
|
Pulver-, Schnupf- und Medizinbüchsen vom Makondehochland
|
|
|
Der Wali von Mahuta
|
|
|
Mutter und Kind
|
|
|
Mehrstöckige Häuser am Rovuma bei Nchichira
(Separatbild)
|
|
|
Yao mit Ziernarben
|
|
|
Makonde mit Ziernarben
|
|
|
Matambwe- und Makuafrau mit Ziernarben
|
|
|
Makuafrauen mit Ziernarben
|
|
|
Makondefrau mit besonders „schönen“ Ziernarben
|
|
|
Ein mißglückter Verschönerungsversuch
|
|
|
Pseudochirurgie
|
|
|
Rückenziernarben einer Makuafrau
|
|
|
Bauchtätowierung eines Makondemannes
|
|
|
Makondemasken
|
|
|
Litotwe
|
|
|
Wangoni-Frauen von Nchichira
(Separatbild)
|
|
|
Bwana Pufesa, der Herr Professor. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Diabolospieler auf dem Makondeplateau
|
|
|
Ein afrikanisches Diabolo
|
|
|
Makondefrau im Festgewand
|
|
|
Zwei Wamueragelehrte. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Makondeweiler in der Gegend von Mahuta
(Separatbild)
|
|
|
Askari in Interim
|
|
|
Die lichte Baumgrassteppe und ihre Tierwelt. Eingeborenenzeichnung
|
|
|
Wanduwandus Grab
|
|
|
Große Ngoma in der Boma von Mahuta
(Separatbild)
|
|
|
Einzugstoilette. Zähneputzen meiner Begleitmannschaft
|
|
|
Der Verfasser im Porikostüm
|
|
|
Der Fels von Aden
|
Der Südosten Deutsch-Ostafrikas. Maßstab 1 : 1000000.
Daressalam, am Pfingstsonntag 1906.
An Frau Professor Weule, Leipzig.
Daß ich das schönste Fest des Jahres — denn dafür halte ich Pfingsten im Gegensatz mindestens zur gesamten deutschen Jugend — unter Palmen verleben würde, hätte ich ein halbes Jahr zuvor noch nicht zu ahnen gewagt. Aber es ist so; seit zwei Tagen weile ich in der Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika und damit an einem Fleckchen Erde, dem auch Leute, die weiter und mehr gereist sind als ich, noch manchen Reiz abgewinnen können. Nicht daß die Szenerie an sich etwas Großartiges oder gar Überwältigendes hätte; im Gegenteil, überragende, wuchtige Berge oder stattliche Ströme fehlen gänzlich; auch die weite Fläche des offenen Ozeans trägt unmittelbar nichts zum Bilde bei, denn Daressalam liegt landeinwärts und ohne nennenswerten Ausblick auf das offene Meer. Was den Zauber des hiesigen Landschaftsbildes ausmacht, das ist vielmehr wohl eine der glücklichsten[S. 2] Vereinigungen von blitzendem Wasser, leuchtendem Grün und strahlender Sonne, die man sich denken kann.
Die Einfahrt in den Hafen selbst läßt den Neuling die kommende Schönheit nicht ahnen; ein von Korallenbänken eingeengtes, überaus schmales, durch seine scharfen Biegungen an die Steuermannskunst hohe Anforderungen stellendes Fahrwasser führt auf den Scheitelpunkt einer scheinbar ausgangslosen, flachen Bucht zu. Plötzlich aber gleitet das Schiff über diesen Scheitelpunkt hinaus in einen außerordentlich engen, von steilen, grünen Uferbänken begrenzten Kanal, der sich, noch ehe der Reisende sich von seinem Erstaunen erholt hat, zu einer weitgedehnten, glitzernden, von Schiffen bedeckten Wasserfläche erweitert. Das ist die berühmte Bucht von Daressalam. Daß wir Deutschen einem solchen Hafen zuliebe das alte Karawanenemporium Bagamoyo mit seiner offenen Reede aufgeben und dafür das bis dahin nahezu unbekannte Negerdorf Daressalam zum Vorort der Kolonie machen mußten, versteht man angesichts der offenkundigen Vorzüge dieser Örtlichkeit vollkommen, auch ohne erst jahrelang im Lande geweilt zu haben.
Mombassa und auch Sansibar habe ich ausreichend genießen können; das deutsche Tanga hingegen ist mir auf der Herfahrt versagt geblieben. Meiner alten Begeisterung für alle körperlichen Übungen folgend, habe ich auch an Bord des „Prinzregenten“ geturnt und mir im Golf von Aden den linken Fuß versprungen. Vermutlich ist das Fersenbein verletzt, jedenfalls macht mir jedes Auftreten große Pein. Für eine halbjährige Inland-Expedition mit ihren Märschen und Strapazen eröffnen sich mir damit nette Aussichten. Von den beiden englischen Zentralpunkten stellt Sansibar die Vergangenheit, Mombassa die Gegenwart und noch mehr die Zukunft dar. Zwar ist die Lage Sansibars auf einer der Festlandküste in ausreichendem Abstande vorgelagerten Insel ein Vorzug, den ihr auch die glänzendste Entwicklung aller gegenüberliegenden Festlandstädte niemals wird rauben können, werden doch die Hauptlinien sowohl des wirtschaftlichen[S. 3] wie auch des geistigen Verkehrs von allen diesen Küstenplätzen aus immerdar radial in Sansibar zusammenlaufen; aber unleugbar ist seit der Fertigstellung der Ugandabahn doch Mombassa das eigentliche Einfallstor in das Innere und wird es nach Maßgabe der heute kaum erst angebahnten wirtschaftlichen Erschließung der zentralafrikanischen Landschaften in stets fortschreitendem Grade bilden. Ob unsere leider immer nur erst geplanten großen deutschen Inlandbahnen den bereits gewonnenen großen Vorsprung Mombassas in absehbarer Zeit oder überhaupt jemals werden einholen können, muß die Zukunft lehren. Hoffen wir das Beste!

Mich als alten Geographen, der sich mit Vorliebe und seit langer Zeit mit der Umfassung der Erdoberfläche durch den Menschen beschäftigt hat, haben Mombassa und Sansibar mehr von der geschichtlichen als von der kolonialwirtschaftlichen Seite interessiert. Wie unendlich wenig wissen selbst gebildete, ja gelehrte Kreise von der reichen Erforschungs- und Erschließungsgeschichte und der bunten politischen Vergangenheit dieses Erdenwinkels am Westufer des Indischen Ozeans! Gerade in diesem Jahre feiern des französischen Admirals Guillain grundlegende „Documents sur l’histoire, la géographie et le commerce de l’Afrique orientale“ ihr halbhundertjähriges Jubiläum;[S. 4] diese Tatsache braucht indessen mit einigem Recht bei uns nur dem Spezialisten auf dem Gebiet der Kolonialgeschichte bekannt zu sein. Um so betrübender aber ist es dafür, daß unseres Landsmannes Justus Strandes vortreffliche „Portugiesenzeit von Deutsch- und Englisch-Ostafrika“ von 1899 so überaus wenig in weitere Kreise gedrungen ist. Der großen Menge bei uns gilt Äquatorial-Ostafrika offenbar als ein ebenso jungfräuliches Kolonialgebiet wie Togo, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika, oder auch wie der größere Teil unserer Südseebesitzungen. Daß hier im Osten vor uns und den Engländern sich seit tausend Jahren die Araber als Kolonisatoren in glänzendster Weise betätigt und bewährt haben; daß nach ihnen, im Anschluß und als Folge von Vasco da Gamas großer Indienfahrt ums Kap der Guten Hoffnung von 1498, die Portugiesen eine umfangreiche Strecke der langen Küste besetzt und jahrhundertelang gehalten haben, bis das stärkere und nachhaltigere Arabertum sie wenigstens aus dem nördlichen Teile wieder vertrieben hat — wie wenigen ist das geläufig! Und doch sind diese Vorgänge und diese Kämpfe um Ostafrika eins der interessantesten Kapitel aus der neuzeitlichen Kolonialgeschichte überhaupt, denn in ihnen tritt zum erstenmal das junge, europäische Kulturelement einem kampfgewohnten Gegner des Orients entgegen. Ja, in Wirklichkeit bedeutet jener Kampf um den nordwestlichen Indischen Ozean nichts Geringeres als die Einleitung zu jenem weit größern Ringen, das die weiße Rasse seit vierhundert Jahren um die Oberherrschaft über die Erde schlechthin geführt hat und das sie schon gewonnen glaubte, bis ihr vor wenigen Jahren das unverhoffte Emporsteigen Japans das Trügerische dieses Glaubens und vielleicht auch den Anfang eines ganz neuen Zeitalters zeigte.
Wer nicht bloß hinauszieht, um die äußeren Eindrücke der Gegenwart auf sich einwirken zu lassen, sondern wer es gewohnt ist, hinter den Erscheinungen von heute auch die der Vergangenheit zu sehen, oder wer wie ich den Kulturboden Europas verläßt, um draußen im dunkeln Weltteil einfache Wilde zu studieren mit dem ausgesprochenen[S. 5] Endzweck, an der Hand der gewonnenen Ergebnisse mitzuarbeiten an der großen Aufgabe, den Entwicklungsgang des Menschen selbst wie auch seiner gesamten geistigen Errungenschaften in allen ihren Teilen aufzuhellen, dem bietet unzweifelhaft gerade die Reise nach Deutsch-Ostafrika in reicherem Maße die Gelegenheit zu Aus- und Rückblicken als so manche andere der großen Routen des modernen Weltreiseverkehrs.
Das hebt bereits dicht hinter den Alpen an. Freilich, zu anthropologischen Studien gibt selbst die mäßige Geschwindigkeit des italienischen Schnellzuges keine Gelegenheit. Den ganz unverkennbaren germanischen Einschlag in der norditalienischen Bevölkerung festzustellen, bedarf es eines langsamen Durchwanderns der Po-Ebene. Aber gleichsam als Symbol für die immer und immer wieder erfolgte Übereinanderlagerung neuer Völkerschichten ist mir schon im Etschtal und noch mehr in ganz Nord- und Mittelitalien das Übereinander von nicht weniger als drei Kulturschichten beim Feldbau erschienen. Getreide am Boden, Fruchtbaumwuchs dazwischen ausgespart, Reben darüber — das ist mir, als wenn sich über die alten Italiker und Etrusker die Langobarden und Goten und viele andere Völker gelagert hätten.
Doch auch geographisch hat mir Italien eine große Überraschung gebracht. Ich entsinne mich, daß eine der ersten kartographischen Taten meines Lebens die zeichnerische Wiedergabe der Apennin-Halbinsel gewesen ist. Diese Jugendsünde fällt noch in den Aufenthalt in meinem hannoverschen Heimatsdörfchen. Ein mir zu Weihnachten geschenkter kleiner Stielerscher Schulatlas von 1875 reizte mich zum Kartenzeichnen an. Italien erschien mir als die einfachste Aufgabe; nur das lange Gebirge machte mir Mühe. Richtig habe ich damals denn auch die ganze Halbinsel fast lückenlos mit einer riesigen Raupe nach der Lehmannschen Strichelmanier ausgefüllt. Seitdem war der Apennin in meinem Empfinden mehr und mehr zusammengeschrumpft; aber beim Durchfahren der langen Strecke von Modena bis Neapel ist es mir immer mehr zum Bewußtsein gekommen, daß der hannoversche[S. 6] Dorfjunge mit seinem dumpfen Gefühl doch eigentlich mehr im Recht gewesen ist als der spätere Privatdozent für Erd- und Völkerkunde und der heutige Professor. In der Tat beherrscht das Gebirge die Halbinsel vollkommen; mag man unmittelbar an seinem Fuß dahinfahren oder aber sich weiter von ihm entfernen, stets zwingt das Landschaftsbild zu der Überzeugung, daß der Apennin das starke Rückgrat, alles ihm Anliegende aber nur der mehr als magere Körper der schlanken Halbinselgestalt ist. Die leichte Schneedecke, die zur Zeit meiner Fahrt, im ersten Drittel des Mai, alle Spitzen des Gebirges überzog, während unten alles grünte, war nur noch mehr geeignet, den Eindruck des Wuchtigen und Gewaltigen zu erhöhen.

Räumlich ruft Italien samt seinen Meeren uns Söhnen der erdumspannenden Neuzeit den Eindruck der Enge hervor; auch sie ist entschieden begründet durch das Überwiegen des Gebirgscharakters, der die schmale Halbinsel bis auf wenige ebene Stellen erfüllt. Angesichts dieser Engräumigkeit verliert der Gedanke, daß sie nicht in letzter Linie für die alten Römer die Veranlassung gewesen ist,[S. 7] so bald und so nachhaltig den Fuß auf die übrigen Randländer des Mittelmeeres zu setzen, alles Ketzerhafte. Von Neapel bis zum Stromboli und Sizilien ist nur ein Schritt, und von Sizilien nach Karthago hinüber ist es ein noch kleinerer. Unverhältnismäßig geräumig erschien im Mai des Jahres 1906 nur der Golf von Neapel, das vielgepriesene Landschaftswunder der Alten Welt; in den vier oder fünf Tagen, die ich vor meiner Abreise an Bord in Neapel und seiner Umgebung verlebt habe, war die Bucht zu keiner Zeit klar übersehbar, die Fernsicht vielmehr stets durch einen feinen Nebel verschleiert. Das war ein Nachklang des großen Vesuvausbruchs vom April; der andere Grund war die Aschenschicht, die selbst im vesuvfernen Neapel Häuser und Straßen dicht überdeckte und alles grau in grau erscheinen ließ. Zum Neapolitaner paßt diese Farbe schlecht; uns arbeitsame Mitteleuropäer berührt er in seiner rettungslosen Verkommenheit mehr komisch als verletzend; zu seiner sorglosen Faulheit gehört dann aber natürlich auch der ewig heitere und klare Himmel, von dem die Reisebücher erzählen, von dem aber so kurz nach den Schreckenstagen des April nur sehr wenig zu merken war.
Wie kümmerlich es auf den alten Kulturböden des Mittelmeeres um den Waldbestand bestellt ist, wissen wir seit der Sexta; dennoch mutet den Reisenden die süditalische und sizilische Landschaft noch fremdartiger an als die nord- und mittelitalische; sie ist noch waldloser und daher in den Konturen noch schärfer als der etrurische und romanische Apennin und die Abruzzen. Was uns Bewohner der norddeutschen Tiefebene aber am seltsamsten berührt, das sind in der Straße von Messina die sich fast steil in das Innere des Landes verlierenden Flußtäler. Zu dieser Jahreszeit scheinen sie entweder nur wenig Wasser zu führen oder ganz trocken zu liegen, so daß sie den Eindruck breiter Landstraßen hervorzurufen wohl geeignet sind. Aber wie furchtbar muß die Gewalt sein, mit der sich nach starken Regengüssen die von keinem Waldboden zurückgehaltene Wassermasse im Strombett sammelt, um in diesem dem Meere zuzustürzen. Links[S. 8] und rechts von Reggio, Messina gegenüber, fallen stark gewundene Flußbetten in großer Anzahl ins Meer, alle hoch mit Geröll aufgeschüttet; die Brücken aber laufen über sie mit den Abmessungen hochgewölbter Eisenbahnbrücken hinweg.
Die Fahrt durch das östliche Mittelmeer gehört unstreitig zum Reizvollsten, was man sich denken kann; schon das Wellenspiel der prachtvoll blauen Flut ist geeignet, den Sinn für Ort und Zeit selbst während der nur wenige Tage währenden Überfahrt aufzuheben. Nur eine Empfindung ist mir in jenen Tagen stets klarer zum Bewußtsein gekommen. Die dicken Strahlenbündel, die auf den Seeverkehrskarten unserer wirtschaftsgeographischen Atlanten von allen größeren Hafenplätzen ausstrahlen, sind nur zu sehr geeignet, in uns die Vorstellung zu erwecken, daß nun auch in Wirklichkeit und selbst auf hoher See sich Schiff auf Schiff begegnen müsse. Und doch, wie anders ist das Bild: Ich habe den Ärmelkanal, die befahrenste Seestrecke der Erde, eine ganze Reihe von Malen gekreuzt und entsinne mich, kaum mehr als je ein paar Fischerbarken zu Gesicht bekommen zu haben. Hier im Mittelmeer hat der erste Dampfer unseren Kurs im Meridian von Alexandrien gekreuzt; erst unmittelbar vor Port Said und dem Eingang zum Suezkanal hat sich das Bild durch das Zusammentreffen zahlreicher Dampfer belebt. Auffällig unter ihnen war uns Reisenden des „Prinzregenten“ eine Gruppe niedrig gebauter, also wohl englischer Kriegsschiffe, die anscheinend manövrierten. Auch Torpedoboote waren dabei. Sie alle entschwanden sehr bald in der dicken, diesigen Luft, die uns auch hier begleitete. Später, in Port Said, haben wir des Rätsels Lösung erfahren. Auf einem der dort liegenden englischen Panzer wehte die Flagge auf Halbmast; eine Nachfrage ergab, daß vor Damiette an den Nilmündungen in der vergangenen Nacht ein Wirbelsturm gehaust und ein kleines, mit nur neun Mann besetztes Torpedoboot zum Sinken gebracht hatte. Die von uns am Morgen gesichteten Schiffe hatten nach dem verlorenen Boote gesucht. „Geschieht den Engländern gerade recht“, bemerkte bissig eine deutsche[S. 9] Dame. Keiner von uns anderen hat diesen Standpunkt teilen können; schon aus politischen Gründen nicht, denn ein solch winziger Verlust schwächt die englische Riesenflotte nicht im mindesten; aber noch weniger aus rein menschlichen Gründen, denn auch jene neun verlorenen Braven haben doch ihre Mütter, Frauen oder Bräute gehabt.
Über Port Said und den Suezkanal darf ich mich wohl ausschweigen; heute, wo auch von uns Deutschen ein hoher Prozentsatz in dieser Weltecke bewandert ist, darf sich der Gelehrte andere Gebiete der Darstellung vorbehalten. Mit dem Eintritt ins Rote Meer habe ich für meine Person zumal ein mir ganz vertrautes Feld betreten, fast möchte ich sagen, ein mir zu eigen gehöriges. Den trefflichen Friedrich Ratzel deckt nun schon mehrere Jahre die Erde, aber nimmer soll es ihm vergessen sein, daß gerade er es gewesen ist, der die Anregung zu einem Fundamentalwerk gegeben hat, wie es die Helmoltsche Weltgeschichte tatsächlich ist. In diesem universalgeschichtlichen Werk, dem die Kritik fast keinen andern Vorwurf hat machen können, als daß es ein Sammelwerk, d. h. von 30 oder mehr verschiedenen Männern geschrieben worden ist, hat mir die eigenartige Aufgabe obgelegen, die Geschichte der Weltmeere und ihre Bedeutung für die Menschheit zu schreiben. Das war entschieden etwas Neues und Neuartiges, und es ist, das kann ich ruhig zugeben, keine leichte Aufgabe gewesen. Sollte ich dereinst einmal einer Biographie gewürdigt werden, so wird man mir im Kleinen nachrühmen können, was Ratzel angesichts seiner „Politischen Geographie“ im Großen für sich in Anspruch nahm: einen gewissen Mut, wenn auch nur einen literarischen. Leichter und auch angenehmer ist es in der Tat, geographische oder ethnographische Monographien zu schreiben, als programmatische Werke von der Art der „Politischen Geographie“ zu begründen.

Von den Monographien über die drei Ozeane ist mir nach allgemeinem Urteil diejenige über den Atlantischen Ozean am besten gelungen, aber menschheitsgeschichtlich interessanter ist ganz ohne Zweifel die über den Indischen Ozean. Vor seinen beiden Nachbarn im Osten[S. 10] und im Westen hat er vor allem den Vorzug einer recht langen Einwirkung auf die ihn umgebenden Rassen und Völker voraus; der Stille Ozean hat geschichtliche Völker — geschichtlich im Sinne unserer bisherigen, recht engherzigen und einseitigen Geschichtschreibung gefaßt — nur an seinem Nordwestrande, in Ostasien; die ganze übrige riesige Umrandung ist bis fast auf die Gegenwart geschichtlich tot und leer. Der Atlantische Ozean bietet genau das Gegenbild: seine geschichtliche Dichte ist auf den Nordosten beschränkt; Afrikas Westküste und Amerikas Ostküste sind bis auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika geschichtlich ebenfalls nur in geringfügigster Weise von Belang. Zwischen diesen beiden Zentren aber, dem mittelmeerisch-europäischen Kulturkreis im Westen und dem ostasiatisch-indischen im Osten, hat der Indische Ozean das Bindeglied schon zu Zeiten gebildet, als Atlantic und Pacific noch absolut leere und unbefahrene Wasserwüsten waren. Das gilt indessen nicht für den ganzen Indischen Ozean, sondern nur für seinen Norden und insonderheit für die beiden lang nach dem Okzident hin gestreckten Buchten des Persischen Golfs und des Roten Meeres. Heute, wo wir ganze Kontinente mit Eisenbahnen durchqueren und wo unseren Kanalbauten selbst Bergzüge keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstellen, bilden wir uns ein, daß Landmassen von der Breite des Isthmus von Suez oder der ungleich breitern syrischen Pforte, d. h. des Verbindungswegs zwischen dem Persischen Golf und dem östlichen Mittelmeer, auf den Schiffsverkehr der Alten hätten abschreckend wirken müssen. In gewisser Weise ist das auch der Fall gewesen, denn sonst hätten nicht soundso viel[S. 11] Herrscher des Altertums versucht, den Kanal von Suez schon vor uns zu bauen; aber wo die Technik nicht hinreicht, derartige Hindernisse zu überwinden, und wo gleichzeitig das Bedürfnis für die Kostbarkeiten des Orients so ungeheuer groß ist wie während des Altertums und des Mittelalters, da lernt man sich bescheiden und sucht auf dem Wasserwege soweit zu kommen, wie es irgend geht. Nur diesem Umstande ist die fast lückenlose Benutzung des Roten Meeres in einem mehrtausendjährigen Zeitraum zuzuschreiben; selbst sein gefährliches Fahrwasser und die für die Segelfahrt ganz ungünstigen Windverhältnisse haben an dieser Bedeutung nichts zu ändern vermocht.
Nur eine Periode der Ruhe, ja man möchte sagen eines Dornröschenschlafs, hat dieses Rote Meer durchgemacht. Das ist die Zeit, während welcher der zum Bewußtsein seiner Kraft und seiner Macht gelangte Islam seine schwere Hand auf die Übergangszone zwischen dem Westen und dem Osten zu legen vermocht hat. Mit dem Durchstich der Landenge von Suez ist auch der letzte Schatten dieses alten Hindernisses wie weggeblasen, und wie mit einem Schlage haben das Rote Meer und der Norden des Indischen Ozeans überhaupt den alten Platz im Verkehrsleben der Menschheit in vollstem Maße wieder gewonnen.
Als Reisender an Bord eines modernen Dampfschiffes hat man alle Ursache, auf seine Zeit und ihre Leistungen mit einigem Stolz herabzublicken. Eine alte Definition des Begriffs „Naturvölker“ geht dahin, mit diesem Ausdruck alle diejenigen Menschheitsgruppen zu bezeichnen, die noch von der Natur abhängig sind, noch völlig in ihrem Bann stehen, im Gegensatz zu den Kulturvölkern, die sich von dieser Herrschaft der Natur emanzipiert haben. Ist diese Begriffsbestimmung richtig, so sind wir Europäer in der Tat wenigstens in der Richtung Kulturvölker im höchsten Sinne, daß wir uns hinsichtlich unseres Verkehrswesens von der Natur nicht nur befreit haben, sondern sie fast unumschränkt beherrschen. Welcher andere Zeitraum, welche andere Rasse, welches andere Volk ist je imstande gewesen,[S. 12] sich seine Verkehrswege selbst zu wählen, über die Natur und gegen die Natur, wie wir es hier bei Suez getan haben? Und welches Volk des Altertums oder des Mittelalters hätte je das Recht gehabt, von sich sagen zu können, daß es große Meere, ja ganze Ozeane nach Gefallen brachliegen zu lassen oder durch den Kiel seiner Flotten von neuem zu beleben vermocht hätte, wie wir es mit dem Roten Meer und dem Norden des Indischen Ozeans getan haben?
Für den deutschen Reisenden ist diese Genugtuung des modernen Kulturmenschen um so größer und berechtigter, als er unter den zahlreichen Dampfern, die ihm im Suezkanal und im Roten Meere täglich begegnen, in nicht geringer Zahl auch die heimische Flagge vertreten sieht. Auch der Umstand muß unzweifelhaft zur Stärkung unseres so lange brachliegenden Nationalstolzes beitragen, daß gerade unsere deutschen Schiffe so gern von Angehörigen anderer Nationen und besonders von unsern Vettern von jenseits des Kanals aufgesucht werden. Für mich als Ethnographen war es ungemein interessant, das gegenseitige Verhalten der verschiedenen Nationen an Bord zu studieren. Von diesen kamen allerdings nur die deutsche und die englische ernsthaft in Frage, denn die geringe Zahl von Italienern, Portugiesen usw. zählte numerisch nicht mit. Die englische Reisegesellschaft stand sichtlich noch ganz im Banne der Invasionsfurcht, die ja ihren Ausdruck in zahlreichen Schriften der letzten Jahre gefunden hat; Le Queux’ „Invasion von 1910“ war bei ihr das am meisten gelesene Buch der Schiffsbibliothek, und kaum ein Angehöriger dieses Volkes hat sich mit uns Deutschen unterhalten, ohne nicht schon nach kurzer Zeit die Rede auf dieses Thema zu bringen.
Zu derartigen Unterhaltungen kam es übrigens erst verhältnismäßig spät, vom Beginn der Reise aus gerechnet; man ging im Gegenteil zunächst ziemlich frostig aneinander vorüber. Der Ruhm, diese Verhältnisse zum Bessern und Angenehmern gekehrt zu haben, gebührt seltsamerweise einem höchst unscheinbaren Instrument, das zu meiner anthropologischen Ausrüstung gehört. Im südlichen Roten[S. 13] Meer oder im Westen des Golfs von Aden zückte ich eines Tags, halb aus Langeweile, halb um vergleichende Kraftstudien anzustellen, meinen Collinschen Kraftmesser. Das ist ein aus Stahl geschmiedetes, poliertes Oval, klein genug, um von der Hand, in die man es flach hineinlegt, je nach der Kraftentfaltung mehr oder minder stark zusammengedrückt zu werden. Dabei wird der Druck durch ein Zahnradsystem auf einen Zeiger übertragen, der seinerseits wieder einen zweiten Zeiger an einem Zifferblatt vorbeibewegt. Beim Nachlassen des Drucks schnellt der erste Zeiger in die Ruhelage zurück, während der zweite an seinem Endpunkt stehenbleibt und unbeweglich den Druck in Kilogrammen anzeigt. Der Apparat ist eigentlich ein medizinisches Instrument, doch ist er auch sehr gut geeignet, die Kraftverhältnisse der verschiedenen Rassen miteinander zu vergleichen; vor allem jedoch scheint er berufen zu sein, die fremdesten Menschen in kürzester Zeit einander näher zu bringen. An jenem heißen Morgen hatte ich kaum begonnen, einige Proben meiner Körperkraft abzulegen, als auch schon die ganze englische Herrengesellschaft in dichter Masse um mich versammelt war; Jung- und Altengland witterte einen Sport, für den es ja immer und überall und unter allen Umständen zu haben ist. Zum Lobe Deutschlands muß ich aber gestehen, daß auch unsere Herren rasch und vollzählig zur Stelle waren; ebenso rühmend kann ich sodann vermerken, daß in diesem friedlichen Wettkampf der Nationen wir Deutschen durchaus nicht unterlegen sind, sondern gut abgeschnitten haben. Unser gutes deutsches Turnen scheint demnach als Leibesübung durchaus nicht so minderwertig zu sein, wie es neuerdings von so vielen berufenen und noch mehr unberufenen Seiten hingestellt wird.
Auch in seinem Allgemeinauftreten an Bord steht nach meinen Beobachtungen der Deutsche von heute nicht im mindesten mehr hinter den seebefahreneren anderen Nationen zurück. Freilich schimmert durch die Allüren fast jedes Engländers noch immer der alte Anspruch zart hindurch, der geborene Pächter aller Seeherrschaft im Großen und im[S. 14] Kleinen zu sein. Aber man fängt doch an, uns anzuerkennen, nicht aus heißer Liebe zum germanischen Vetter, sondern einfach weil man muß. Wenn man, um komfortabel zu reisen, auf deutsche Schiffe angewiesen ist und wenn man daheim und draußen mit einer deutschen Handels- und einer deutschen Kriegsflotte zu rechnen hat, von denen die eine so nachhaltig Konkurrenz macht, während sich die andere stetig, wenn auch langsam, vergrößert, so sind das doch alles Momente, die selbst auf den minder gebildeten Angehörigen der britischen Nation ihren Eindruck nicht verfehlen. Nur eins ist gegenwärtig und wohl auch noch für lange Zeit geeignet, uns in den Augen Altenglands mit dem Fluch der Lächerlichkeit zu beladen, und das ist der Sansibar-Vertrag! Niemals werde ich die schadenfrohen Gesichter und nie die spöttisch bedauernden Worte vergessen, mit der wir unglücklichen Zeitgenossen des seligen Caprivi bei der Ansegelung Sansibars bedacht worden sind. Mein Freund Hiram Rhodes aus Liverpool, der ewig Lächelnde und allgemein Beliebte, seiner heitern Lebensauffassung wegen ganz allgemein „der lachende Philosoph“ genannt, war für gewöhnlich nicht im Besitz beißender Ausdrücke, aber in bezug auf die famose politische Transaktion von 1890 entsinne ich mich ganz deutlich, von ihm den Ausdruck: „politische Kinder“ gehört zu haben. Scharf zwar, aber nicht unverdient! Der nach der Besichtigung Daressalams denselben Lippen entströmende andere Ausdruck: „Das ist die schönste Kolonie, die ich je gesehen“, war zwar ein ganz klein wenig mildernder Balsam, aber — Sansibar bekommen wir dadurch doch nicht wieder!
[S. 15]
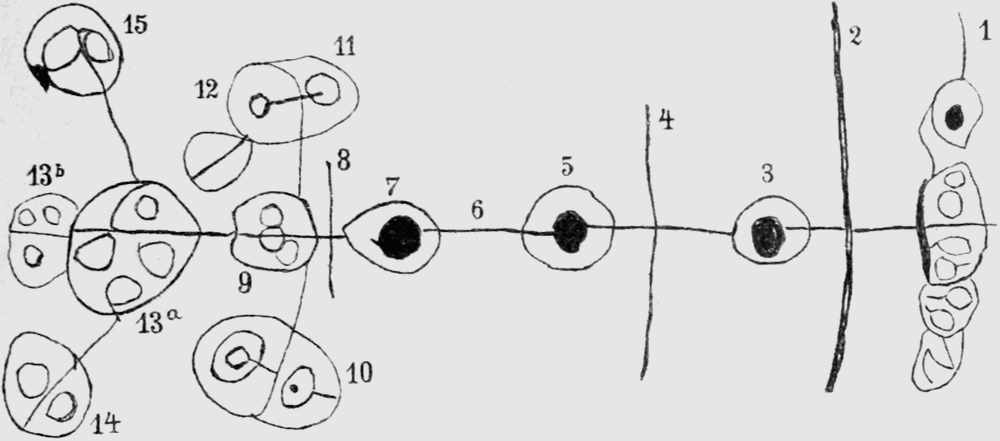
Daressalam, 10. Juni 1906.
Herrn Geheimrat Kirchhoff, Mockau bei Leipzig.
„Was wollen Sie eigentlich in Deutsch-Ostafrika, Herr Professor?“ Wieviel hundert Mal bin ich von dem Augenblick an, als der Plan meiner Expedition feststand, wo ich sie vorbereitete und wo ich auf Eisenbahn und Schiff zu ihrer Durchführung unterwegs gewesen bin, mit dieser Frage behelligt worden! Nicht von dem Mann des Volkes; dem ist unsere Kolonie am Indischen Ozean etwas ebenso Nebelhaftes wie den Alten die ferne Thule; im besten Fall wirft er es mit „Südwest“ oder noch lieber mit Kamerun in einen Topf, ohne sich allerdings auch in diesem Fall darüber klar zu sein, in welchem Quadranten unseres Erdballs die letzteren Kolonien gelegen sind. Für die Popularität der Völkerkunde ist es unzweifelhaft ein sehr bedenkliches Zeichen, daß gerade die Gebildeten, ja selbst manche Gelehrte, über die Aufgaben, die eines Mannes von meinem Schlage da draußen harren, sich auch[S. 16] nicht die geringste Vorstellung zu machen vermögen. Sie, Herr Geheimrat, sind ja selbst ein Dritteljahrhundert hindurch deutscher Universitätsprofessor gewesen und wissen daher, daß ein solcher, und hätte er auch nur ein Atom Ihrer mit Recht berühmten Redegabe, sich keine Gelegenheit vorübergehen läßt, über diese besagten Ziele und Aufgaben ein zünftiges Kolleg zu lesen. Zu Nutz und Frommen von uns beiden und zur Kenntnisnahme für jeden, der es hören mag, will ich daher denn auch Ihnen, der Sie als Bearbeiter der Peschelschen Völkerkunde vollwichtiger Fachmann und Kollege sind, in kurzen Worten wiedergeben, welche Umstände mich hier an die grüne Bucht am Indischen Ozean geführt haben und welche Ideen ein junger, aber, das darf ich wohl kühnlich behaupten, sowohl als Museumsmann wie Dozent nicht ganz erfolgloser Vertreter der modernen Völkerkunde über die Aufgaben und Ziele seines nunmehr beginnenden Forschungsunternehmens hegt.
Es waren, wie auch Sie während Ihrer Tätigkeit in Halle so oft bemerkt haben werden, durchaus nicht die satten Männer, die bisher ein wirklich ernsthaftes Interesse an dieser unserer Wissenschaft und ihren vielen Einzelproblemen genommen haben, sondern fast immer sind es die deutschen Frauen gewesen, die mich während der langen Seefahrt zu kurzen und langen Aussprachen über das Allgemeine und das Besondere zu veranlassen versucht haben. Noch vor wenigen Jahren hätte ich dies Beginnen sicherlich unter der Kategorie „Neugierde“ registriert; heute, wo ich in die Geistesströmungen unserer Zeit einen tiefern Einblick habe tun können, stehe ich keinen Augenblick an, es als Wißbegier zu bezeichnen; ja, vielleicht ist es sogar jener Wissenshunger, über dessen Größe und Allgemeinheit nur der zu urteilen imstande ist, der Gelegenheit gefunden hat, vor den breiten Massen unserer Volkshochschulkurse und ähnlicher Unternehmungen zu sprechen. Die Damen der ersten Schiffsklasse gehören nun zwar für gewöhnlich nicht zu der dort vertretenen sozialen Schicht, doch sind sie immerhin Angehörige des weiblichen Geschlechts und damit bewußt[S. 17] oder unbewußt Vertreterinnen der Frauenfrage überhaupt. Einen schwachen Abglanz des modernen femininen Wissensdurstes auch bei ihnen zu finden, kann demgemäß nicht überraschen.
„Also nach Kondoa-Irangi wollen Sie zunächst, Herr Professor, um von dort Ihre Expedition zu beginnen?“ fragen mich eines Tags, bei der Einfahrt aus dem Golf von Aden in den Indischen Ozean, die interessiertesten der Damen, die Gattin eines in ganz Deutsch-Ostafrika bekannten, tapferen, alten Wissmannkriegers, der jetzt als Fideikommißbesitzer in Usambara ein beschauliches Dasein führt, und die Gattin eines höheren Schutztruppenarztes.
„Freilich hoffe ich auch einmal nach Kondoa-Irangi zu gelangen, meine Damen, aber in Wirklichkeit hat meine Expedition schon lange begonnen“, konnte ich mit einem Lächeln antworten, das Ihnen, Herr Geheimrat, sehr wohl verständlich sein wird, das den beiden Damen aber so lange ein Rätsel blieb, bis ich mich zu folgendem Privatissimum aufschwang.
„Was ich in Deutsch-Ostafrika selbst will, werde ich Ihnen in sehr wenigen Worten auseinandersetzen können. Wir Deutschen haben seit jeher die Fähigkeit gehabt und die Neigung besessen, unsere Haut als Forscher auf allen Gebieten nur zu gern im Dienst oder im Interesse anderer Nationen zu Markte zu tragen; das ist zu einem Teil die Folge unserer frühern unglücklichen politischen Zersplitterung und Schwäche, zum andern ein Ausfluß der uralten germanischen Wanderlust. Rein zu wissenschaftlichen Zwecken, ohne nationalistisch-egoistische Nebengedanken, hat nun der Reichstag schon vor Jahrzehnten einen Fonds ausgeworfen zur wissenschaftlichen Erforschung Afrikas. Das war noch vor dem Beginn unserer kolonialen Ära. Man hätte nun meinen sollen, daß dieser Fonds, der mit seinen rund 200000 Mark für die kurze Spanne eines Jahres eine recht hübsche Summe darstellt, nach unserer Festsetzung in West- und Ostafrika und in der Südsee ohne weiteres ganz oder doch wenigstens zum größten Teil zur systematischen Erforschung und Erschließung[S. 18] dieser unserer Kolonien hätte Verwendung finden sollen. Das ist indessen nicht oder doch nur in recht unsteter und recht ungleicher Weise geschehen, zum großen Schmerz aller deutschen wissenschaftlichen Kreise, die unter diesen Umständen sich nur auf die gelegentlichen Berichte von Offizieren und Beamten, oder auf vereinzelte amtliche oder private Forschungsunternehmen angewiesen sahen.
„Eine lebhaftere Agitation zur Herbeiführung besserer Zustände, d. h. der Verwendung des Afrikafonds in erweitertem Maße zur systematischen Erschließung unserer Schutzgebiete, setzt erst mit dem ersten Kolonialkongreß von 1902 ein. Von allen Wissenszweigen, der Geographie und Geologie, der Anthropologie und Ethnographie, der Zoologie und Botanik, der vergleichenden Rechtswissenschaft wie der Linguistik und der jungen vergleichenden Musikforschung, wurde damals der gleiche Ruf erhoben, mit dem Erfolge, daß wir drei Jahre später, bei dem zweiten Kolonialkongreß im Oktober 1905, schon imstande waren, für die einzelnen Disziplinen die dringendsten Arbeiten und die Hauptforschungsfelder klar zu bezeichnen. Dennoch hätte die Inangriffnahme der Arbeit selbst wohl noch lange gute Wege gehabt, hätten wir nicht in der „Kommission für die landeskundliche Erforschung der deutschen Kolonien“ und ihrem energischen und tatkräftigen Vorsitzenden, unserm trefflichen Leipziger Mitbürger Professor Dr. Hans Meyer, einen Hilfsfaktor bekommen, der die ganze Angelegenheit ohne jedes weitere Federlesen aus dem deutschen Normalzustand endloser Beratungen mit einem Schlage in die Tat umsetzte. Die Herren Dr. Jaeger und Eduard Oehler, die Sie, meine Damen, dort am Ende des Decks lustwandeln sehen, und ich sind die leibhaftigen Belege für diese ungewohnte deutsche Schnelligkeit, denn tatsächlich sind wir die ersten Auserwählten, die im Auftrage jener dem Kolonialamt angegliederten Kommission den alten Traum der deutschen Wissenschaft verwirklichen zu helfen beauftragt sind.

„Jene beiden jungen Herren gehen zu rein geographischen Zwecken hinaus; sie sollen das interessante vulkanische Verwerfungs- und[S. 19] Bruchgebiet zwischen dem Kilimandscharo und dem Victoria-Nyansa untersuchen; ich dagegen bin beauftragt, in etwa demselben Gebiet etwas Ordnung in das dortige Völkerchaos zu bringen. Dort, in dem Distrikt um den Manyara- und den Eyassi-See und in der Zone südlich von beiden, wimmelt es nämlich von Völkern und Völkchen, die der Völkerkunde trotz mehr als zwanzigjähriger Bekanntschaft mit ihnen noch recht viele Rätsel aufgeben. Sie als ‚Afrikanerinnen‘ werden ja hoffentlich nicht von dem allgemeinen Entsetzen gepackt wie Ihre Schwestern daheim, wenn afrikanische Orts- und Völkernamen auf Sie herniederprasseln, und so kann ich es wohl wagen, Ihnen zu erzählen, daß es hier u. a. das Volk der Wassandaui gibt, von dem man weiß, daß es in seiner Sprache Schnalzlaute hat wie die Hottentotten und Buschmänner, und von dem man vermutet, daß es der vergessene Rest einer uralten Urrasse ist. Ihnen verwandt sollen die Wanege und Wakindiga sein, beide am Eyassi-See schweifend. Aus der ganzen riesigen Afrikaliteratur, von der ich im Laufe der zwanzig Jahre meiner ernsthaften Beschäftigung mit diesem Erdteile doch immerhin einen bedeutenden Teil kennen gelernt habe, ist mir niemals etwas so spaßhaft erschienen wie der Umstand, daß unsere ganze bisherige Kenntnis dieser Wakindiga tatsächlich auf dem Besitz eines Feldstechers in den Händen des Hauptmanns Werther beruht. Dieser schneidige Reisende, der dieses abflußlose Gebiet zu Anfang und in der Mitte der 1890er Jahre[S. 20] zweimal mit großem Erfolge bereist hat, hat nämlich von der Existenz dieser Stämme zwar gehört, von ihnen selbst aber nichts als mit Hilfe seines Fernglases ein paar Hütten gesehen. Seitdem schleppen sich die bloßen Namen wie ein kostbarer Besitz durch alle die zahllosen kolonialen und völkerkundlichen Schriften, die Jahr für Jahr mit dem Anspruch des Gelesenwerdens auf den Arbeitstisch des Gelehrten und den Schreibtisch des Gebildeten herniederregnen.
„Eine ganze Gruppe ebenfalls noch recht wenig scharf bestimmter Völker stellen dann die Wafiomi, die Wairaku, Wa-Uassi und Wamburru dar, auch die Waburunge; sie alle stehen im Verdacht des Hamitentums, haben zum Teil recht merkwürdige Kulturformen ausgebildet, laufen aber Gefahr, unter dem Ansturm der neuen Verhältnisse ihre Eigenart noch schneller zu verlieren als so manches andere afrikanische Volk. Schon aus diesem Grunde ist ihre systematische Aufnahme nötig, solange es noch Zeit ist.
„Das gleiche gilt auch von einem wirklichen Völkerrest, als welcher die Tatoga oder Wataturu unzweifelhaft aufzufassen sind. Sie sollen eine dem Somali verwandte Sprache reden, leben aber heute über ein so weites Gebiet zerstreut, daß bei ihnen die Gefahr des Verschwindens ihres Volkstums womöglich noch größer ist als bei den anderen. Die letzten der für mich in Frage kommenden Stämme sind schließlich die Wanyaturu, die Wairangi und Wambugwe. Sie alle gehören zu der großen Völkergruppe der Bantu, haben sich aber gleichwohl eine auf ihrer Isolierung beruhende Eigenart des Kulturbesitzes so treu bewahrt, daß auch sie sehr wohl eine Reise lohnen.“
„Und was wollen Sie, Herr Professor, bei allen diesen Stämmen und Stämmchen? Etwa bloß für Ihr Leipziger Museum sammeln, oder hat die Völkerkunde von heute auch noch andere, höhere Ziele?“
„So ein Museum, meine Gnädigste, ist ja in Wirklichkeit, das wird auch der engherzigste Philister zugeben müssen, eine ganz lehrhafte[S. 21] Einrichtung; kann es wenigstens sein, wenn seine Aufgaben und Ziele richtig erfaßt worden sind. Aber wie wollte die Völkerkunde ihren schon an und für sich soviel angefeindeten Rang als Wissenschaft behaupten, wenn sie nichts Höheres und Besseres kennte, als bloß Bogen, Pfeile und Speere und die tausend andern Sachen zusammenzutragen, aus denen sich der Bestand unserer Sammlungen zusammensetzt! Dieses Sammeln und Konservieren stellt vielmehr nur einen, ich möchte sagen, den elementaren Zweig unserer Arbeit dar; es soll uns in den Stand setzen, die äußere, materielle Kultur der Naturvölker auch dann noch vor Augen zu haben, wenn diese Völker selbst längst zivilisiert oder ausgestorben sind. Der andere, höhere Teil ist die Aufnahme des geistigen Kulturbesitzes, also alles dessen, was auch den Stolz unserer eigenen Kultur ausmacht. Dem Laien mag es scheinen, als ob Neger und Indianer, Papuanen und Australier gänzlich bar allen solchen Besitzes seien: wir anderen wissen indessen sehr wohl, daß selbst noch der niedrigste Volksstamm einen bestimmten Kulturbesitz sein eigen nennt. Nach außen mag der zwar armselig erscheinen, in Wirklichkeit ist er ebenso differenziert und aus ebensoviel Einzelheiten zusammengesetzt wie der unsrige. Anfänge der Wirtschaft, Anfänge sozialer und staatlicher Gliederung sind überall vorhanden, und gerade die sozialen Verhältnisse so manchen Wildstammes spiegeln noch heute Züge wider, die vor Jahrtausenden auch unsern Vorfahren eigen gewesen sind. Anfänge der Technik, Waffen und Werkzeuge, Schmuck und Kleidung, Bauwerke und Verkehrsmittel — sie sind längst als ein Gemeingut der Menschheit erkannt worden. Auch die Sprache, Anfänge der Kunst und der Wissenschaft, religiöse Urideen und eine oft recht verwickelte Rechtspflege, alles das gehört ebenfalls zu unserm Forschungsgebiet. Der Grund aber für das eifrige Studium, das wir Kulturvölker auf diese Dinge verwenden, das ist derselbe menschliche Wissensdrang, der uns auch zu den Polen treibt, trotzdem dort keine wirtschaftlichen Werte locken: wir wollen ergründen, welchen Entwicklungsweg unsere eigene hohe[S. 22] Kultur in allen ihren Phasen genommen hat und welches ihre ersten Anfänge gewesen sind.
„Die Völkerkunde dokumentiert sich also im Grunde genommen als Kulturgeschichte, was keinen Einsichtigen überraschen kann. Gleichzeitig ist sie auch eine Geisteswissenschaft im besten Sinne des Wortes, denn auf ihr und ihren Vorarbeiten bauen sich unsere ach so stolzen Geisteswissenschaften im landläufigen Sinne ausnahmslos auf. Gerecht wird sie dem Zweck dadurch, daß die Ethnologie oder vergleichende Völkerkunde alle Lebensäußerungen der Rassen, Völker und Stämme auf ihren psychischen Ausgangspunkt hin untersucht, um auf diesem unendlich mühseligen und langwierigen, doch keineswegs langweiligen Wege zu einer Wissenschaft vom Menschen an sich, um im Bastianschen Sinne zu sprechen, zu gelangen. Das aber können wir nur, wenn wir im Besitz einer möglichst großen Zahl von Einzelbeobachtungen sind; diese wieder können nur auf wissenschaftlichen Reisen gewonnen werden, am besten natürlich durch wissenschaftlich geschulte Kräfte. Sie begreifen demnach, meine Damen, warum und wozu man mich unter diesen Umständen hinausschickt.“
Eine kleine Pause, keine des Entzückens, sondern offensichtlich der Erschöpfung bei meinen beiden Opfern festzustellen, hatte ich nach diesem Erguß, der für jeden andern als den Gewohnheitshörer deutscher Professoren allerdings furchtbar sein mußte, nun doch die heimliche Genugtuung; beide Damen rangen sichtbar nach Luft. Dann aber ermannte sich das weibliche Auditorium mit rascher Entschlossenheit und entgegnete:
„Schön, Herr Professor, das begreifen wir, lassen es auch gelten, ja heißen es sogar gut und wünschen Ihnen jeden Erfolg, in Ihrem Interesse und auch dem Ihrer Wissenschaft. Aber was wir immer noch nicht begriffen haben, das ist, warum und wieso Sie schon jetzt, hier im Angesichte des schlafenden Löwen vom Kap Guardafui, auf Expedition zu sein behaupten; der Boden eines eleganten Passagierdampfers[S. 23] ruft doch im Grunde genommen recht wenig den Eindruck eines völkerkundlichen Forschungsfeldes hervor.“
„Immer Geduld, bitte, meine Damen, die Völkerkunde ist eine Entwicklungswissenschaft, und so müssen Sie auch mir die Gelegenheit, mich selbst zu entwickeln, zugestehen. Entwicklungswissenschaft sind wir insofern, als sowohl der Mensch selbst wie auch seine Kultur sich nach der Höhe und nach der Breite entwickelt hat. Nicht umsonst spricht Friedrich Ratzel immer wieder von einer Tiefe der Menschheit, und eines der interessantesten, allerdings wohl auch schwierigsten Themata der Anthropologie und Ethnographie wird stets die Verbreitungsgeschichte der Menschheit über den Erdball hin bleiben.“
„Nun, wir denken, Asien ist die Wiege der Menschheit, und ex oriente lux sei die Devise, mit der Sie alle marschieren?“
„Das doch wohl nicht, oder besser nicht mehr, meine Gnädigste. Es ist immer bedenklich, eine solche Frage als Unterhaltungsgegenstand anzuschneiden, schon weil man nicht einmal weiß, ob und wann man ihn wird zu Ende führen können; aber da kein anderes Problem die biologischen Wissenschaften in der Gegenwart so stark beschäftigt wie gerade dieses, so will ich Ihnen wenigstens meinen Standpunkt so weit zu skizzieren versuchen, wie es das Ausgangsgebiet unserer Unterhaltung, nämlich die weiteren Ziele meiner Expedition, durchaus erfordert, und wie ich es Ihnen nach meinem Versprechen schuldig bin.
„Die Völkerkunde hat es mit der Heimatfrage des Afrikaners von jeher sehr leicht genommen; das Element, an dessen Wohnsitzen wir schon seit Suez entlang fahren, nämlich die Hamiten, ist von allen Autoren der Anthropologie und Ethnographie ausnahmslos über das Rote Meer von Asien her herübergenommen worden. Ziemlich allgemein hat man sich bezüglich des Zeitpunktes dieser Wanderung mit relativ kurzen Zeitabmessungen begnügt, ja der neueste Autor auf diesem Gebiet afrikanischer Völkerkunde, der durch sein Massai-Buch bekannte Hauptmann Merker, der dieses hochwüchsige Volk übrigens für die Semiten in Anspruch nimmt, will den Zeitpunkt der[S. 24] Wanderung und auch ihren Weg genau berechnen können; er setzt ihn um 5000 Jahre zurück.

„Doch auch für die Hauptmasse der Bevölkerung Afrikas, für die Sudan- und Bantuneger, ist die Annahme einer fremden Urheimat ziemlich allgemein; auch diese beiden Gruppen sollen von Nordosten, also aus Asien her, über den Durchgangspaß des Roten Meeres in ihre heutigen Sitze eingedrungen sein.
„Gegen diese letzte Theorie einen energischen Vorstoß zu unternehmen, habe ich mir vor einigen Jahren in der Schrift ‚Zu Friedrich Ratzels Gedächtnis‘ das Vergnügen gemacht. Soweit die ganze Negerfamilie in Betracht kommt, spricht nichts, aber auch absolut nichts dafür, daß ihre Vorfahren jemals anderswo gesessen hätten als in dem Gebiet, das sie im großen und ganzen noch heute innehaben. Kein Zweig der großen Gruppe ist nachweisbar jemals im Besitz irgendwie bemerkenswerter nautischer Kenntnisse gewesen, und keiner hat auch jemals den Fuß aufs hohe Meer gesetzt.
„Aber ist denn das durchaus auch nötig, werden Sie mir einwerfen, wird nicht die ganze Gesellschaft entweder über die Landenge von Suez oder über die schmale Meerenge von Bab el Mandeb gewandert sein? Wir haben die letztere ja erst vor zwei Tagen passiert;[S. 25] sie ist doch so schmal, daß man von einem Ufer das andere deutlich erblicken kann.
„Sehr richtig, meine Damen, aber so einfach ist das Problem denn doch nicht. Für den Menschen beansprucht die moderne Anthropologie ebensolange Zeiträume wie für unsere höhere Tierwelt; den Diluvialmenschen erkennt auch unsere straffste Orthodoxie seit langem an, und an den Tertiärmenschen würde man sich selbst dann gewöhnen müssen, wenn er nicht schon an sich ein logisches Postulat wäre. Mit diesem Herniedersenken des Jugendstadiums unserer Spezies in frühere geologische Perioden wird nun aber das Problem der Herausbildung der Menschenrassen zu einer Aufgabe, die nicht bloß durch Messungen an Schädel und Skelett gelöst werden kann, sondern an der neben der Paläozoologie vor allem auch die Erdgeschichte, also die historische Geologie, tatkräftig mitzuarbeiten haben wird. Soweit ich die Sachlage zu übersehen vermag, werden die in Frage kommenden Wissenschaften sich schließlich wohl auf nur drei Urrassen einigen: die weiße, gelbe und schwarze, die je ihren Herausbildungsherd auf bestimmten alten Dauerkontinenten gehabt haben müssen. Ein solcher Dauerkontinent bestand in der Tat lange geologische Zeiträume hindurch auf der südlichen Halbkugel. Einen großen Rest von ihm stellt das heutige Afrika dar; kleinere hat man in der indonesisch-papuanischen Inselwelt und in Australien zu sehen. Die Verbreitung der schwarzen Rasse von Senegambien im Westen bis Fidji im Osten erklärt sich auf diese Weise spielend.
„Und auch für die großen Gruppen der Mischrassen werden wir nach meiner Ansicht für die Zukunft nicht mehr ohne die Zuhilfenahme geologischer Veränderungen der Erdoberfläche auskommen. Woher leiten wir den Hamiten und was verstehen wir überhaupt unter diesem Begriff, der auffälligerweise eine Völkerzone umschließt, die sich geographisch lückenlos zwischen die weiße und die schwarze Rasse einschiebt? Wie will man des fernern die sogenannten Uralaltaier erklären, jene schwer zu umschreibende Völkermasse zwischen dem[S. 26] mongolischen Urelement im Osten und dem weißen im Westen? Wird man nicht auch hier auf den Gedanken kommen müssen, daß der Anstoß zur Entwicklung beider Gruppen, der Nordafrikaner sowohl wie auch jener Nordasiaten, gegeben wurde durch eine breite und lange Berührung der alten Urrassen, die nach Lage der Dinge, d. h. auf Grund der geologischen Veränderungen sowohl im Südosten des Mittelmeergebietes wie auch im Osten Nordeuropas, nur durch das Zusammenwachsen der vordem durch Meere getrennten, alten Kontinentalkerne geschehen konnte? Tatsächlich sind die Landbrücken an beiden Stellen geologisch sehr jung.
„Derartige Aus- oder richtiger Rückblicke mögen einstweilen noch ketzerhaft oder als vage Hypothesen erscheinen, ohne Zweifel haben sie jedoch das Gute, daß sie uns zur Annahme langer Zeiträume auch für die Entwicklung des Menschengeschlechts zwingen, und das ist ja auch schon ein Fortschritt. Mir persönlich ist es, solange ich mich mit derartigen Fragen berufsmäßig beschäftigen muß, immer recht spaßhaft vorgekommen, daß man für den Menschen die kürzeste Entwicklungszeit annimmt, trotzdem er das höchst gestiegene Lebewesen sein soll. Logischerweise kann man von ihm doch nur gerade das Gegenteil annehmen.“
„Und um alles dieses in Ihrem Haupte zu bewegen, müssen Sie, Herr Professor, erst ins Rote Meer und in den Golf von Aden fahren? Konnten Sie das zu Hause nicht viel bequemer haben?“
„Das freilich, aber keine von Ihnen, meine Damen, wird leugnen können, daß die persönliche Kenntnis des Schauplatzes eines Vorganges, wenn nichts anderes, so doch zum mindesten ein kräftiger Ansporn ist, sich mit jenem Vorgang selbst und seinen Ursachen noch intensiver zu beschäftigen, als man das fern von ihm tun würde. Für mich ist demgemäß die, wie Sie zugeben werden, an sich nicht besonders reizvolle Fahrt durch das Rote Meer die beste Gelegenheit gewesen, mich mit dem Problem der Rassenherausbildung recht nachhaltig zu befassen, und Sie verstehen nunmehr wohl ohne jede[S. 27] Einschränkung, wie recht ich mit der Behauptung hatte, meine Expedition habe schon längst begonnen.“ —
Vielleicht werden Sie mich schelten, Herr Geheimrat, daß ich derartig schwierige Materien an solchem Ort und vor solchem Kreise angeschnitten habe. Sie haben sicher recht damit; andererseits können gerade wir Gelehrten gar nicht genug Gelegenheiten suchen, unsere Weisheit über die Hörsäle der Universitäten hinaus in die weitesten Kreise zu tragen. Wird man auch nicht überall sogleich verstanden, so beginnt doch hier und da ein leises Interesse zu keimen, das hinterher fröhlich wächst und später vielleicht die schönsten Früchte trägt.
Reuevoll will ich Ihnen nunmehr wieder etwas mehr, statt mit grauer Theorie, mit der fröhlichen Wirklichkeit kommen. Vom Kap Guardafui habe ich ein paar recht hübsche Aufnahmen machen können. Von der Nordseite her ist dieses Vorgebirge nur wenig imposant; es hat den Anschein, als ob das Schiff dicht an Land dahinführe; in Wirklichkeit ist man jedoch 5 bis 6 Seemeilen vom Strande ab, und aus diesem Grunde kommt dem Reisenden die stolze Höhe von nahezu 300 Meter gar nicht zum Bewußtsein.
Eindrucksvoller sieht die Landschaft von Süden her aus; zur Rechten des Schiffes steigen hier die Berge in nahezu senkrechter Steilheit zu fast 1000 Meter empor, oft überlagert von einer kompakten Wolkenschicht, die das Gebirge noch stattlicher und gewaltiger erscheinen läßt. Dennoch wendet sich das Auge immer wieder zum Kap Guardafui zurück. Höher als von der Nordseite aus erscheint es zwar auch jetzt nicht, aber es gewährt selbst dem phantasielosesten Reisenden ein Bild, das allen Ostafrikafahrern unter dem Namen des „schlafenden Löwen“ bekannt und geläufig ist. Ich halte im allgemeinen nicht viel von derartigen Personifikationen von Naturgebilden, an dieser Stelle indessen habe auch ich den Eindruck der Naturwahrheit in vollkommenster Weise empfunden. Tief ist das wuchtige, mähnenumwallte Haupt auf den Boden, das ist in diesem Falle der dunkelblau leuchtende Indische Ozean, niedergeduckt; dicht angeschmiegt liegt die rechte[S. 28] Vorderpranke. Leider ist das königliche Auge geschlossen; zu welch herrlicher Symbolik würde dieses unvergleichliche Bild die Phantasie sonst zu begeistern vermögen! Vor dem Phänomen von heute ist deren Flug nur lahm. Ursprünglich wachte der Löwe; er behütete den regen Seeverkehr, den das ausgehende Altertum und das frühe Mittelalter vor seinen Augen aufrecht erhielten; als Phönizier und Himjariten, Griechen und Römer, Araber und Neuperser von Westen aus nach Osten und nach Süden hinaussegelten; als von Osten her zu wiederholten Malen der mittelalterliche Chinese vorstieß bis in die Bucht von Aden und vielleicht gar bis ins Rote Meer. Das war eine Zeit, des Wachthaltens wert! Doch es kam der Islam und es kam der Türke, es kam ferner die Zeit der Umfahrung des fernen Kaps der Guten Hoffnung und damit die Brachlegung der ägyptischen und der syrischen Pforte. In stummes, dumpfes Brüten versank das Rote Meer, versank der Persische Golf. Das hat Jahrhundert um Jahrhundert gedauert, und dabei ist der Löwe müde geworden und sanft entschlafen.
„Aber sollte nicht der neue Riesenverkehr des Suezkanals ihn bereits haben erwecken können oder müssen“, werden Sie mir einwerfen. Darauf muß ich erwidern: „Nein; das Trägheitsgesetz beherrscht die Welt, auch ist der Schlaf dieses alten Ozeanwächters so tief, daß lumpige vierzig Jahre nicht ausreichen, um ihn zu stören; dazu bedarf es anderer Mittel. Und auch dieses kenne ich. An Bord befindet sich ein italienischer Capitano, ein prächtiger, stattlicher Mensch, dem die Abessinier bei Adua leider mit Speerstichen arg zugesetzt haben. Den fragte ich vorhin, warum denn kein Leuchtturm das Fahrwasser am Kap Guardafui verbessere; sie als Herren des Landes hätten doch eigentlich die Pflicht, für so etwas zu sorgen.“
„Das ist richtig, mein Herr, aber haben Sie schon einmal gegen die Völker dieses Osthorns gekämpft?“ war die Gegenfrage. „Was, glauben Sie wohl, würden die Herren Somâl dazu sagen, wenn wir ihnen die beste Gelegenheit zum gewohnten Strandraub nähmen? Ein schwerer[S. 29] Feldzug wäre die einzige Folge schon des bloßen Versuchs, sich dort oben festzusetzen.“
Der Capitano mag mit seinen Worten recht haben; gleichwohl wird sich Italien auf die Dauer nicht der Notwendigkeit entziehen können, der internationalen Verpflichtung eines Leuchtturmbaues an jener exponierten Stelle nachzukommen; schwarz und traurig liegt auch jetzt der Rumpf eines gestrandeten französischen Dampfers, der in dunkler Nacht auf der Nordfahrt zu früh nach Westen umbog, an der Küste. Mit dem Moment aber, wo dieser Leuchtturm seinen Lichtkegel zum erstenmal über die nächtlich dunklen Weiten des umgebenden Meeres hinaussenden wird, da wird der Löwe erwachen. Dann wird auch er fühlen, daß seine Stunde von neuem gekommen ist. Vorbei der tatenlose Dämmerzustand langer Jahrhunderte, vorbei auch für immer das Sackgassentum jenes Roten Meeres, das Orient und Okzident räumlich so nahe rückte und doch so fern voneinander hielt. Freie Durchfahrt, jetzt und immerdar! —
Der Monsun ist eine angenehme Erscheinung, besonders nach dem erschlaffenden Genuß des Roten Meeres und des Golfs von Aden, doch wird auch er auf die Dauer eintönig und langweilig. Das rührt daher, daß die Länge der Seereise die Sehnsucht nach dem Landungshafen immer stärker werden läßt. Mombassa und Sansibar werden deshalb stets mit Jubel begrüßt und im Eiltempo genossen. Für Daressalam ist man schon gemäßigter gestimmt, doch betritt man nichtsdestoweniger auch diese Stadt mit dem leisen Gefühl einer endlichen Erlösung.
[S. 30]

Lindi, Ende Juni 1906.
Frau Professor Weule, Leipzig.
O dieses Afrika! Das Wort aller „alten“ Afrikaner: „In Afrika kommt es erstens anders, und zweitens als man denkt“ ist mir, solange ich es über mich habe ergehen lassen müssen, und das sind viele Jahre, stets als die Quintessenz alles Stumpfsinns erschienen: doch wenn es einem so ergeht wie mir vor kurzem, dann kann man nicht anders als es jedem Opfer ebenfalls resigniert ins Gesicht schleudern.
Also der 11. Juni. Für etwa den 20. hatten die beiden Geographen und ich unsere Abreise von Daressalam nach dem Norden geplant; mit Sack und Pack und den nötigen Mannschaften wollten wir bis Tanga mit dem Dampfer, von Tanga bis Mombo mit der Usambarabahn fahren, um vom Panganital aus den Marsch durch die Massaisteppe auf Kondoa-Irangi anzutreten. Alle Vorbereitungen[S. 31] waren im besten Zuge. Um sie dem Abschluß näher zu bringen, stehe ich eines schönen Morgens in Daressalam in dem Ausrüstungsgeschäft von Traun, Stürken & Devers und feilsche mit jener Beharrlichkeit und Zähigkeit, die man sich nur als Leiter eines ethnographischen Museums aneignen kann. Halb gleichgültig höre ich der Unterhaltung eines der Verkäufer mit einem weißen Schutztruppenunteroffizier zu, als plötzlich der Name Kondoa-Irangi an mein Ohr schlägt. Jetzt höre ich schärfer hin: „Ich denke, Sie fahren morgen mit dem X auf Urlaub nach Deutschland“, sagt der eine. „Hat sich was, morgen nachmittag marschieren wir ab; ich hab’s ja eben schon gesagt, in Iraku ist Aufstand“, erwidert der andere.
Kondoa-Irangi, Iraku — das sind Begriffe, die mich allerdings sehr angehen. Halb instinktiv wirft’s mich zur Tür hinaus auf die von blendendem Sonnenlicht überflutete Straße. Rrrrrr rasselt auch schon das Maultiergespann des Hauptmanns Merker heran: „Halt, Herr Weule, nach Kondoa-Irangi können Sie nicht“, tönt es laut über die Wollköpfe der schwarzen Passanten hinweg in mein nicht gerade freudig berührtes Ohr.
Ich vermag mich sonst im allgemeinen keiner übergroßen Geistesgegenwart zu rühmen, aber in diesem Augenblick muß ich wirklich blitzschnell gedacht haben; denn kaum hatte ich neben Merker Platz genommen, um im schnellsten Tempo zum Gouvernement behufs näherer Aufklärung zu fahren, da hatte ich auch schon die verschiedenen Möglichkeiten eines Ersatzgebietes in Betracht gezogen, für den immerhin doch sehr wahrscheinlichen Fall, daß meine Irangi-Expedition endgültig aufgegeben werden müsse. In Daressalam gab es in jenen für mich kritischen Tagen keinen Kenner der Verhältnisse, der nicht gesagt hätte: „Ach was, der Iraku-Aufstand ist ja gar kein Aufstand; das ist lediglich eine Bagatelle, ein Streit um ein paar Ochsen, sicherlich aber etwas, was sehr bald beigelegt sein wird.“ Gleichwohl mußte ich dem stellvertretenden Gouverneur, dem stets gleich liebenswürdigen Geheimrat Haber, vollkommen recht geben, wenn er mir einwarf, ein[S. 32] Geograph könne jenes Gebiet nach wie vor mit voller Seelenruhe durchstreifen, unbeschadet der vier Kolonnen deutscher schwarzer Schutztruppen, die von Moschi, Mpapua, Kilimatinde und Tabora radial ins abflußlose Gebiet hineinmarschiert seien. Etwas ganz anderes sei es mit einer ethnographischen Expedition, die könne nur in absolut ruhigen und ungestörten Gebieten arbeiten; keins von beiden sei aber dort oben augenblicklich und für absehbare Zeit zu erwarten. Ob ich nicht nach dem Süden wolle, ins Hinterland von Lindi und Mikindani? Das Land da unten sei zwar auch Aufstandsgebiet, aber es habe den Vorzug, den Aufstand beendet zu sehen; vor allem hätten die Wamuera sehr nachhaltige Hiebe bekommen, so daß ihnen und auch den anderen Völkern jenes Gebietes die Lust zu neuen Übergriffen für einige Zeit vergangen sein werde. Zudem sei im Süden verhältnismäßig viel Militär aufmarschiert, sowohl Schutztruppe wie Polizei; starke Posten hielten die strategisch wichtigsten Punkte besetzt, eine ausreichende Leibwache aber oder eine persönliche Schutztruppe wäre mir dort unten ganz sicher, während ich für das Manyaragebiet auf höchstens ein paar Rekruten rechnen dürfe.
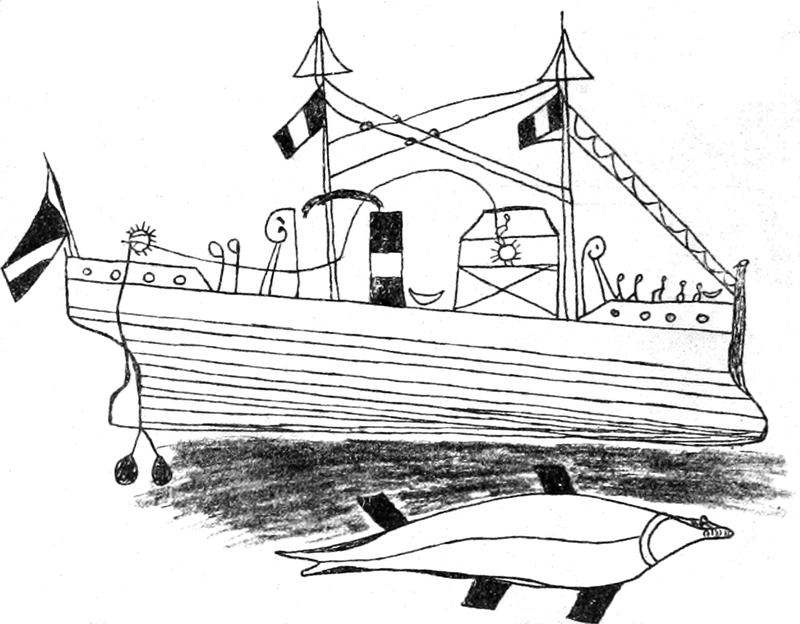

[S. 33]
Mein vieljähriges Studium der afrikanischen Völker hat mir zu keiner Zeit bessere Dienste geleistet als jetzt. Aus erklärlichen Gründen war ich über das vorgeschlagene neue Forschungsgebiet nicht so gut unterrichtet wie über das mir so jäh entglittene, aber ich wußte doch immerhin, daß dort eine ganz ähnliche Anhäufung vieler Völkerschaften vorhanden ist wie im Norden; auch konnte ich mit einiger Bestimmtheit beurteilen, in welcher Weise ich meine neue Expedition aufzufassen und durchzuführen haben würde, um sie zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Dennoch habe ich mich wohl gehütet, den neuen Plan schon jetzt in seinen Einzelheiten zu entwerfen und zu durchdenken; dazu wäre im übrigen auch gar keine Zeit mehr gewesen, denn ich mußte eilen, wenn ich nicht wieder Wochen verlieren wollte. Das Einverständnis der Landeskundlichen Kommission und des Kolonialamts war bald eingeholt, meine Lasten waren gepackt, zwei Boys und ein Koch längst gedungen. Zum 19. Juni stand die Fahrt des kleinen Regierungsdampfers „Rufidyi“ nach dem Süden bevor. Schnell ließ ich mich vom Gouvernement mit der einzigen Karte vom Südbezirk, die zur Zeit verwendbar war, „ausstatten“; ebenso rasch hatte mich das trefflich geleitete Zentralmagazin mit zwei Dutzend stämmiger Wanyamwesiträger versehen; andere unumgänglich nötige Besorgungen und Formalitäten waren ebenfalls im Nu erledigt — kurz, eigentlich ehe ich mich versah, befand ich mich an Bord und in der Ausfahrt des Hafens von Daressalam.
Ich habe mich von vornherein keinen Augenblick der Erwartung hingegeben, eine Forschungsreise sei ein Vergnügen, aber die 3¼ Tage, die ich an Bord dieses „Dämpflings“, wie der alte Schutztruppenhauptmann Seyfried den „Rufidyi“ und seinen gleich kleinen Bruder „Rovuma“ spöttisch, aber mit Recht zu nennen pflegt, werden mir auch, selbst wenn es mir im Innern des Landes einmal schlecht gehen sollte, noch lange in Erinnerung bleiben! Das liegt teilweise an einem Mangel an eigener Voraussicht selbst; statt erst noch im Klub von Daressalam vor der Abfahrt gut und reichlich zu frühstücken, habe[S. 34] ich mir von dem schwarzen Schiffskoch einen Kaffee vorsetzen lassen, der in Verbindung mit dem durch und durch „klitschigen“ Schwarzbrot und der recht ranzig schmeckenden Konservenbutter schon auf dem festen Lande ein wirksames Brechmittel gewesen wäre, der aber auf dem im steifen Südwestmonsun wie toll schlingernden und stampfenden Schiffchen das unvermeidliche Unglück sehr schnell hereinbrechen ließ. „Rufidyi“ und „Rovuma“ sind keine eigentlichen Passagierdampfer, sondern sie dienen mehr zur Verteilung der Post über die lange Küste hin und zur Bewältigung kleinerer Frachten. Infolgedessen sind für etwaige Reisende keine Unterkunftsräume vorhanden; man erklimmt im Ausgangshafen die Kommandobrücke und wohnt, ißt, trinkt und schläft auf ihr, bis man ans Ziel kommt. Bei ganz geringer Anzahl geht das noch an; da haben die Feldbetten, ohne die man ja in Ostafrika überhaupt nicht reisen kann, nachts noch eben Platz nebeneinander; wie es aber sein mag, wenn sechs oder acht Herren und dazu vielleicht gar noch eine Dame sich in diesen Raum von der Größe eines mäßigen Zimmers teilen müssen, wage ich mir kaum auszumalen.
Bei meinem eigenen Weh habe ich mich um das Wohl meiner Mannschaft kaum zu kümmern vermocht. Moritz und Kibwana, meine beiden Boys, und Omari, der Koch, sind weitgereiste Gentlemen, die das Schaukeln und Pendeln des „Rufidyi“ mit stoischer Ruhe über sich haben ergehen lassen; doch dafür haben meine Wanyamwesiträger ihre sonst so unverwüstliche Heiterkeit sehr bald eingebüßt. Sie waren alle mit frohem Mut an Bord gegangen, sich ihren in Daressalam zurückbleibenden Stammesbrüdern gegenüber damit brüstend, wie weit sie in die Welt hinaus kämen und was sie alles sehen würden. Wie die 24 sich auf dem unglaublich engen Achterdeck, das ihnen zudem noch von ein paar Pferden streitig gemacht wurde, haben einrichten können, ist mir heute noch ein Rätsel; sie saßen und lagen förmlich übereinander. Bei der Allgemeinheit und Ausdauer, mit der auch diese Braven dem Meeresgott geopfert haben, muß es für alle eine herrliche Überfahrt gewesen sein!
[S. 35]
Der alte Erdteil Afrika hat nun einmal etwas Starres, Unbewegliches und Konservatives an sich; das haben wir schon beim Löwen von Guardafui gesehen, wir finden es aber selbst im amtlich geregelten Dampferverkehr von heute noch bestätigt. Die Alten fuhren auf See bekanntlich nur bei Tage; auch die weniger seetüchtigen Naturvölker gehen bei ihren Fahrten abends stets unter Land; wir Europäer halten es dagegen für eine unserer ältesten und zugleich höchsten Errungenschaften, daß wir bei unserer Seefahrt weder auf das Wetter noch auf die Nacht Rücksicht nehmen. Von dieser Regel bilden indessen „Rovuma“ und „Rufidyi“ eine seltene Ausnahme; sie suchen sich bei ihren Fahrten kurz vor Sonnenuntergang einen geschützten Schlupfwinkel und fahren erst am nächsten Morgen beim Tagesgrauen wieder hinaus.
Auf der Fahrt von Daressalam nach Lindi und Mikindani, der sogenannten Südtour, wie sie amtlich heißt, ist der erste Nachthafen Simba Uranga, einer der zahlreichen Mündungsarme des großen Rufidyiflusses. Die Einfahrt in diesen Stromarm ist nicht ohne Reiz; schon von weitem erblickt das Auge in der grünen Mangrovenmauer, die für das ausgedehnte Delta charakteristisch ist, eine Lücke. Durch Bojen im richtigen Fahrwasser gehalten, fährt das kleine Schiff zwar nicht schnell, aber doch stetig auf diese Lücke zu. Sie kommt näher und näher, wird breiter und breiter; links und rechts dehnt sich die weißschäumende Brandung an den endlosen Korallenriffen, die die ganze Äquatorial-Ostküste umsäumen, ins Weite. Plötzlich hat man das Gefühl, dem offenen Meer entflohen und im ruhigen Hafen zu sein. Und, fürwahr, er ist stattlich genug; wohl 600, ja 800 Meter breit fließt der Strom ruhig und majestätisch zwischen den grünen Uferwänden dahin, und fast unabsehbar tief dringt er ins Land hinein. Das Schiff muß, um an seinen vorgeschriebenen Liegeplatz zu kommen, noch etwa eine Stunde stromaufwärts dampfen. Melancholisch grüßt von rechts eine aufgelassene Sägemühle herüber; die stattlichen Gebäude liegen verwaist,[S. 36] die Maschinen rosten; das Ganze ist ein stimmungsvoller Beleg für das Trügerische so mancher mit frohen Hoffnungen begonnenen kolonialen Unternehmung. Im Moment des Sonnenunterganges hört die Schiffsschraube auf zu arbeiten; der Anker rasselt hernieder, der „Rufidyi“ macht dicht am linken Ufer fest. Er wird mit Holz geheizt, und zwar mit Mangroveknüppeln, die hier in den Waldungen des Deltas geschlagen und an dieser Stelle für die Übernahme an Bord aufgestapelt werden. Das geschieht unter der Aufsicht eines Försters, den ich leider nicht zu Gesicht bekomme, da er gerade über Land ist. Beschaulich mag sein Dasein freilich sein, aber beneidenswert wohl kaum; auch mitten auf dem breiten Strom umschwirren uns bald dichte Schwärme von Moskitos. An Land, denke ich, werden sie nicht seltener sein. Da wird der Grünrock es wohl machen müssen wie ich in Daressalam, wo ich mich in meinem Anopheles-Dorado, d. h. meinem zwar von herrlichen Kokospalmen und Mangobäumen überschatteten, dafür aber wenig luftigen und von Moskitos überreich bewohnten Zimmer, vor diesen Mitbewohnern nur dadurch retten konnte, daß ich nach Sonnenuntergang mitsamt meinem Arbeitstisch und meiner Lampe stets unter einem Moskitonetz saß, das von einem Rahmen herab an der Decke hing. Der auf diese Weise geschaffene Arbeitsraum war zwar ungeheuer eng, aber er gab dem Insassen doch das Gefühl der reinsten Freude, nämlich der Schadenfreude. Mochten sich die braven Anopheles draußen auch noch so blutgierig und in noch so dichten Schwärmen an die dichten Maschen des Netzes heften, der intelligente Msungu, der Europäer, war vor ihnen absolut sicher.

Was für den Ozeandampfer das Deckwaschen in den frühesten Morgenstunden, gerade zur Zeit des schönsten Schlafes ist, das ist für den „Rufidyi“ die Holzübernahme im Simba-Uranga-Fluß und die Ladungsübernahme auf der freien Reede von Kilwa; in beiden Nächten bin ich bei dem unausgesetzten Gepolter der geworfenen Gegenstände und dem ebenso unausgesetzten Gebrüll der Mannschaft nur sehr[S. 37] wenig zum Schlafen gekommen. Der wirklich wunderbare Sonnenuntergang auf dem Simba Uranga war dafür ebensowenig eine Entschädigung wie die wundervoll stimmungsvolle Ausfahrt am nächsten Frühmorgen. Erquickend hätte erst wieder die frische Brise des Monsuns draußen auf dem offenen Meer wirken können; aber kaum hatten wir dieses erreicht, so begann der Meeresgott auch schon wieder sein Opfer zu fordern. Ich weiß nicht, ob und in welcher Weise ein gesundes Nervensystem auf den Heizungsmodus des „Rufidyi“ reagieren wird; uns drei seekranken Passagieren, die wir uns bis Kilwa in die Annehmlichkeiten seiner Kommandobrücke teilten, ist er furchtbar und unerträglich erschienen. Von den beiden Schwesterschiffen hat wenigstens der „Rovuma“ einen guten Magen; der verdaut die etwa 80 Zentimeter lang geschnittenen Mangroveknüppel wie sie in seinen Kessel hineingeworfen werden. Der „Rufidyi“ hingegen ist von zarterer Konstitution; sein Magen nimmt die Nahrung nur in verkleinertem Zustand auf. Kaum erscheint über dem östlichen Horizont der erste Dämmerschein des grauenden Tages, da kracht, von dem nervigen Arm eines muskulösen Baharia geschwungen, der schwere Hammer mit voller Wucht hernieder auf den Stahlkeil, den ein anderer schwarzer Matrose hilfreich mitten auf den ersten dieser Mangroveblöcke gesetzt[S. 38] hat. Schlag auf Schlag erdröhnt; das eisenzähe Holz ächzt und stöhnt; endlich ist der erste Bissen für den gefräßigen Kessel zerkleinert; in hohem Bogen fliegen die einzelnen Stücke in den engen Heizraum. Krach! erdröhnt es auch schon von neuem, daß der ganze Schiffskörper erzittert. Das Spiel wiederholt sich so Stunde um Stunde, den ganzen Tag hindurch, bis zum Abend hin. Erst dann haben die Negerarme Ruhe; dankbar aber begrüßen unsere seekranken Gehirne diesen Moment des Feierabends; denn was in der ersten Stunde noch erträglich erscheint, jener unausgesetzte Rhythmus des dröhnenden Hammers, in den elf anderen steigert er sich zur fürchterlichsten Qual.
Meine schwarze Mannschaft hat sich genau so gegeben, wie Kenner dieser Rasse es mir vorausgesagt hatten. In Daressalam hatte jeder der Siebenundzwanzig sein Poscho auf vier Tage bekommen, d. h. die Mittel und zugleich auch den Auftrag, sich für diese Zeit mit Proviant zu versehen. Schon in Simba Uranga trat der Mnyampara, der Trägerführer, an mich mit dem Ansinnen heran, für ihn und seine dreiundzwanzig Untergebenen neue Vorräte zu kaufen; sie hätten bereits alles aufgegessen. Dieses Mal schützte mich der gänzliche Mangel an verkäuflichen Lebensmitteln in jenem Urwald vor einer abschlägigen Antwort; auch Moritz gegenüber, der „fein“, wie er nun einmal ist, durchaus Fisch haben wollte. Ihn habe ich kühl lächelnd die Treppe hinuntergeworfen. Aber so sind sie, diese Kinder des dunklen Weltteils; sie leben stets nur dem Augenblick und sorgen nicht für die Zukunft, ja nicht einmal für den nächsten Morgen. In Kilwa habe ich richtig noch ein paar Rupien springen lassen müssen, um diese trotz ihrer Seekrankheit nimmersatten Gesellen zur Ruhe zu bringen.
Kilwa — Kilwa Kiwindje genannt zum Unterschied von dem alten, weiter im Süden gelegenen Portugiesen-Emporium Kilwa Kisiwani — ist uns Älteren aus dem Araberaufstande von 1888 in traurigem Angedenken. Damals haben ein paar Angestellte der Deutschostafrikanischen[S. 39] Gesellschaft dort ihr tragisches Ende gefunden, lediglich weil unsere Flotte nicht eingriff. Dieser ist seither mancher schwere Vorwurf darüber gemacht worden. Heute, wo ich die topographischen Verhältnisse des Ortes durch eigenen Augenschein kenne, wird mir jener traurige Vorgang verständlich; die berüchtigten Tiefenverhältnisse der dortigen Küstenregion bringen es mit sich, daß europäische Dampfer draußen in fast unabsehbarer Ferne ankern müssen. Daß die Notzeichen der beiden Unglücklichen damals von unserm Kreuzer aus nicht gesehen worden sind, begreift man bei dem riesigen Abstande, in dem große Schiffe auf der Reede ankern müssen, vollkommen.
Unter normalen Umständen dauert die Fahrt mit dem „Rufidyi“ von Daressalam bis Lindi drei Tage; wir haben sie indessen in dieser wahrlich nicht kurz bemessenen Zeit nicht geschafft. Südlich von Kilwa hört der Schutz auf, den auf der nördlichen Fahrstrecke die große Insel Mafia und die zahllosen kleinen Koralleneilande vor dem Südwind bieten; infolgedessen faßt dieser das kleine Fahrzeug mit noch ganz anderer Kraft als die beiden Tage vorher. Ich bin jetzt der einzige Passagier, habe also genügend Platz, bin aber trotzdem womöglich noch elender als zuvor, denn auch das letzte Genußmittel, das mich vordem noch hatte reizen können, die Apfelsinen, sind gänzlich aufgezehrt. Schon kurz nach Mittag beginnen Kapitän und Steuermann besorgt ihre Karte zu studieren.
„Wann werden wir in Lindi sein?“ frage ich müde und matt aus meinem Liegestuhl heraus.
Eine ausweichende Antwort. Es wird allmählich Spätnachmittag; auf Steuerbord zeigt sich immerfort das gleiche Bild: eine weiße, krause Brandungslinie; dahinter der spezifisch grüne Wall der Mangroven. Kapitän und Steuermann sind noch immer über ihre Karte gebeugt; die Sonne steht nicht mehr weit vom Horizont.
„Ist jener Vorsprung dort etwa das Kap Banura?“ frage ich, in der Meinung, jetzt gleich in die unverkennbare Bucht von Lindi einfahren zu können.
[S. 40]
Wiederum eine ausweichende Antwort. Nunmehr wird es mir allmählich klar, daß auch die beiden Schiffslenker mit den Geheimnissen dieser Küstenstrecke noch nicht sehr vertraut sein können; wirklich ist der Kapitän ganz neu, der Steuermann aber fährt nur zum Ersatz für einen Beurlaubten mit. Wir sind, da die Sonne rasch zur Rüste ging, dann in die erste beste geräumige Bucht eingefahren, haben dort eine wundervoll ruhige Nacht verlebt und haben die letzten drei, vier Stunden bis Lindi am vierten Tage ohne weitern Zwischenfall zurückgelegt. Unser Zufluchtshafen war die Mtschingabai; sie war weder den beiden Seebären noch mir bekannt, wohl aber, wie sich nachher herausstellte, den beiden Maschinisten. Nur war es wie immer, wo Deutsche auf engem Raum zusammenleben müssen: beide Parteien lebten in grimmer Fehde, aus welchem Grunde die Herren des Heizraumes es nicht für nötig befunden hatten, die Kollegen von der Kommandobrücke über den Schiffsort aufzuklären.
Die Einfahrt in die Bucht von Lindi hat etwas Feierliches an sich. Hart biegt das Schiff um Kap Banura herum, da weitet sich vor uns plötzlich ein gewaltiges Becken, wohl 15 Kilometer lang und 5 bis 6 Kilometer breit; die umgebenden grünen Bergzüge sind nicht hoch, aber doch stattlich zu nennen und stürzen besonders aus dem Südufer steil zum Meer ab. Der „Rufidyi“ sieht aus wie ein schwarzes Pünktchen auf dieser weiten, silberglänzenden Fläche. Rasch nähert er sich dem Städtchen Lindi selbst. Es liegt unter dichten Kokos- und Kasuarinenhainen malerisch auf einer Landzunge, die gebildet wird durch die abschließende Rückseite der rechtwinkeligen Bucht und das linke Ufer eines scheinbar gewaltigen Stromlaufes, der sich über Lindi hinaus sichtlich noch tief ins Innere fortsetzt. Der Geograph weiß, daß dem nicht so ist, sondern daß diese wohl immer noch 800 bis 1200 Meter breite Wasserfläche das Ästuar des winzigen Lukuledi darstellt. Dieser würde ein solches Bett heute nimmer zu füllen vermögen; was wir als seine Mündung betrachten, ist vielmehr das tief unter das Niveau des Indischen Ozeans gesunkene, ganze Flußtal eines weit[S. 41] ältern Lukuledi. Geologisch sind alle unsere Häfen an dieser Küste gleichen Ursprungs; ob Daressalam, ob Kilwa Kisiwani, Lindi oder Mikindani, sie alle sind vollgelaufene Täler. Afrika mit seiner ungefügen Masse sieht auf der Landkarte langweilig aus, das gebe ich zu; rückt man aber dem Erdteil selbst auf den Leib, so ist er in allen seinen Teilen interessant. Schon an der Küste hebt es an.
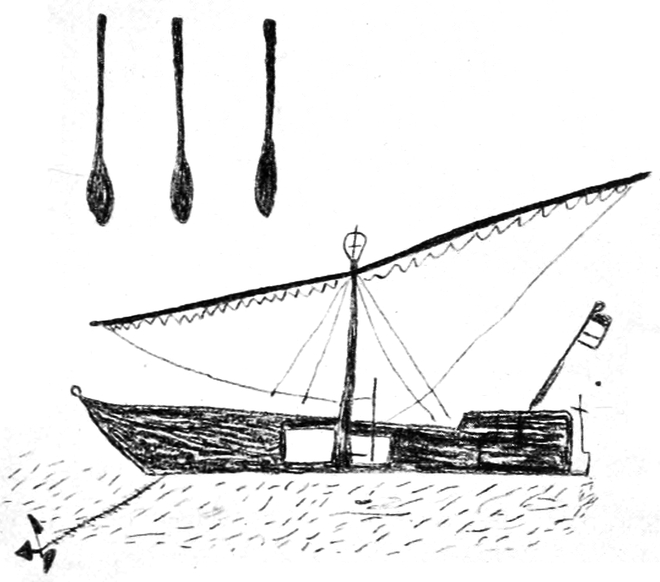
[S. 42]

Lindi, 9. Juli 1906.
Afrika ist das Land der Geduldübung. Mit diesem Übelstande haben sich alle Reisenden vor mir abfinden müssen; auch mir scheint er nicht erspart werden zu sollen. Erst beinahe drei Wochen tatenlos in Daressalam, jetzt schon wieder fast ebensolange in einem andern Küstennest; das ist etwas viel, zumal wenn man für seine Reise so wenig Gesamtzeit zur Verfügung hat und wenn gerade die schönste Periode des Jahres, der Anfang der Trockenzeit, unwiederbringlich dahinschwindet.
In Daressalam war der Grund für das lange Hinzögern des Aufbruchs die Seltenheit des Dampferverkehrs an der Küste; hier in Lindi ist es die Abwesenheit des kaiserlichen Bezirksamtmanns und die damit im Zusammenhang stehende Entblößung des Bezirksamts von verfügbaren Polizeitruppen. Ohne Soldaten soll ich nicht gehen; Soldaten sind aber erst dann zu haben, wenn Herr Ewerbeck zurück sein wird; folglich muß ich dessen Rückkehr wohl oder übel abwarten. Aber langweilig ist die Zeit mir weder in Daressalam, noch hier in Lindi geworden. Daressalam mit seinem Volksreichtum und seinen[S. 43] vielen Weißen würde auch schon dem bloßen Touristen genug des Neuen bieten, um wieviel mehr mir, der ich mich, sooft es nur meine Zeit zuließ, im engsten Verkehr mit den Eingeborenen für meine Forschungsaufgabe vorbereitet habe. Ich habe manchen Vor- und Nachmittag in den Hütten und auf den Höfen der Eingeborenen zugebracht und habe auch wunderhübsche Ngomenlieder auf der Phonographenwalze festgelegt, ganz abgesehen von den zahlreichen Liedern, die ich Solosängern verdanke, und den Spielproben, die Angehörige der verschiedensten Völkerstämme vor mir in meinem Moskitoparadies auf dem Deversschen Hof auf ihren Stammesmusikinstrumenten ablegten. An einem Tage hatte das Bezirksamt von Daressalam in entgegenkommendster Weise sogar ein Ngomenfest eigens für meine Aufnahmezwecke veranstaltet. Leider sind meine damaligen kinematographischen Aufnahmen alle verwackelt oder überexponiert, so daß mir lediglich der Trost einiger passabel gelungener photographischer Wiedergaben dieser originellen Tänze und die guten Phonogramme bleiben. Über diese Tänze und ihre Begleitung später mehr.
Hier in Lindi hat mein Aufenthalt nicht so harmlos und friedfertig begonnen, wie ich es erhofft hatte. Kaum einen Tag nach meiner Landung mußte ich schon Zeuge der Hinrichtung eines Aufständischen sein. Angenehm ist eine solche Exekution entschieden selbst für harte Gemüter nicht; wenn sich dann aber zu dem Verlesen des langen Urteils in Deutsch und Suaheli auch noch ein bemerkenswertes Ungeschick in den technischen Vorbereitungen geltend macht, wie das hier der Fall war, so wird die Prozedur sogar für den gleichgültigsten Schwarzen eine Qual. Zwar hatte man an dem starken horizontalen Ast des großen Baumes, an dem in Lindi die Hinrichtungen gewohnheitsmäßig vollzogen werden, zur Vorsicht gleich zwei Schlingen angebracht; aber als der Verurteilte schließlich oben auf der Plattform, von der er den unfreiwilligen Sprung ins Jenseits unternehmen sollte, vor ihnen stand, zeigte es sich, daß beide nicht einmal bis zur Höhe des Halses herunterreichten. Die stoische Ruhe, mit der der Delinquent[S. 44] dann das Heranschleppen einer Leiter und die Verlängerung eines der Stricke abwartete, war für den Negercharakter mit seiner geringen Einschätzung des eigenen Lebens jedenfalls außerordentlich bezeichnend.
Im Gegensatz zu anderen Küstenstädten hält Lindi auch in seinem Innern, was es bei seinem äußern Anblick verspricht. Freilich ist die lange, gewundene Gasse, in der die Inder ihre Läden und Werkstätten haben, ebenso häßlich, wenn auch hie und da nicht ohne malerischen Anstrich, wie die entsprechenden Stadtteile von Mombassa, Tanga und Daressalam, doch liegen die Eingeborenenhütten in den anderen Teilen des weitläufig angelegten Städtchens alle in frisches Grün eingebettet. Im Straßenleben walten gegenwärtig zwei Elemente vor: der Askari und der Kettengefangene; beide stehen in inniger Wechselbeziehung zum soeben beendeten Aufstand. Von der Schutztruppenkompagnie Nr. 3 liegt zwar der bei weitem größte Teil augenblicklich an strategischen Punkten im Innern, in Luagala auf dem Makondeplateau, und in Ruangwa, dem ehemaligen Gebiet des Häuptlings Seliman Mamba, weit hinten im Wamueralande; trotzdem aber bleibt für die Garnison noch genug Khaki übrig, ja, die ockerbraune Farbe unserer Soldatenbluse ist sogar eine ständige Erscheinung im Straßenbilde. Überall in der Umgebung der beiden Bomen, der alten Polizeiboma sowohl wie auch der neueren Schutztruppenkaserne, zeigen sich lange „Ketten“, vor und hinter denen je ein reisiger Krieger als Aufsichtsposten schreitet. Diese Ketten sind, wie der Name sagt, durch Eisenketten aneinander gefesselte Strafgefangene, die in dieser Weise ihre Schuld sühnen. Was ist bei uns daheim im Reichstag über die Barbarei dieser Art von Strafvollzug alles geredet worden, und wie oberflächlich ist die Mehrzahl der Redner sicher über die Psyche und das Rechtsgefühl des Negers unterrichtet gewesen! Immer und immer wieder haben berufene Federn, d. h. Männer, die auf Grund eines langen Aufenthalts im Lande auch das Volk und seinen Charakter kennen, darauf hingewiesen, daß für den Schwarzen ein bloßes Einsperren keine Strafe, sondern eher eine direkte[S. 45] Anerkennung seiner mehr oder minder großen Schandtat sein würde; aber wie wenig hat das genützt! Wir Deutsche müssen nun einmal schablonisieren und selbst so verschieden geartete Rassen wie Weiß und Schwarz über ein und denselben Kamm scheren. Freilich, eine Annehmlichkeit ist das Zusammengekettetsein mit rund einem Dutzend Leidensgenossen unter keinen Umständen, wenngleich die Kette seitlich des Halses durch einen weiten Ring läuft, so daß für den Einzelnen wenigstens eine geringe Bewegungsfreiheit besteht; welche Unzuträglichkeiten bringt allein die ungleiche körperliche Organisation in bezug auf die Befriedigung natürlicher Bedürfnisse mit sich! Doch zu ihrem Vergnügen werden die Leute ja auch nicht angekettet.

Besonders schwere oder gesellschaftlich hervorragende Übeltäter scheinen übrigens den Vorzug der Einzelhaft zu genießen. In den Gesprächen der wenigen Europäer, die augenblicklich in Lindi leben, kehrt am häufigsten der Name Seliman Mamba wieder; er hat im Aufstande des Südbezirks so lange die Führung innegehabt, bis man ihn schließlich erwischt hat, und nun harrt er im Lazarett von Lindi der Vollstreckung des jüngst über ihn gesprochenen Urteils. Da er eine ganze Reihe von Menschenleben, auch das von Europäern, auf dem Gewissen hat, so hat er sein Schicksal wohl verdient. Als historische Persönlichkeit, die in[S. 46] den Annalen unserer Kolonie zweifellos lange weiterleben wird, war Seliman Mamba wohl der Verewigung seiner Züge würdig, und darum habe ich ihn eines schönen Tags im Hofe des Lazaretts photographiert. Der Mann war sichtlich leidend und konnte die schwere Kette nur mit größter Anstrengung mit sich tragen. Seine unmittelbar bevorstehende Hinrichtung wird für ihn in jeder Beziehung eine Erlösung sein.
Weitaus erfreulicher als alle diese Einblicke in die Folgen des Aufstandes sind die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit meinen eigenen Leuten und den Suaheli gewesen. Meine Wanyamwesiträger scheinen das tatenlose Stillsitzen nicht vertragen zu können; vom zweiten Tage unseres Aufenthalts in Lindi an belagern sie mich von morgens früh bis abends spät mit der stummen oder auch lauten Bitte, ihnen Beschäftigung zu geben. Das habe ich auch mit vielem Vergnügen getan; die Leute haben zeichnen müssen, soviel sie nur wollten, und haben auch in meinen Phonographentrichter singen dürfen, sooft sich dazu die Gelegenheit bot. Schon jetzt zeigt sich, daß unsere etwas abenteuerliche und vom Meergott durchaus nicht freundlich behandelte Fahrt auf dem „Rufidyi“ wenigstens ein versöhnendes Ergebnis gezeitigt hat: bei meinen Leuten haben sich ihre Leiden und die daraus entsprungene Behandlung seitens der Schiffsmannschaft zu einem Liede verdichtet, das sie jetzt gern und oft, mit viel Ausdauer und auch mit durchaus ansprechender Vortragsart singen. Hier ist es:
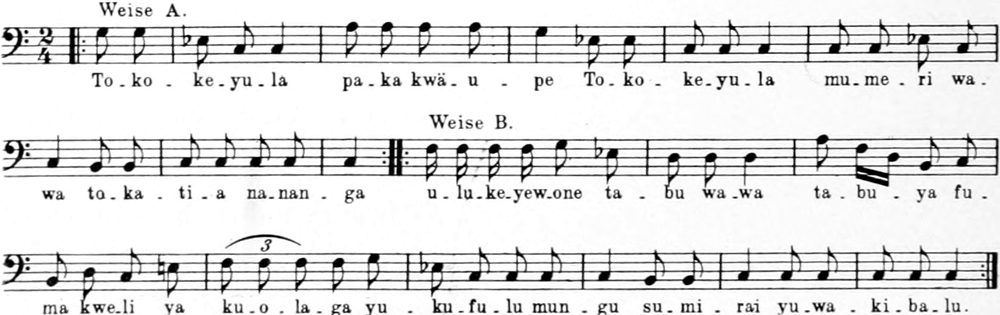
[S. 47]
Dem Inhalte nach heißt das etwa folgendermaßen:
„Wir sind Tag und Nacht, bis zum hellen Tage, an Bord gewesen und haben dann Anker geworfen. Die Baharia an Bord, die Matrosen, aber haben gesagt: Ihr Schensi aus dem Innern, ihr werdet euch tot speien. Aber wir sind doch heil nach Lindi gekommen und haben (zu den Baharia) gesagt: Ihr habt Gott verspottet (indem ihr sagtet, wir würden sterben), aber wir sind doch gesund angekommen.“
Diese Sangeslust ist für die Wanyamwesi charakteristisch. Im Laufe meines unfreiwilligen Aufenthaltes habe ich schon manchen Photographierbummel unternommen, bei denen mich meine Leute gar zu gerne begleiten. Dann muß ich die wenigen Gerätschaften, die zu solchem Vorhaben nötig sind, immer auf möglichst viele meiner Braven verteilen, damit nur ja auch jeder etwas zu tragen hat. Es dauert dann niemals sehr lange, bis Pesa mbili, der Mnyampara oder Trägerführer, mit seiner wohlklingenden Stimme zu singen anhebt, worauf dann prompt und in bewunderungswürdigem Takt der Chor einfällt. Auch von diesen kleinen Marschliedern hier eine Probe:
Dem Inhalt dieses Liedes nach zu urteilen, müssen die Wanyamwesi gut deutsch gesinnt sein, denn sie ziehen der Reihe nach gegen alle aufständischen Völker des Südens zu Felde und zerschmettern sie.[S. 48] Die Namuki sind identisch mit den Majimaji, den Aufständischen von 1905/06. Das Vortragstempo ist ein rasendes Parlando, das eine Wiedergabe in Notenschrift unmöglich macht. Der Ausruf „ki“ bezeichnet nach der übereinstimmenden Schilderung Pesa mbilis und der Intelligenteren unter seinen Freunden den Ausdruck der Kraft, mit dem die Rugaruga, die Hilfskrieger, dem verwundeten Feinde den Schädel zerschmettern, und sei es selbst mit dem Stoß oder Schlag der eigenen Ferse. Mit Wucht stampfen die Sänger bei jedem „ki“ den Boden, daß er erzittert; fast glaubt man bei diesem „ki“ das Krachen der Schädel zu hören, so völlig vermögen sich selbst diese friedlichen Söhne des Nordens von Deutsch-Ostafrika in die Greuel des verflossenen Aufstandes hineinzuversetzen. Dieses Trutzlied ist nämlich sicher nicht eigene Komposition meiner Leute; es ist von andern Stammesgenossen übernommen worden, die im letzten Feldzuge Kriegsdienste als Rugaruga geleistet haben und sich nun beschäftigungslos in Lindi herumtreiben. Einige von ihnen habe ich für den Marsch nach Massassi noch als Träger mieten müssen; sie sind in ihrem ganzen Auftreten viel bestimmter, trotziger als meine sanften, großen Kinder von Daressalam, so daß ich froh sein werde, sie nach Erreichung des Zieles wieder loszuwerden. Von ihnen, denke ich, wird das Lied stammen.

Da ich nun einmal bei der Musik bin, will ich auch noch ein übriges tun und ein dem Inhalte nach dem vorigen eng verwandtes Marschlied der Sudanesensoldaten bringen, welches mir der Sol (Feldwebel) Achmed bar Schemba und ein paar Sektionen aus der dritten Schutztruppenkompagnie auf Befehl ihres Kompagnieführers, des trefflichen alten „Afrikaners“ Seyfried, in den Phonographentrichter sangen. Wie aus Erz gegossen, stand der kleine Sol vor der aufnahmebereiten Maschine; die braunen, hageren Krieger aber aus Dar For und den Nebenländern traten hinter ihm an wie auf dem Exerzierplatz: zweigliedrig, genau auf Vordermann. Es war nicht leicht, sie in die zweckentsprechende Keilform umzustellen. Das Lied lautet:
[S. 49]

Nach Aussage der Sänger, die vorwiegend Nubier sind, ist das Lied im Dialekt von Dar For abgefaßt, ihrer Muttersprache. Eine wörtliche Übersetzung ist für mich noch nicht zu erlangen gewesen. Dem Inhalt nach bedeutet der mit beneidenswerter Lungenkraft und bewunderungswürdiger Ausdauer gesungene Text etwa folgendes:
[S. 50]
„Wir sind allezeit stark. Der Jumbe ist aufgehängt worden, auf Befehl Gottes. Der Hongo, der Rädelsführer im Aufstand, ist gestorben; auf Befehl Gottes.“
So viel über die Ergebnisse meiner musikalischen Forschung, soweit sie den hier landfremden Elementen der Wanyamwesi und der Nubier angehören. Ob die Ngomenlieder, die ich in Lindi bisher von den Angehörigen einiger Binnenlandstämme, vor allen der Yao, auf der Walze niedergelegt habe, gelungen sein werden, kann ich noch nicht sagen, da, wie ich zu meinem Entsetzen merke, meine Aufnahmewalzen unter der Wirkung der feuchten Wärme anfangen weich zu werden, so daß ich zwar Aufnahmen machen, aber keine Wiedergaben riskieren kann, ohne die ganze Aufnahmeschicht zu gefährden. Schöne Aussichten für die Zukunft!
Psychologisch hochinteressant ist das Verhalten der Naturkinder meinen verschiedenen Apparaten gegenüber. Die photographische Kamera ist, wenigstens an der Küste, nichts Neues und Ungewohntes mehr; mit ihr hat man demgemäß auch weniger Schwierigkeiten, auch zeigen sich die Eingeborenen über die Ergebnisse des Verfahrens nicht merklich erstaunt. Als Übelstand kommt höchstens in Betracht, daß die Angehörigen des weiblichen Geschlechts sich der Aufnahme meist durch schleunigste Flucht zu entziehen wissen. Dem war schon in Daressalam so. Ganz ohne Verständnis hingegen steht das Volk dem Kinematographen gegenüber; er ist eine „Enchini“, eine Maschine, wie so vieles andere auch, was der „Msungu“, der Weiße, mit ins Land bringt; und wenn nun der Weiße eine zierliche Kurbel an dem kleinen schwarzen Kasten dreht und in dumpfem Rhythmus dabei zählt: 21, 22, 21, 22, so heimelt den Schwarzen wohl dieser Rhythmus an, da seine Arbeitslieder im allgemeinen von derselben stumpfsinnigen Einförmigkeit sind, aber was bei dem ganzen Vorgang herauskommen soll, versteht er nicht im mindesten; auch ist es ihm vollkommen gleichgültig.

Aber der Phonograph, der ist eine Enchini ganz nach dem Herzen des schwarzen Mannes und auch der schwarzen Frau. Es wird für[S. 51] mich immerdar, und sollte ich steinalt werden, eine der nettesten Erinnerungen meines Afrikaaufenthaltes bleiben, wie auf dem Deversschen Hof in Daressalam sich ein paar Angehörige des zarten Geschlechts mit dem Apparat abgefunden haben. Nachdem auf dem hinten im Eingeborenenviertel gelegenen Festplatz die Ngomen der verschiedenen Völkerschaften, hier der Manyema, dort der Wasaramo, drüben irgendeines Küstenklubs, sich in ihren zum Teil scheußlichen, aber durchweg malerischen Kostümen genugsam produziert hatten, war ich an der Spitze eines nach Hunderten zählenden Teils der Tänzer und Tänzerinnen vor mein Zimmer gezogen, um hier auch den gesanglichen Teil festzulegen. Alles war nach Wunsch gegangen;[S. 52] jedesmal aber, wenn ich die Membranen gewechselt und statt des Aufnehmers den Wiedergeber eingeschaltet hatte, und wenn dann der vielgliedrige Gesang in genau demselben Rhythmus und in genau derselben Klangfarbe, mit der er in den geheimnisvollen Trichter hineingesungen worden war, wieder aus ihm hervorquoll — welch grenzenloses und dabei doch freudiges Erstaunen malte sich dann auf den von der Anstrengung des Singens und Tanzens so schweißglänzenden Gesichtern! Ganz unfehlbar fiel in jedem Einzelfall der Chor naiver Seelen ein, um allerdings von den „gebildeteren“ Elementen sehr bald durch spöttisches Gelächter eines Besseren belehrt zu werden.
Doch den schönsten Ausdruck unbefangenen Naturempfindens gaben am Schluß der Aufnahme, nachdem ich mit dem geringen Vorrat von Suaheli-Redensarten, über den ich damals verfügte, meiner Befriedigung über den Verlauf des Nachmittags Ausdruck verliehen hatte, zwei weibliche Wesen wieder, die mir vordem nicht nur durch die Eleganz ihrer Gewandung, sondern mehr noch durch die ungeheure Kraft ihrer Stimmen aufgefallen waren, mit der gerade sie beide in den unmittelbar vor ihnen aufgebauten Trichter hineingesungen hatten. Der dichte Schwarm wich zurück, so daß der Trichter einen Augenblick freistand; in den freien Raum aber trat zuerst die eine der Schönen, machte vor dem Apparat einen tadellosen Hofknix und sprach: „Kwa heri, sauti yangu, lebe wohl, meine Stimme!“ Damit trat sie zurück; die andere schritt herzu, und auch sie wiederholte unter tiefer Verbeugung und mit bezeichnender Handbewegung dieselben Worte. Psychologisch ist der Vorgang deswegen so bemerkenswert, weil er offenkundig zeigt, wie dem Neger das Sinnfälligste auch das Nächstliegende ist; indem beide Frauen ihr Abschiedswort sprechen, hören sie ja noch selbst, daß sie ihre Stimme nicht im mindesten verloren haben; trotzdem gilt sie ihnen, weil sie sie vorher klar und unverkennbar aus dem Trichter haben heraussingen hören, in diesem Augenblick als eingebüßt, und sie nehmen förmlich Abschied von ihr.
[S. 53]

Über die Ergebnisse meiner auf die Kunstübung der Schwarzen gerichteten Studien will ich lieber später im Zusammenhang berichten, wenn ich auf Grund eines ungleich größern Materials einen breitern psychologischen Einblick in die Künstlerseele des Negers gewonnen haben werde. So viel kann ich indessen jetzt schon sagen, daß auch hier aller Anfang schwer ist, schwer nicht nur für die ausübenden Künstler, sondern mehr noch vielleicht für den Forscher. In Daressalam war die Sache einfacher; mein Boy Kibwana, zu deutsch: der kleine Herr, das Herrchen, ein Jüngling vom Stamme der Wassegedju aus Pangani, der ebensowenig wie der Koch Omari, ein Bondeimann aus dem Norden der Kolonie, jemals einen Bleistift oder ein Stück Papier in der Hand gehabt hatte, war schon zu oft im Dienst von Europäern gewesen, als daß er meinem Auftrage, mir einmal etwas zu zeichnen, z. B. die Kokospalme vor meinem Fenster oder meinen Radiergummi, irgendwelchen Widerstand entgegenzusetzen gewagt hätte; er malte eben drauflos ohne Rücksicht auf den Kunstwert des zu erwartenden Ergebnisses.
[S. 54]
Bei meinen Wanyamwesi, mit denen ich, schon um sie zu beschäftigen, in Lindi den Anfang gemacht habe, frommt ein einfacher Befehl nicht viel. Drücke ich einem meiner Getreuen Skizzenbuch und Bleistift in die Hände mit der Aufforderung, etwas zu zeichnen, so ertönt unweigerlich und unter einem verlegenen Lächeln ein verschämtes „Si jui, Bwana, ich kann doch nicht, Herr“. Dann heißt es, den Mann nach seiner Individualität behandeln; man kommt ihm energisch oder auch mit sanfter Bitte; in jedem Fall aber habe ich gefunden, daß es am meisten fruchtet, wenn man die Jünglinge bei ihrem Ehrgeiz faßt: „Ach was, du bist doch ein kluger Kerl, ein mwenyi akili; sieh doch mal her, dein Freund Yuma da drüben, der doch lange nicht so klug ist wie du, was kann der schön zeichnen; hier setz’ dich mal hin und male einmal gleich den Yuma selbst ab.“ Einer derartigen schmeichelhaften Hervorhebung ihrer Verstandeskräfte haben bisher unter meinen Leuten nur ganz wenige widerstanden, die, allen aufmunternden Worten zum Trotz, auch fernerhin dabei blieben, sie könnten’s nun einmal nicht. Den anderen ist es ergangen wie dem Löwen, der Blut geleckt hat: sie sind unersättlich, und wenn ich zwei Dutzend Skizzenbücher mitgebracht hätte, sie würden dauernd alle besetzt sein. Pädagogisch richtiger als das von mir zuerst eingeschlagene Verfahren, dem Neuling die Auswahl des ersten Objekts selbst zu überlassen, ist übrigens das andere, nach dem man den Leuten zunächst einen ihnen ganz vertrauten Gegenstand, eine Wanyamwesihütte, oder ein Huhn, eine Schlange oder etwas Ähnliches zu zeichnen empfiehlt. Dann zeigt sich, daß sie mit einigem Zutrauen zu sich selbst an die Arbeit gehen und daß sie auf ihre Meisterwerke unbändig stolz sind, wenn ihr Herr auch nur das geringste Wort des Lobes äußert. Selbstverständlich würde ich niemals auch nur den Schatten eines Tadels auf die Zeichnungen fallen lassen; es ist ja nicht der Endzweck meiner Forschung, zu kritisieren und zu verbessern, sondern lediglich das künstlerische Vermögen der Rasse zu studieren und die[S. 55] psychologischen Vorgänge beim Werden des Kunstwerks zu ergründen.
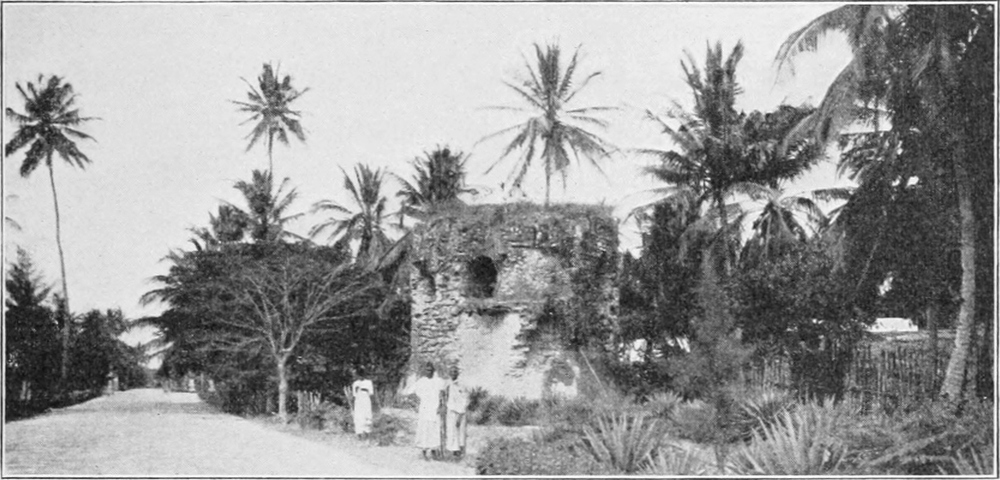
Das letztere erstrebe ich in der Weise, daß jeder meiner Künstler, sobald er sich für ein Bakschischi, ein Künstlerhonorar, reif hält, gehalten ist, mir seine Werke vorzuzeigen. Dann erhebt sich stets ein meist recht langdauerndes, aber für beide Teile doch recht kurzweiliges Schauri. „Was ist das?“ frage ich, indem ich mit der Spitze meines Bleistiftes auf eine der krausen Figuren deute. „Mamba“, ein Krokodil, ertönt es zurück, entweder mit einem leisen Unterton der Entrüstung oder des Erstaunens über den Europäer, der nicht einmal ein Krokodil kennt, oder aber in dem bekannten Ton der leisen Beschämung, daß das Werk so schlecht ausgefallen sei, daß nicht einmal der allwissende Msungu seine Bedeutung zu erkennen vermag. „So, also ein Mamba; schön“, heißt es, und der Stift schreibt das Wort neben die Zeichnung. „Ja,“ fällt nun aber ganz regelmäßig der Künstler ein, „aber es ist ein Mamba von Unyamwesi“, oder aber „von Usagara“, oder „vom Gerengere“, oder welcher geographische Begriff hastig hinzugefügt wird. Unwillkürlich stutzt man und fragt: „Warum? Wieso?“ Und nun kommt eine lange Erzählung: Das sei ein[S. 56] Krokodil, welches er und seine Freunde — folgen deren Namen — damals gesehen hätten, als sie mit dem und dem Europäer auf der Reise von Tabora nach der Küste gewesen seien, und welches beim Übergang über den und den Sumpf oder über den Gerengerefluß ihn auf ein Haar getötet hätte. Bei der Niederschrift der ersten Kommentare achtete ich noch nicht sonderlich auf das stete Anknüpfen an ein bestimmtes Ereignis; jetzt aber, wo ich doch immerhin schon eine Menge Blätter mit Zeichnungen von Einzelobjekten, seien es Tiere, Pflanzen oder Erzeugnisse menschlicher Kulturbetätigungen, und mit ganzen Szenen aus dem Leben Innerafrikas besitze, ist es mir klar geworden, daß der schwarze Künstler überhaupt nicht imstande ist, ein Objekt an sich, sozusagen als Abstraktum, und losgelöst von der Naturumgebung, und zwar einer ganz bestimmten Umgebung, zu zeichnen. Wenn er den Auftrag bekommt, eine Wanyamwesifrau zu zeichnen, so zeichnet er unbedingt seine eigene Frau, oder wenn er keine hat, eine ihm persönlich nahestehende, bekannte; und wenn er eine Wanyamwesihütte zeichnen soll, so verfährt er genau so: er zeichnet seine eigene Hütte oder die seines Nachbars. Ebenso verhält es sich auch mit den Genrebildern. Das sind keine Genrebilder in unserem Sinn, sondern es ist sozusagen Geschichtsmalerei. Ich besitze bereits eine Reihe von Szenen, in denen ein Löwe sich auf ein Rind stürzt, oder eine Hyäne den Menschen angreift, oder wo sonst ein Auftritt aus dem Kampf der höheren Organismen ums Dasein wiedergegeben wird. Stets heißt es dabei: „Hier, das ist ein Löwe, und das ist ein Rind, aber das Rind gehörte meinem Onkel, und es sind ungefähr vier Jahre her, da kam eines Nachts der Löwe und holte es weg. Und das hier, das ist eine Hyäne, und der hier, das ist mein Freund X., der auf dem Marsch von Tabora nach Muansa krank wurde und liegenblieb; und da kam die Hyäne und wollte ihn beißen, aber wir haben sie weggejagt und haben den Freund gerettet.“
Dies sind nur ein paar Stichproben aus der Art meiner Forschungsmethode und aus ihren Ergebnissen. Ich habe die[S. 57] Überzeugung, auf dem richtigen Wege zu sein. Freilich werde ich manchen Fehlschlag erleben und vieles hinzulernen müssen, aber das ist ja eine allgemein menschliche Erfahrung, mit der man sich zudem um so leichter abfinden wird, je tatkräftiger man sich in seine Aufgabe hineinstürzt.

Mein Kraftmesser, der schon auf dem Dampfer im Roten Meer so gute Dienste zur Herstellung freundschaftlicher internationaler Beziehungen getan hat, bewährt auch hier wieder seine Zauberkraft. Weiß ich mit meinen Leuten und ihren Freunden, die sie sich inzwischen in Lindi erworben haben, gar nichts mehr anzufangen, so drücke ich dem wackern Pesa mbili, der natürlich in allem den Vorrang haben muß, das Stahloval in die Hand. Dann drückt er, und mit ihm schaut die ganze dichtgedrängte Schar der schwarzen Kameraden gespannt aufs Zifferblatt nach der Kraftleistung, gleich als verständen sie die geheimnisvollen Zeichen zu deuten, die dort auf dem Messingbogen eingraviert sind. Verkündige ich dann nach einem Blick meinerseits auf die Skala das Ergebnis, selbstverständlich mit der bloßen Zahl und unter Weglassung der Kilogramme, bei denen sich die Naturkinder doch nichts denken könnten, so wird dieses erste Ergebnis mit einem gewissen, aber wohl erklärlichen Gefühl der Unsicherheit entgegengenommen. Man weiß ja noch gar nicht: ist[S. 58] das viel, oder ist das wenig, da noch der Maßstab des Vergleichs fehlt. Erst beim Zweiten werden subjektive Empfindungen ausgelöst; hat er statt der 35 Kilogramm seines Vorgängers deren nur 30 gedrückt, so ergießt sich über ihn schon ein Gelächter milden Spottes; übertrifft er aber den Rivalen, so ist er ein Mwenyi mguvu, ein Starker, dem man Bewunderung zollt, die er mit lächelnder Würde entgegennimmt.
So geht das Spiel reihum; man kann es stundenlang mit den Leuten betreiben, ohne daß sie müde würden. Nur eins fehlt den Intelligenteren unter ihnen; zwar interessiert es sie zu wissen, wer unter ihnen selbst der Stärkste oder Schwächste ist, aber um eine höhere und die eigentliche Vergleichsmöglichkeit mit sich selbst zu gewinnen, möchten sie doch gar zu gerne erfahren, was ihr Herr und Gebieter zu leisten vermag. Selbstverständlich tue ich ihnen zum Schluß den Gefallen und drücke rechts und drücke links. Wenn dann von meinen Lippen das Ergebnis ertönt, an dem ich zu meiner Genugtuung nicht einmal etwas zu mogeln brauche, so erschallt einhellig aus aller Munde ein lautes, bewunderndes „Aah — Bwana kubwa!“, wörtlich: „Aah — du großer Herr“, dem Sinne nach etwa: „Was bist du für ein großer Riese!“
Tatsächlich nehmen wir Europäer, was die Fähigkeit spontaner Kraftentfaltung anlangt, neben dem Neger den Rang von Riesen ein. Ich habe mir die Einzelzahlen der Leute ziemlich genau gemerkt, auch für ihre wiederholten Druckübungen, so daß das Moment der Ungewohntheit und der Ungeübtheit auch bei ihnen ausscheidet; aber wie fallen sie gegen uns ab! Über 35 Kilo rechts und 26 Kilo links ist mit Ausnahme eines einzigen, der 40 und mehr Kilo drückte, niemand hinausgekommen, während ich auch hier in der feuchtwarmen Küstentemperatur nach wie vor 60 und mehr Kilo rechts und 50 und mehr Kilo links erziele. Und dabei sind meine Leute fast alle stramme Berufsträger mit mächtigem Thorax, breiten Schultern und prächtiger Oberarmmuskulatur. Ihnen fehlt eben, worauf ja schon sooft hingewiesen[S. 59] ist, die Fähigkeit, ihre Körperkraft zeitlich zu konzentrieren, während gerade die Wanyamwesi durch ihre fabelhafte Ausdauer förmlich berühmt geworden sind.
Somit bieten die Schwarzen unstreitig ein Gesamtbild dar, dem man gewisse psychologische Reize nicht absprechen kann; aber fast noch interessanter als sie sind mir während meines nunmehr bald anderthalbmonatigen Aufenthalts an der Küste die Weißen erschienen. Daressalam ist groß genug und beherbergt so viele Angehörige unserer Rasse, daß sich dort die Rassengegensätze zwischen Schwarz und Weiß der Beobachtung durch den Neuling leicht entziehen; die Gegensätze aber unter der weißen Bevölkerung selbst gleichen sich auf dem weitgedehnten Raum der großen Siedelung wenigstens bis zu einem bestimmten Grade aus. Das ungleich kleinere Lindi bietet zu keiner der beiden Möglichkeiten den Raum; in der Enge seines Milieus und der Einförmigkeit seines Lebens prallen hier die persönlichen Gegensätze unvermindert und unabgeschwächt aufeinander, und in erschreckender Klarheit kann man gerade in einem solchen Nest die ungeheuer rasche und starke Einwirkung des Tropenaufenthaltes auf das seelische Gleichgewichtsvermögen einer landfremden Rasse studieren. Es ist nicht meines Amtes, auf die zum mindesten kuriosen Auswüchse unseres deutschen Klassen- und Kastengeistes hinzuweisen; wie er selbst hier unter dem halben oder ganzen Dutzend Europäern seine wenig genießbaren Früchte zeitigt; wie das durch die soeben erfolgte Einführung der Zivilverwaltung „entthronte“ Militär über diese Zivilverwaltung lächelt; und wie durch Hinüberspielen des Sachlichen auf das Persönliche schließlich jedes Zusammenleben und, was schlimmer ist, auch jedes Zusammenarbeiten unterbunden werden kann. Dem Neuankömmling, der seine Verwunderung über solche Verhältnisse äußert, sagt man mit einer Gelassenheit, die mit der sonstigen dauernden Gereiztheit merkwürdig kontrastiert: „Ach, was wollen Sie denn; das ist doch nicht bloß hier so; das finden Sie überall.“ So scheint es in der Tat zu sein, nach allem zu urteilen, was ich in diesen[S. 60] lehrreichen Wochen vernommen habe. Ich hoffe indes, daß auch diese unliebsame Erscheinung nur eine von den vielen Kinderkrankheiten ist, die schließlich jedes Kolonialvolk einmal durchzumachen hat.
Völlig verständnislos aber stehe ich dem furchtbaren Jähzorn gegenüber, mit dem jeder auf einen längern Aufenthalt im Lande zurückblickende Weiße behaftet erscheint. Ich versuche einstweilen, ohne Schimpfwörter und ohne Ohrfeigen meinen Weg zu gehen, aber man sagt mir einhellig, ich würde im Laufe der nächsten Monate schon eines Besseren belehrt werden. Jetzt kann ich in der Tat noch nicht beurteilen, ob es wirklich nicht ohne Prügel geht: aber ich hoffe es doch.
Bewunderungswürdig ist bei den tiefen Schatten, die das Bild des Europäerlebens hierzulande verdunkeln, die Virtuosität, mit der sich die Herren wirtschaftlich zu behelfen wissen. Schon in dem Kulturzentrum Daressalam denke ich mir das Ehrenamt eines Messevorstandes nicht ganz leicht, trotzdem es dort Bäcker, Schlächter und Läden aller Art in Hülle und Fülle gibt; aber wie muß in dem entlegenen Küstennest der unglückliche Junggeselle sein Hirn zermartern, um den hungrigen Magen seiner Tischgenossen nicht nur stets etwas Neues, sondern überhaupt etwas bieten zu können! Der deutschen Hausfrau, die bloß über die Straße zu schicken oder gar nur ans Telephon zu treten braucht, mag es, wenn das Schicksal sie an der Seite des Gatten in einen solchen Winkel Afrikas verschlagen hat, zunächst seltsam vorkommen, wenn sie auf sichere Lieferung von Fleisch und Gemüse, von Kartoffeln und Brot überhaupt nicht rechnen kann, sondern sehr bald merkt, wie weitschauend für alle die tausend Kleinigkeiten, die von unserm Wirtschaftsbetrieb unzertrennlich sind, vorgesorgt werden muß. Konserven allein tun es nicht, das verbietet schon der Preis; da heißt es denn auf Tage, ja unter Umständen auf Wochen und Monate im voraus disponieren, und außerdem noch aus den wilden Kräutern, die der schwarze Koch und sein Küchenboy ins Haus schleppen, genießbare Gerichte herstellen. An der Küste sichert der Reichtum der Gewässer an eßbaren Fischen[S. 61] noch immer einige Abwechselung; im Innern fällt auch das weg. Und wenn es dann vorkommt, wie gerade jetzt, daß selbst der Standard- und Charaktervogel Afrikas, das Huhn, und sein Produkt, das Ei, versagen, dann steht es schlimm, und die Fürsorge für eine größere Menschenzahl wird zu einem Problem.
Doch es ist merkwürdig, selbst die hartgesottensten Junggesellen unter den deutschen Herren wissen dieses Problem zu lösen, nicht immer elegant und sicherlich auch nicht immer zur vollkommenen Zufriedenheit kritisch veranlagter Vorgänger im Amte, aber doch so, daß zum mindesten der Neuling des Staunens und der Bewunderung voll ist. Eine Berühmtheit in der ganzen Kolonie ist auf kulinarischem Gebiet seit langem Dr. Franz Stuhlmann, der Begleiter Emin Paschas auf dessen letzter, verhängnisvoller Reise, ein tüchtiger Ethnograph und seit langem der Hüter und Pfleger der afrikanischen Pflanzenwelt, soweit sie in den Dienst des Menschen gestellt werden kann. Stuhlmann steht im Ruf, aus jedem Unkraut am Negerpfad ein wohlschmeckendes Gericht herstellen zu können; er gilt als lebendiges Kochlexikon für die Tropen. Andere haben es noch nicht soweit gebracht, doch erscheint mir noch immer erstaunlich, was z. B. der Hauptmann Seyfried aus den elementarsten Ingredienzien zu schaffen vermag, wie er salzt und pökelt, wie er selbst bei der jetzigen Wärme vollwertige Gelees herzurichten weiß, und wie vielgestaltig stets seine Tafel gedeckt ist.
Mit einem Irrtum der Heimat möchte ich gleich hier endgültig aufräumen. „Herrgott, bei der Hitze kann man doch sicherlich nichts essen“, das ist ein Ausspruch, der uns in Deutschland in Gesprächen über die Tropen auf Schritt und Tritt an die Ohren schlägt. Und doch, wie ganz anders liegen die Verhältnisse in Wirklichkeit! Zunächst einmal ist die Hitze durchaus nicht so unmenschlich groß, wie man das bei uns so annimmt, wenigstens nicht während der Trockenzeit, wo an der Küste bei Tage stets eine frische Seebrise weht; sodann aber ist der Stoffwechsel in den Tropen ungleich reger[S. 62] als bei uns. So wundert es nicht einmal den Neuling, wenn er sieht, daß die alten „Afrikaner“ schon in aller Frühe ein sehr umfangreiches erstes Frühstück zu sich nehmen, bei dem Fleisch verschiedener Zubereitung, aber auch Früchte keine geringe Rolle spielen. Mittags tut es auch der kleine Beamte dort nicht unter zwei Gängen und Nachtisch, und abends nach dem Dienst folgt dann bei allen Ständen und Berufen eine Mahlzeit, die wir bei uns zulande hier dreist als Festdiner bezeichnen würden. Diese ganze, anscheinend so üppige Lebensweise verdient aber alles andere als Tadel und Mißbilligung; sie ist im Gegenteil physiologisch durchaus berechtigt und notwendig, soll der Körper den nachteiligen Einwirkungen des Klimas auf die Dauer widerstehen. Den Neuankömmling wundert dieser Appetit deswegen nicht, weil er ihn unbewußt teilt. Ich schlage in dieser Beziehung schon in Europa eine ganz gute Klinge, aber was ich hier leiste, würde mich sicherlich zum Schrecken mancher deutschen Hausfrau stempeln.
Nur mit dem Alkohol will es nicht recht. So gern und mit soviel Verständnis ich daheim mein Glas Bier oder mein Glas Wein zu würdigen weiß, und so eifrig wir Reisenden auch noch an Bord den Vorräten des „Prinzregent“ an Münchener und Pilsener zugesetzt haben, seitdem ich an Land bin, habe ich Bier überhaupt nicht mehr, Wein aber nur in ganz geringen Quantitäten getrunken; an das Nationalgetränk der weißen Deutsch-Ostafrikaner aber, Whisky und Soda, habe ich mich noch nicht gewöhnen können. Für Lindi ist diese Enthaltsamkeit verständlich, denn hier gibt’s kein Eis; doch auch in Daressalam, wo die Bierbrauerei von Schultz die ganze Stadt täglich mit Eis versorgt, habe ich den alkoholischen Getränken keinen Geschmack abgewinnen können. Für meine Reise ins Innere gereicht mir dies sehr zum Vorteil, denn ich bin unter diesen Umständen der Mitnahme irgendwelcher Flaschenbatterien überhoben.
Erfreulicherweise nähert sich mein unfreiwilliger Küstenaufenthalt jetzt seinem Ende. Vor wenigen Tagen ist Herr Bezirksamtmann Ewerbeck aus dem Innern zurückgekehrt; er ist liebenswürdigerweise bereit,[S. 63] mit mir schon übermorgen wieder aufzubrechen, um mich mit einem Teil der Polizeikompagnie durch das Aufstandsgebiet der Wamuera bis Massassi zu geleiten. Im mittlern Lukuledital gibt es für ihn noch mancherlei zu tun; die meisten Rädelsführer aus dem Aufstande sind zwar bereits längst gefangen und zieren als „Kette“ die Straßen von Lindi; nach anderen wieder wird noch immer gefahndet. Das wird noch manches Schauri kosten. Von Massassi muß Herr Ewerbeck sofort wieder nach Lindi zurück, um hier die Reichtagsabgeordneten feierlich zu empfangen, die im August auf ihrer vielbesprochenen Studienreise nach Ostafrika auch den Süden der Kolonie auf kurze Zeit besuchen wollen. Möge die koloniale Idee im deutschen Volk durch diesen Besuch der acht Männer immer festeren Fuß fassen, dann soll es an einer Zukunft dieses Landes nicht fehlen!
Mein erster Blick in das Innere war übrigens keineswegs freundlich. Im Laufe des Reitkursus, den Herr Hauptmann Seyfried mir seit einiger Zeit erteilt, sind wir eines Abends auch auf den Kitulo geritten. Es ist ein langgestreckter, ziemlich steiler Höhenzug von 175 Meter Seehöhe, der sich unmittelbar hinter Lindi erhebt und die schmale Sandebene, auf der die Stadt liegt, vom Innern des Landes trennt. Als Wahrzeichen unserer Kultur trägt dieser Kitulo bereits seit Jahren einen Aussichtsturm. Als ich diesen auf einer allerdings etwas gebrechlichen Leiter erstieg, war die Sonne bereits untergegangen, und der ganze Westen, also gerade der Teil des dunklen Kontinents, in den ich in den nächsten Tagen eindringen will, breitete sich als eine dunkle, drohende Masse vor mir aus. Einen Augenblick nur wollte es unheilverkündend in mir aufsteigen, doch rasch besann ich mich auf mein altes Glück, das mich noch niemals verlassen hat. „Ach was, ich zwinge dich doch“, sagte ich halblaut, steckte mir mit philosophischer Ruhe eine neue Zigarre an und erkletterte zum Heimritt den Rücken des mir von der Schutztruppe in liberalster Weise auch für die Expedition zur Verfügung gestellten Maultiers.
[S. 64]
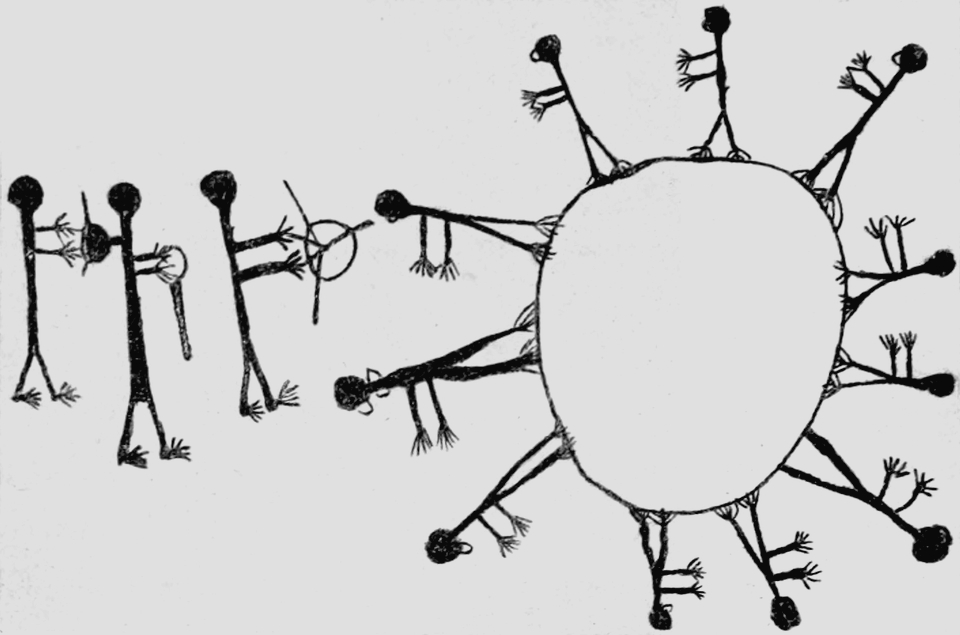
Massassi, 20. Juli 1906.
Herrn Geheimrat Kirchhoff, Mockau bei Leipzig.
Ihnen, Herr Geheimrat, traue ich zu, zu wissen, wo mein gegenwärtiger Aufenthaltsort auf der Karte zu finden ist, vielen andern im Lande der Dichter und Denker allerdings nicht, denn mit den topographischen Kenntnissen ist es bei uns, das wissen Sie als alter Hochschullehrer noch viel besser denn ich als junger, selbst bei der akademischen Jugend gar schlimm bestellt. Und doch könnte mancher Kolonialinteressent sehr wohl selbst über die Lage eines Ortes wie Massassi unterrichtet sein, denn in seiner Art ist es ein kleines Kulturzentrum. Seit fast einem Dritteljahrhundert wirkt hier die englische Mission, und seit der Niederschlagung des Aufstandes behauptet auch ein schwarzer Gefreiter mit einem Dutzend schwarzer [S. 65] deutscher Soldaten in einer eigens dazu angelegten Boma tapfer das Feld gegen etwaige neue Kriegsgelüste unserer schwarzen Brüder.

Ich habe es vorgezogen, mich bei den Soldaten einzuquartieren; nicht etwa aus unkirchlichem Sinn und aus unfrommem Geiste heraus, sondern weil die beiden Reverends auf der etwa eine Stunde von uns entfernt gelegenen Missionsstation schon bejahrt und der Schonung bedürftig sind. Zudem hat man ihnen die Station während des Aufstandes niedergebrannt, so daß sie augenblicklich in ihrem frühern Kuhstall ein mehr idyllisches als angenehmes Dasein führen. Trotzdem fühlen sich die beiden alten Herren, wie ich mich bei zwei längeren Besuchen überzeugt habe, außerordentlich wohl, und besonders Reverend Carnon, der jüngere von beiden, interessierte sich für den „Emperor and his family“ so lebhaft, als wenn er nicht in einem weltverlassenen Negerdorf, sondern vor den Toren Londons mitten in der Kultur lebte. Nur Mr. Porter läßt etwas nach; er ist aber auch schon hoch in den Siebzig und seit Jahrzehnten im Lande. In früheren Jahren hat gerade der ältere der beiden Missionare sich nachdrücklich mit dem Volkstum seines Missionsgebiets, mit der Volkskunde der Wanyassa, Yao und Makonde beschäftigt, so daß ich bis gestern hoffte, von ihm und seinem regsameren Amtsbruder für meine Studien viel zu profitieren. Aber ich habe eine Enttäuschung erlebt; sooft ich bei dem solennen und durchaus nicht dürftigen Frühstück, das die beiden Geistlichen uns zwei Weltkindern, Herrn Ewerbeck und mir, darboten, auf die Völkerverhältnisse der Umgebung zu sprechen kam, erfuhr das Gespräch unweigerlich eine Ablenkung in dem Sinne, daß man wieder zur „Family“ des deutschen Kaisers zurückkehrte, und vor allen Dingen natürlich zum Emperor selbst. Er muß doch auch den anderen Nationen mächtig imponieren!
Aber Sie, Herr Geheimrat, wollen erklärlicherweise mehr von Afrika und seinen schwarzen Leuten hören als von den weißen Eindringlingen, und seien sie selbst in der friedlichen Gestalt des Missionars gekommen.
[S. 66]
Mit meiner Landung in Lindi am 22. Juni war mein Reiseplan im Grunde genommen von selbst gegeben. Wenn man einen Blick auf die Karte Ostafrikas wirft, findet man, daß die äußerste Südostecke bevölkerungsstatistisch sich wie eine Insel aus der völkerleeren Umrandung heraushebt. Wirklich ist auch, wie das der leider zu früh verstorbene Geologe Lieder so treffend geschildert hat, das Gebiet nördlich vom mittleren und zum Teil auch des oberen Rovuma, bis weit über den Umbekuru und bis hoch in das Hinterland von Kilwa hinauf, auf Hunderte von Kilometern hin schweigendes Pori, menschenleere Wildnis, in der heute kein Negerdorf mehr von der friedlichen, dichten Bevölkerung zeugt, die noch Roscher, Livingstone und von der Decken vor nahezu einem halben Jahrhundert in diesen Gebieten vorgefunden haben. Nur ein schmales, der Küste in einiger Entfernung entlang laufendes Band verknüpft diese Völkerinsel mit dem Norden; ein anderes, ungleich schwächeres verbindet es den Rovuma hinauf mit dem Nyassagebiet.
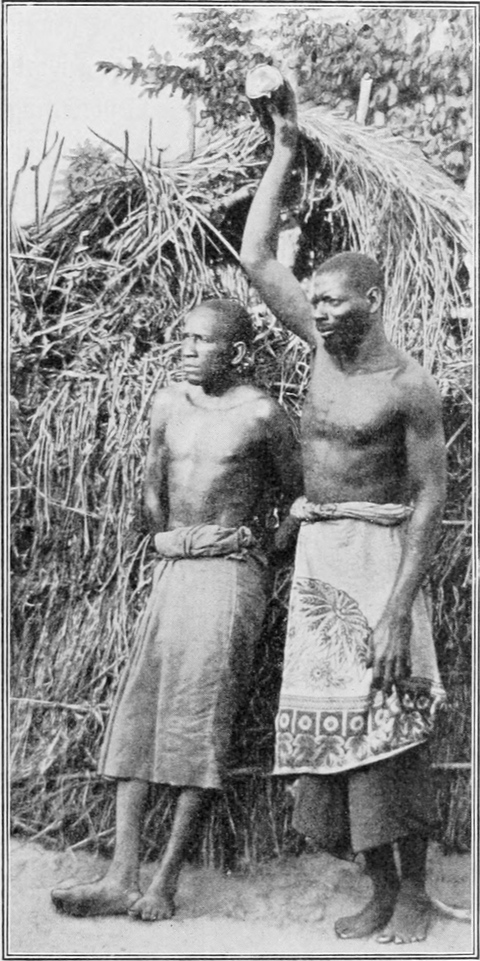
In dieser räumlichen Umgrenztheit ist der Südosten, d. h. das Makondeplateau, das nördlich davorliegende Lukuledital und die weite Ebene im Westen jenes Hochlandes, das idealste Arbeitsfeld für einen Mann, der wie ich nur verhältnismäßig wenig Zeit zur Verfügung hat, in dieser beschränkten Zeit aber doch etwas Abgerundetes liefern möchte. Die Wamuera, die eigentlich als erstes Ziel gedacht waren, habe ich zu meinem Kummer einstweilen zurückstellen müssen. Mit dem kaiserlichen Bezirksamtmann Herrn Ewerbeck bin ich am 11. Juli von Lindi abmarschiert. Ngurumahamba, der erste bemerkenswerte Ort an der Lukuledistraße, hat noch ganz Küstencharakter; selbst ein Steinhaus befindet sich dort unter den Suahelihütten. Aber schon am zweiten Marschtage kommt man bei Mtua zu dem Völkerstamm der Yao. Sie stellen den ersten ethnischen Gruß aus dem fernen Innern dar, denn sie sind der äußerste Vorposten auf der großen Wanderung, die dieser tatkräftige Völkerstamm seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus seinen Ursitzen im südöstlichen[S. 67] Nyassagebiet in der Richtung nach der Küste des Indischen Ozeans ausgeführt hat und noch weiter ausführt. In bezug auf die Technik der Völkerwanderungen klammern wir uns immer an das in dieser Allgemeinheit sicherlich nicht richtige Bild, das uns von den frühesten Schuljahren an über die Völkerwanderung par excellence, die große Westbewegung unserer Altvorderen vor anderthalb Jahrtausenden, entworfen wird. Wir denken an Mann und Roß und Wagen, an eine geschlossene dichte Völkerwelle, die sich schwerfällig, aber unwiderstehlich über die Länder dahinwälzt. Hier nichts von alledem. Zwar sind diese Yao von Mtua wanderungstechnisch nicht typisch für ihre Stammesgenossen, denn sie sind vor etwa einem Jahrzehnt durch Hauptmann Engelhardt den Wangoni oben am Ostufer des Nyassa abgejagt und hierher verpflanzt worden; aber sonst vollzieht sich das Eindringen landfremder schwarzer Elemente hier im Süden ganz lautlos, fast unmerklich: ein Trupp, eine Horde, eine Gruppe von Familien, im besten Fall unter der Führung eines[S. 68] Häuptlings, ist eines schönen Tages da, macht sich im Pori an geeignet erscheinender Stelle ein Fleckchen urbar, baut ein paar lustige Hütten, und die Einwanderung ist vollzogen. Mehr oder minder blutige Kämpfe zwischen Autochthonen und Eindringlingen mögen in früherer Zeit wohl vorgekommen oder gar die Regel gewesen sein, heute hört man nichts davon. Ob der Neger toleranter geworden ist, oder ob die feste deutsche Hand, der natürlich jeder Bevölkerungszuwachs nur lieb sein kann, eine Sinnesänderung bewirkt hat, muß ich dahingestellt sein lassen.
In ihrem Äußern unterscheiden sich diese Yao kaum merklich von den Suaheli der Küste; sie sind in genau dasselbe Kanga, den bekannten, in Holland gefertigten Baumwollstoff mit den lebhaften Mustern gekleidet wie die Küstenfrauen, wenn auch nicht so kokett, sauber und modern wie die Mädchen der Modestadt Daressalam, allwo die Modemuster einander rascher jagen denn selbst in Paris; und sie tragen auch alle denselben koketten, kleinen Pflock im linken Nasenflügel wie die Damen der Küste. Ursprünglich indisch, hat dieses „Kipini“, im Kiyao, dem Idiom der Wayao, Chipīni genannt, seinen Siegeszug über die ganze Ostküste Afrikas gehalten, und jetzt ist es im besten Begriff, als Sinnbild höherer Bildung und feinerer Zivilisation auch die fortschrittlichen Stämme des Innern zu erobern. In einfachster Form ein bloßer Zylinder aus Pflanzenmark, wird es je nach dem Reichtum der Trägerin in den besseren Exemplaren aus Ebenholz gefertigt oder gar aus Zinn oder Silber hergestellt. Die Ebenholzpflöckchen sind fast immer in sehr zierlicher, geschmackvoller Weise mit Zinnstiftchen ausgelegt. Nach unseren Begriffen stellt das Chipini zunächst keine Verschönerung des menschlichen Antlitzes dar; hat man sich aber erst einmal an den Anblick gewöhnt, so findet man es doch ganz nett und ansprechend, denn es verleiht dem braunen Gesicht der Trägerin unstreitig etwas Kokettes.
Recht schlimm sieht es im Gegensatz zu der gutbebauten küstennahen Zone im weiteren Hinterlande bei den Wamuera aus. Symptomatisch für das ganze Unheil, welches der von den Negern so[S. 69] kurzsichtig heraufbeschworene Aufstand über diesen Teil Afrikas gebracht hat, ist schon der Zustand von Nyangao. Es ist die Missionsstation der Benediktiner. Patres und Schwestern wirkten hier bis zum Hochsommer 1905 einmütig an der Bekehrung und Unterweisung der Schwarzen. Dann drang das Majimaji-Gift, die Zauberwasser-Idee, auch aufs Rondoplateau und ins mittlere Lukuledital, und ehe die arglosen Glaubensboten sich des nahenden Unheils versahen, war es schon da. Das Missionspersonal ist damals nach hartnäckigem Kampf und unter Verlust einer der Schwestern vertrieben worden, der umfangreiche Gebäudekomplex aber fiel der Zerstörung durch die Aufständischen anheim. Wie Nyangao augenblicklich aussieht, zeigt Ihnen die umstehende Photographie. Jetzt sitzen die drei Väter, die es gewagt haben, auf den alten Arbeitsplatz zurückzukehren — sie sind mir übrigens vom „Prinzregent“ her liebe Bekannte — mitten auf dem Trümmerhaufen einsam in dem ehemaligen Schwesternhause; unverdrossen aber und ungebrochen haben sie ihr so jäh gestörtes Bekehrungswerk von neuem aufgenommen.
Der Majimaji-Aufstand bildet am Lagerfeuer und in den Gesprächen der Neger noch immer den Hauptgegenstand der Unterhaltung, trotzdem der Lindibezirk längst wieder beruhigt ist. Seiner Entstehung nach gehört er zu den interessanteren Erscheinungen der menschlichen Kriegsgeschichte, lehrt doch auch er, wie allgemein und wie rasend schnell selbst große Bruchteile einer ganzen Rasse von einer einmal aufgekommenen abergläubischen Idee ergriffen und zu einer von hoher Begeisterung getragenen Einheit werden können. Soweit man heute bereits ersieht, ist die dem Aufstande zugrunde liegende Idee die Abschüttelung des Jochs der Weißen, das Mittel dazu die Aufrüttelung der gesamten einheimischen Bevölkerung. Ohne „Daua“, ohne ein Zaubermittel, ist diese Aufrüttelung beim Neger nur schwer oder gar nicht zu erzielen. Daher kam auch ganz ohne Frage das Zurückgreifen der Anstifter dieses verhängnisvollen Krieges auf die Zauberwasser-Daua. Über diese sind verschiedene Versionen in Umlauf.[S. 70] Nach der einen wohnte der eigentliche Anstifter an den Panganischnellen des Rufidyiflusses. Er lehrte, er sei ein Abgesandter Gottes, mit dem er durch die Vermittlung einer in den Schnellen wohnenden Schlange verkehre. Diese habe ihm geheißen, allen Männern das heiße Wasser der Quellen bei Kimambarre zu reichen; dann würden sie Kraft und Mut bekommen, die Deutschen in den Ozean zu werfen. Das Wasser aber mache zugleich alle Kämpfer gegen die Kugeln der Europäer unverwundbar.
Die andere Lesart weiß nichts von dieser Schlange und dem heißen Wasser. Nach ihr, die mehr im Norden der Kolonie, in Usagara, in Umlauf ist, veranstalteten die Zauberer überall in den Dörfern zunächst gewaltige Pombegelage. Hatte das Bier dann seine Wirkung getan, so wurden die Dörfler in den Plan des Rädelsführers eingeweiht; sie bekamen ihre Daua, über die nichts Näheres gesagt wird, die aber auch hier die Fähigkeit besitzt, ihren Träger gegen die Kugeln der verhaßten Deutschen unverwundbar zu machen; die Geschosse verwandelten sich einfach in Wasser, wenn sie aus dem Gewehrlauf kämen, hieß es. Die zahlreichen Gefechte haben die Majimajimänner sehr bald eines anderen belehrt; trotzdem ist der Fanatismus dieser Schwarzen, die selbst gegen das vernichtende Feuer der Maschinengewehre, der „Bumbum“, bis auf Speerlänge herangestürmt sind, wahrhaft erstaunlich. —

Von der Küste bis kurz hinter Nyangao ist die Vegetation wesentlich anders geartet als weiterhin westlich. Den größten Teil des Weges, der Barrabarra, wie er im Trägerjargon heißt, das ist der etwa in Sektionsbreite geschlagene Weg, auf dem sich der Großverkehr über die weiteren Entfernungen hin abspielt, begleitet bis ungefähr Nyangao ein dichter, 3 bis 5 Meter hoher Busch, über den sich vereinzelt stehende, doppelt und dreifach so hohe Bäume erheben. Aus diesem Busch herausgespart sieht der weiße Reisende mehrmals an jedem Tagemarsch zur Linken und zur Rechten des Weges große, freie Stellen. Das ist Kulturboden; er ist kenntlich am Fehlen[S. 71] jeglichen Unterholzes und an den verkohlten Stümpfen der größeren Bäume. Zweifellos sind es alte Dorfstätten. Aber wo sind die Häuser? Und wo sind die Bewohner, die diesen Erdenfleck urbar gemacht haben? Hier finden Sie, Herr Geheimrat, einen typischen Zug aus der Völkergeschichte Afrikas, insonderheit der neueren, wie sie durch die moderne Plantagenwirtschaft und ihr Arbeiterbedürfnis, sodann auch durch die Notwendigkeit des schwarzen Askari inauguriert worden ist. An sich und ursprünglich ist der Neger nicht scheu; im Gegenteil, er ist neugierig und schätzt einen regen Lebensbetrieb. Aber er kann, vulgär gesprochen, nicht vertragen, daß man ihm in die Töpfe guckt. Das geschah nun in der neueren Zeit in mehr als erträglichem Maße. Jede Karawane von Binnenlandnegern, die nach der Küste marschierte, sei es, um ihre Waren, Wachs, Tabak usw. abzusetzen, sei es, um sich beim Weißen als Arbeiter zu verdingen, hielt es für ihr natürliches Recht, sich von den Dorfbewohnern tränken und füttern zu lassen. Doch auch selbst die Karawane eines Weißen[S. 72] ist geeignet, derartige Belästigungen für die Dörfler mit sich zu bringen. Wie oft habe ich es schon jetzt sehen müssen, daß unsere Leute sich bei jedem Halt in die weit auseinanderliegenden Hütten verteilen, um irgendwelche Dienste, und sei es auch nur den Trunk aus dem Schöpflöffel, zu heischen. So gefällig und entgegenkommend der Neger auch sein mag, auf die Dauer paßt ihm diese ewige Störung doch nicht, und deswegen zieht er vor, die alten Hütten abzubrechen und die neuen weitab im dichten Busch zu errichten, durch den nur ganz schmale, kaum auffindbare Pfade führen.
Anthropologisch hätte man sich im Wamueragebiet unter den Indianern wähnen mögen, so kupferrot erstrahlt ihre Haut. Ich hielt diesen starkroten Unterton zunächst für ein besonderes Kennzeichen gerade dieses Stammes, allein ich habe viele Individuen von ganz gleichem Farbenkomplex auch später bei den Makua von Hatia, Nangoo und Chikugwe, vereinzelt auch bei den hiesigen Yao und denen von Mtua und Mtama getroffen. Überhaupt scheint es mir sehr schwer zu sein, hier anthropologisch einwandfrei zu arbeiten; die Typen gehen zu sehr durcheinander und ineinander über, als daß man dem einzelnen seine Stammeszugehörigkeit an der Nase absehen könnte. Sehr wahrscheinlich bestehen aber auch gar keine Stammesunterschiede, denn sie alle: die Wamuera, Wangindo, Wayao, Makonde, Matambwe und Makua gehören der großen Untergruppe der östlichen Bantu an. Das ist ein Grund mehr, von meiner an sich so kostbaren Zeit noch weniger auf die Anthropologie zu verwenden, als ich von Haus aus bereits geplant hatte. Mögen die Herren mit ihren Meßgerätschaften, ihren Zirkeln und Stangen selbst hierher gehen. Für uns Ethnographen gibt es einstweilen Eiligeres zu tun.
Doch ich wollte Ihnen, Herr Geheimrat, erzählen, wie schlecht es den Wamuera augenblicklich ergeht. Wie Sie wissen, hat sich dieser Völkerstamm geschlossen am Majimaji-Aufstande beteiligt; es hat eine ganze Reihe von Gefechten gegeben; schließlich aber haben die schwarzen Krieger und ihre Angehörigen es doch vorgezogen, sich[S. 73] vor den siegreichen Deutschen im Busch zu verbergen. Ein Aufenthalt im Freien während der Regenzeit ohne ausreichendes Obdach ist sicherlich keine Annehmlichkeit; tritt nun, wie hier, noch hinzu, daß die Leute nicht geerntet haben, weil sie am Beginn der Regenzeit nicht haben säen können, so ist Tod und Verderben die unausbleibliche Folge. Jetzt, wo die Haupträdelsführer zumeist gefaßt und in sicherem Gewahrsam an der Küste sind, kommen die Überlebenden langsam wieder aus ihren Verstecken hervor. Aber wie sehen sie aus, die Ärmsten! Mit einer noch dickeren Schmutzkruste bedeckt als gewöhnlich, zum Skelett abgemagert, mit Hautkrankheiten an zahlreichen Stellen des Körpers, entzündeten Augen, und dabei einer Ausdünstung, daß einem schlecht werden möchte! Doch sie erscheinen wenigstens wieder vor den Weißen, was als Zeichen des neugefestigten Zutrauens zu unserer Herrschaft von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.
Einige sehr starke Marschstunden hinter Nyangao passiert man den Herrschersitz des „Sultans“ Hatia. Er ist nach Namen und Zahl der Vierte auf diesem winzigen Makuathrone. Das Grab seines Vorgängers Hatias III. liegt in einer tiefen Höhle auf dem Ungurueberge. Dieser ist, richtiger gesprochen, eine Bergnase, die nach Norden weit aus dem Makondeplateau in die Lukulediniederung vortritt. Man sieht ihn von der Barrabarra aus schon tagelang vorher mit seinem rötlich strahlenden Steilabsturz, den man treffend als das Wahrzeichen des ganzen mittleren Lukuledigebietes bezeichnen darf. Auch in Sage und Mythus der hiesigen Völker spielt der Berg die größte Rolle. Um ihn rankten sich schon vor der Beisetzung Hatias III. die Sagen der Vergangenheit; jetzt aber, wo der tote Negerfürst dort in dunkler, jedem Uneingeweihten verbotener Schlucht von den Taten seines Lebens ausruht, ist der Ungurue im Volksglauben zu einem Heiligtum geworden, auf dem in mondhellen Nächten der verstorbene Herrscher seiner Gruft entsteigt, die Geister seiner Untertanen um sich schart und mit ihnen zur nächtlichen Ngoma antritt.
[S. 74]
Hatia IV. war erst unmittelbar vor unserer Ankunft in seine Residenz zurückgekehrt; er hatte an der Küste für einige Zeit Muße gehabt, über seine Beteiligung am Aufstand nachzudenken. Jetzt machte er mir den Eindruck eines völlig gebrochenen Mannes, dem es körperlich ebenso schlecht erging wie seinen Untertanen; er wohnte nicht besser als diese und hatte auch sicherlich ebensowenig zu beißen wie sie. An dem Tage, wo wir für einige Zeit bei Hatia haltmachten, war er doppelt traurig; wenige Stunden vorher hatte ein starker Löwe, der wegen seiner Frechheit im ganzen Lande berühmt ist, aus seiner nächsten Nähe eine Frau geholt; noch sah man die ungeheuren Pranken im Sande abgedrückt, so daß man den Weg des Räubers um die Hütte herum genau verfolgen konnte. Entgegen aller Löwengewohnheit hatte das Tier seine Beute fast am hellen Tage direkt aus der Hütte herausgeholt. Mann, Frau und Kind hatten friedlich in dieser gesessen; da war der schwere Körper des Tieres auf die zunächst sitzende Frau gestürzt. Der Ehemann hatte zwar versucht, die Gattin zu halten, aber er war krank und schwach, und so hatte das Tier spielend gesiegt. Längere Zeit noch hatte man das „nna kufa, nna kufa, ich sterbe, ich sterbe“ der Unglücklichen im Pori verhallen hören. Zu helfen hatte keiner vermocht. Denn einmal besaßen die Leute nach dem Aufstand keine Gewehre, und selbst wenn sie diese gehabt hätten, würde ihnen das Pulver gefehlt haben, dessen Einfuhr seit einiger Zeit gesperrt ist.
Als Rächer wird der Neffe und Erbe Hatias IV. auftreten. Er ist ein hübscher, kohlrabenschwarzer Jüngling mit krausem Schnurrbärtchen auf der Oberlippe und einem beneidenswert dichten, krausen Haarwuchs auf der Schädeldecke. Mit einem stolzen Gewehr bewaffnet, ist er mit uns von Lindi heraufgekommen, um das Gebiet seines Stammes von der Löwenplage zu befreien. Man kann hier wirklich von einer solchen Plage reden; es heißt, daß der ganze, lange Weg von Nyangao bis Massassi unter vier Löwenpaare aufgeteilt sei, die nichts Besseres zu tun haben, als ihre Wegstrecke nach menschlichen[S. 75] Opfern abzupatroullieren. Selbst die drei Missionare von Nyangao sind vor dem König der Tiere nicht sicher; ist es doch kürzlich passiert, daß Pater Clemens auf einem Spaziergang plötzlich einem großen Löwen gegenüberstand, der ob des Geschehnisses allerdings ebenso verdutzt war wie der Gottesmann.
Daß der Löwe von Hatia sein Opfer sogar aus dem Hausinnern holen konnte, verstehe ich angesichts der Bauart der jetzigen Wamuerahütten recht wohl. Wenn jemand Lust hat, Studien über die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Wohnhauses zu machen, hier könnte er die Anfänge sehen. Es sind schon bessere Bauten, wenn sich zu den Seitenwänden auch noch Giebelteile gesellen; zumeist sind diese Wohnungen nichts mehr und nichts weniger als zwei schräg gegeneinander gelehnte, aus Strohbündeln notdürftig zusammengearbeitete Wände. Es kommt hinzu, daß die Wamuera diese Urhütten, wenn man so sagen darf, wohl oder übel im unberührten Pori haben aufstellen müssen; fehlen ihnen doch nach dem Verlust aller ihrer Habe — ihre Dörfer sind als ihr einziger wertvoller Besitz von unseren Truppen natürlich dem Erdboden gleichgemacht worden — selbst die Werkzeuge zur Urbarmachung der Felder und zum Lichten des Waldes. Freie Plätze scheut der Löwe, im Pori aber fühlt er sich heimisch; er betrachtet es als sein natürliches Jagdrevier und schleicht sich in ihm zum tödlichen Sprunge bis dicht an die Hütten heran.
Eins hätte ich beinahe vergessen, Ihnen zu berichten. Was sind die berühmten Botokuden mit ihren Lippenscheiben gegen die Völker des Südens von Deutsch-Ostafrika! Schon in Lindi hatten die Herren mir den Mund wässerig gemacht mit Erzählungen von dem abenteuerlichen Äußern der Wamuerafrauen. Aber wie weit sind jene Schilderungen hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben! Bilder sagen hier mehr als lange Worte, sie sprechen klarer und verständlicher; schauen Sie, Herr Geheimrat, sich demnach lieber die Typen an, die ich Ihnen gleichzeitig mitsende. Daß das Makondeplateau und seine Umgebung mit zu dem großen Bezirk des Pelēle, der Lippenscheibe,[S. 76] gehört, habe ich bereits seit langer Zeit gewußt, aber eine brauchbare Abbildung hatte ich in der Literatur bis zu meinen eigenen Aufnahmen noch nirgends entdecken können. Es scheint in der Tat so, als wenn meine Vorgänger hier im Lande entweder nicht haben photographieren können, oder aber, als wenn ihre Apparate bereits vor der Erreichung des Pelelegebietes dem Klima zum Opfer gefallen seien!

Das Pelele oder, wie es im Kimuera heißt, Itona, ist auf das weibliche Geschlecht beschränkt, bei ihm aber ist es allgemein. Es ist ein Pflock, bei älteren Individuen auch eine wirkliche Scheibe aus schwarzem Ebenholz oder einem hellen, mittels geschlämmter Tonerde schneeweiß gefärbten anderen Holz, die sich in die durchlochte und ausgeweitete Oberlippe zwängt. Selbstverständlich läßt sich nicht sogleich eine talergroße Itona in diesen Körperteil einfügen, sondern man fängt mit einem winzig kleinen Fremdkörper an, um im Laufe langer Jahre das Maximum des Pelele und damit auch den höchsten Grad landesüblicher Schönheit zu erreichen. Die erste Durchlochung der Oberlippe erfolgt schon im frühen Mädchenalter, zwischen dem 7. und 9. Jahre; sie geschieht mit dem ahlenförmig zugespitzten Ende des Rasiermessers. Man versteht die Wunde am Zuheilen zu verhindern, indem man dünne Fremdkörper, einen Strohhalm oder dergleichen, einfügt. Systematisch vergrößert man die Zahl dieser Halme und damit die ursprünglich so enge Öffnung. Später fügt man in sie den spiralförmig zusammengerollten Blattstreifen eines Palmfieders hinein. Der ist elastisch und treibt die Öffnung von selbst auseinander. Schließlich erfolgt die Einfügung des ersten massiven Pflockes. Bei den Wamuera schwankt dessen Durchmesser zwischen der Stärke eines Fingers und[S. 77] dem eines Zweimarkstückes; bei den Makonde hingegen sollen diese Oberlippenscheiben bei älteren Frauen bis zu doppeltem Durchmesser vorkommen. Sie können sich denken, wie gespannt ich auf dieses Volk bin. Überhaupt freue ich mich unbändig auf das Makondeplateau; für unsere Wissenschaft ist es tatsächlich noch eine völlige terra incognita. Was wird dort alles zu finden sein!

Mit der Itona haben die Frauen indessen in der Ausschmückung ihres eigenen Ich noch nicht genug getan; sie ist gleichsam nur die Krönung des ganzen, großen Gebäudes menschlicher Eitelkeit, das zu allen Zeiten und von allen Gliedern der Spezies Homo sapiens aufgerichtet worden ist und immer noch weiter ausgebaut wird, um die eigene Individualität unter allen Umständen aus der Schar der übrigen Stammesgenossen herauszuheben; zum stillen oder ausgesprochenen Neid der eigenen Geschlechtsgenossen, zur Bewunderung für das andere Geschlecht. Zur Itona tritt bei alten Frauen hier und da zunächst ein Unterlippenpflock, Nigulila genannt. Lang und schlank, in ein rundes Knöpfchen auslaufend, ragt er aus der welken Haut hervor; er soll die Aufmerksamkeit von dieser ablenken und den Beschauer vergessen machen, daß für die Trägerin dieses Schmuckes die Tage der Schönheit und der Liebe längst vergangen sind. Ganz allgemein sind dann große Scheiben oder Pflöcke in den aufgeweiteten Ohrläppchen. Weiterhin aber sieht der verwunderte weiße Beschauer das Antlitz dieser Schönen mit auffallenden Gebilden bedeckt. Von ferne gesehen, haben mir diese Frauen den Aufenthalt in einer deutschen Universitätsstadt vorgetäuscht, wie sie sich in einer hoffentlich nie erscheinenden Zukunft darbieten könnte. Als flotter Bursch von Göttingen und Leipzig habe ich zu meiner Zeit auch ausgesehen wie ein wandelndes Beefsteak, wie man bei uns zu sagen pflegt,[S. 78] aber gegen diese prachtvollen, schön breit aufgelaufenen Schmisse der weiblichen Wamueraburschen hätte ich nicht anzukämpfen vermocht; im Zeitalter der Asepsis findet man dergleichen bei uns überhaupt nicht mehr. Kommt man dann dem Trupp der Frauen näher, so lösen sich die Terzen und Quarten zu tausend Einzelheiten auf; lang ziehen sich die Reihen der Narbenkeloide über Stirn und Wange dahin, verlaufen wagrecht oder senkrecht, oder bilden die verschiedensten Figuren. Im einzelnen besteht jedes dieser Muster aus vielen, vielen Hautschnitten, die, einander parallel, meist senkrecht verlaufen. Man hat sie seinerzeit am Verheilen verhindert, indem man sie während der Schorfbildung immer wieder von neuem aufgeschnitten hat. So sind sie im Laufe von Wochen und Monaten zu merkbaren Wulsten geworden, die in ihrer Gesamtheit die ganze Physiognomie in entscheidender Weise beeinflussen.

Und selbst hiermit ist dem Schönheitsbestreben der Wamuerafrauen noch nicht genug getan. Wenn das Brust und Rücken umhüllende Tuch einmal zur Seite gleitet, sei es durch eine unbeabsichtigte Bewegung der Frau selbst oder durch das Vorrücken des von ihr unzertrennlichen Babys von dem gewöhnlichen Ruhesitz auf dem Rücken der Mutter nach der Hüfte oder gar nach der Vorderseite, so sieht das erstaunte Auge auch diese Körperflächen mit denselben oder ähnlichen Mustern übersät wie das Gesicht. Selbst Gesäß und Oberschenkel sollen von solchen Ziernarben nicht frei sein. O menschliche Eitelkeit, was treibst du doch für Blüten! ruft da der Ethnograph. Wollte er aber hinzufügen: Da sind wir Wasungu doch bessere Menschen, so möchte er sich wohl am besten unterbrechen. Denn zunächst tragen auch unsere Töchter, Frauen und Schwestern noch immer recht hübsche Überlebsel genau der gleichen Sitte in Gestalt ihrer Ohrringe; sodann aber dürfte unser Korsett, soweit es von seiner Trägerin zu dem Zweck angelegt wird, die Vorzüge der Figur zu heben, ebensosehr der Diskussion unterliegen wie die geschilderten Schönheitsmittel der Afrikanerinnen. Ich hebe das Korsett ausdrücklich[S. 79] als problematischen Schmuck hervor, und auch nur so weit, als es unsere Mädchen und Frauen verleitet, durch unvernünftiges Schnüren die inneren Organe zu schädigen und dadurch vielleicht verhängnisvoll auf die Nachkommenschaft einzuwirken. Als Bestandteil unserer europäischen Kleidung halte ich es dagegen nicht nur für berechtigt, sondern sogar für nötig, denn es scheint mir den Zug der mannigfaltigen Gewänder immer noch besser zu verteilen als ein Paar den Hosenträgern der Männer entsprechende Schulterbänder. Ein ganz klein wenig muß ich schließlich sogar meinem Kollegen Max Buchner in München zustimmen, der auch aus ästhetischen Gründen das Korsett verteidigt. Buchner hat seine berühmte Reise zum Muata Jamvo tief unten im Kongobecken gemacht; er hat auch andere Teile Afrikas studiert, die Südsee in den verschiedensten Richtungen durchkreuzt, kurz, einen großen Teil von der Welt unserer heutigen Naturvölker mit[S. 80] eigenen Augen gesehen; ihm steht also wohl ein maßgebendes Urteil zu. Der Münchner Ethnograph meint nun, daß es auch den Negerinnen und den übrigen mehr oder minder unbekleideten Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts auf der Erde ganz dienlich sein würde, ihrerseits zu einem unserem Korsett entsprechenden Gerät überzugehen. Er wünscht es für diese Frauen nicht als Kleidungs- und nicht als Schmuckstück, sondern lediglich als Büstenhalter. Und da hat er ganz recht; so anmutig, vielleicht gar schön der schlanke Körper der jugendlichen Negerin mit seinen zarten Formen uns berührt, so widerwärtig wirkt bei den späteren Jahrgängen die durch mehrfache Geburten und das überlang ausgedehnte Stillen der Kinder bewirkte Mißbildung der Brüste. Sie sind wahrlich ein nichts weniger als schöner Anblick, und wenn auch Buchner selbst nicht im mindesten daran denkt, allen Negerinnen, Indianerinnen und Ozeanerinnen als höchstes und mit allen Kräften anzustrebendes Ziel unseren europäischen Frauenpanzer zu wünschen, so ist allen Verfechterinnen unseres viel angefeindeten Korsetts in dem Münchner Gelehrten doch unstreitig ein ausgezeichneter Sekundant erstanden.
In das Leben der Binnenlandstämme habe ich in der kurzen Zeit noch nicht viele, aber doch recht interessante Einblicke zu tun vermocht. Völkerpsychologisch bemerkenswert war mir während des Marsches nach Massassi die Beobachtung, daß überall da, wo die Eingeborenen sich aktiv am Aufstand beteiligt hatten, die Wege in tadelloser Ordnung waren, während im Gebiet unserer Bundesgenossen hohes Gras, ja selbst ganze Büsche die Barrabarra nur schwer passierbar machten. Die Braven und Artigen pochen nun auf ihre Verdienste und sagen sich: „Wir können es uns jetzt einmal eine Zeitlang leisten; uns wird der Mdachi, der Deutsche, so leicht nichts tun, nachdem wir so wacker zu ihm gestanden haben.“ Herr Ewerbeck hat aber trotz alledem den Akiden und den Jumben, den Bezirkschefs und Ortsvorstehern, recht energisch den Standpunkt klargemacht. Diese Organe sind nämlich für die Ordnung innerhalb ihres Bezirks verantwortlich.

[S. 81]
Einen großartigen Anblick gewährt Afrika bei Nacht. Saß man während des Hermarsches im Lager vor seinem Zelt, oder trete ich jetzt abends vor die Tür der Barasa, des Rasthauses, in dem ich meinen Wohnsitz aufgeschlagen habe: wohin auch das Auge schaut, ringsum am Horizont wälzen sich rote Gluten durch die weite Ebene. Das ist das afrikanische Brennen, ein Verfahren, das die Neger schon seit Jahrtausenden geübt haben und welches Ihnen, Herr Geheimrat, als dem ausgezeichneten Kenner der Geographie der Alten, schon seit Ihrer Jugendzeit, wenn auch vielleicht unbewußt, geläufig ist. Sie wissen ja, als der alte Karthager Hanno an der Westküste Afrikas gen Süden fuhr, erschreckte ihn und seine Mannschaften nichts so sehr und nachhaltig als glühende Feuerströme, die nachts von den Küstenbergen zur Ebene niederflossen. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung haben diese Feuerströme absolut nichts mit dem Vulkanismus gemein, wie man sooft behauptet hat, sondern es sind dieselben Brennprozesse gewesen, die von den Bewohnern des schwarzen Erdteils zur Trockenzeit noch jetzt allnächtlich veranstaltet werden.
Über den Nutzen oder Schaden dieses Brennens ist in unserer Kolonialliteratur schon viel geschrieben worden; die einen verurteilen es, weil es den Baumwuchs schädige, die anderen stellen sich auf die Seite der Eingeborenen und sagen: nur dadurch, daß man das dichte, hohe Gras und das Unterholz des afrikanischen Urwaldes in regelmäßigen Zwischenräumen durch Feuer vernichte, könne man des Ungeziefers, das sich sonst zu Myriaden vermehren würde, einigermaßen Herr werden; zudem sei die Asche einstweilen noch das einzige Düngemittel großen Stils. Ich halte mich nicht für berechtigt, den Streit der Meinungen zu entscheiden; mich fesseln viel mehr allabendlich die prachtvollen Leuchteffekte der nahen und fernen Flammenherde, die sich in der dunstigen Atmosphäre in verschiedenster Helle und Farbe widerspiegeln. Für den Reisenden gefährlich ist übrigens keiner dieser Brände; wo die Flamme eine Partie vollkommen trocknen Grases erfaßt, da rauscht sie wohl mit dem Knattern eines[S. 82] lebhaften Kleingewehrfeuers darüber hin; aber sonst und im allgemeinen müssen die Menschen sogar noch durch zielbewußtes Weitertragen des Feuerbrandes nachhelfen. In jedem Fall haben sie Richtung und Ausdehnung des Feuers völlig in der Hand.
Dieses Brennen ist, soweit ich ein Urteil zu fällen berechtigt bin, nur bei der ganz merkwürdigen Vegetationsform möglich, die den größten Teil Afrikas charakterisiert und die auch die große, weite Ebene hier im Westen und Nordwesten des Makondeplateaus in ihrer ganzen Ausdehnung bedeckt. Das ist die „lichte Baumgrassteppe“, wie der Geologe Bornhardt sie treffend genannt hat. In der Tat ist diese Vegetationsform weder ganz Wald, noch ganz Steppe, sie vereinigt vielmehr beides. Denken Sie sich einen besonders stark verwilderten bäuerlichen Obstgarten bei uns daheim im deutschen Vaterlande, wo man leider noch viel zu wenig Gewicht auf diesen Teil des Feldbaues legt, und setzen Sie unter die struppigen, vereinzelt stehenden Apfel-, Birnen- und Zwetschenbäume statt des bescheidenen deutschen Grases dieses zwei, auch drei Meter hohe, fast rohrähnliche afrikanische; untermischen Sie es dann mit einem dornigen, aber ebenfalls nicht sehr dichten Unterholz, und verbinden Sie schließlich die Kronen der nicht übergroßen, d. h. sicherlich nicht über 10 bis 12 Meter hohen Bäume, die trotz aller Varietäten doch ziemlich allgemein den Eindruck unseres Ahorns erwecken, durch ein System luftiger Lianen. Haben Sie das alles getan, so haben Sie, ohne weitere Betätigung Ihrer Phantasie, diese Vegetationsform, die man hier mit dem allgemeinen Namen Pori bezeichnet, während im Norden der Name Myombowald vorwaltet. Während der Regenzeit und unmittelbar nach ihr muß dieses Pori seine unleugbaren Reize haben, ja Ewerbeck und sein Begleiter Knudsen singen für diesen Zeitraum sein Lob in den höchsten Tönen. Jetzt, im Juli hingegen, ist es alles andere als schön; weder imponiert es durch die Zahl und Stattlichkeit seiner Bäume, noch erquickt es durch irgendwelchen Schatten, noch bringt die Eintönigkeit des Geländes Abwechselung in dieses ewige[S. 83] Einerlei, welches den Reisenden gleich hinter Nyangao und nach dem Übergang auf das rechte Lukulediufer begrüßt und welches ihn erst nach mehrwöchigem Marsch hoch oben am oberen Rovuma freigibt. „Das also ist die Üppigkeit der Tropen, und so sieht ein immergrüner Urwald aus“, dachte ich, nachdem ich einen Tag lang diesen Genuß gekostet hatte. Genau wie in bezug auf die angebliche Appetitlosigkeit des Weißen in den Tropen, müssen wir also auch bezüglich der allgemeinen Vorstellungen von der vermeintlichen Üppigkeit Äquatorialafrikas für eine bessere Belehrung unserer Volkskreise sorgen. Sie machen sich sonst von der Zukunft Deutsch-Ostafrikas übertrieben glänzende Vorstellungen.
Geradezu unangenehm wird dieses Pori überall dort, wo die Herren des Landes unmittelbar vorher gebrannt haben. Links und rechts vom Wege nichts als eine dicke, schwarze oder graue Aschenschicht; darüber hingelagert der Leichnam eines vom Sturm gefällten Baumes, der munter weiterglimmt und glüht; über der Erde aber ein nunmehr durch kein Gras mehr behinderter, tiefer Einblick in die vordem so undurchsichtige und undurchdringliche Baumweite. Für den Jäger bedeutet dieser Zustand eine Lust, denn nun kann er das Wild auf weite Entfernungen erspähen; für den Wanderer, zumal den mit einer großen Karawane behafteten, ist er eine Qual. Weniger in der Frühe des Tages; denn dann bindet der starke Taufall die feinen Staubteilchen noch fest zusammen. Steigt die Sonne aber höher, so entwickeln sich starke Luftdifferenzen auf engem Raum; harm- und arglos wandelt man in der glühenden Mittagshitze fürbaß, da wirbelt’s unversehens vor den Füßen auf; eine schwarze Schlange steigt in rasenden Spiralen senkrecht empor, tänzelt in koketten Kurven um den in reinstes Khaki Gekleideten herum und verschwindet dann rasch, mit leisem Kichern, als wollte sie sich über den Fremdling lustig machen, seitwärts hinter den Bäumen. Den schwarzen Begleitern hat die Schlange nichts getan, denn sie sind ja von ihrer Farbe. Doch wie sieht der Expeditionsführer aus! Zwar[S. 84] ist er nicht zum waschechten Neger geworden, doch sieht er einem Mohren immerhin ähnlich; unter diesen Umständen werden die beiden Getreuen, Moritz und Kibwana, im Lager nachher nichts Eiligeres zu tun haben, als dem Herrn das Bad zu bereiten und ihn vom Scheitel bis zur Sohle gründlich abzuseifen. Und „das hat mit ihrem Wehen die Poriwindhose getan!“
Tröstlich ist in diesen kleinen Nöten des Marschlebens der unverwüstliche Frohsinn der Eingeborenen. Im ehemaligen Aufstandsgebiet der Wamuera herrschte wenig Stimmung zu Tanz und Lustbarkeit, dazu erging es den Leuten doch zu schlecht; überall sonst entwickelte sich, sobald unser Lager nur halbwegs eingerichtet war, unter den stets scharenweise herbeigeströmten Landeskindern ein in seinem allgemeinen Verlauf stets gleiches, in seinen Einzelheiten jedoch stets wechselndes Bild. Der Neger muß wohl tanzen. Wie der Deutsche, sobald ihn nur irgend etwas über das Stimmungsniveau des Werkeltags hinaushebt, den unbezwinglichen Drang zum Singen in sich fühlt, so schart sich der Neger bei jeder Gelegenheit zu seiner Ngoma zusammen. Ngoma heißt zunächst nichts anderes als Trommel; in übertragener Bedeutung bezeichnet das Wort jede Festlichkeit, die zum Klang dieser Trommel gefeiert wird. Diese Festlichkeiten haben vor den unseren den unbestreitbaren Vorzug voraus, daß bei ihnen Musik, Tanz und Gesang gleichzeitig ertönen. Die Kapelle trommelt, improvisiert aber auch zuweilen eine Art Schnadahüpfl; der Kreis ringsum bildet den Chor; zum Rhythmus des Gesanges bewegt er sich gleichzeitig um die Kapelle herum. Das ist das gewöhnliche Bild. Es ist bei aller Fremdartigkeit so reizvoll, daß in den Küstenstädten selbst die „ältesten Afrikaner“ es nicht für unter ihrer Würde halten, von Zeit zu Zeit diesem Ausdruck autochthonen Volkstums die Ehre einer wenn auch nur kurzen Anwesenheit angedeihen zu lassen. Andere, weniger angekränkelte Weiße sind bei diesen Volksfesten hingegen förmliche Habitués, die keinen Sonnabend abend — Sonnabend ist der gesetzlich freigegebene Ngomentag —[S. 85] vorübergehen lassen, ohne sich stundenlang in den Dunstkreis der schwitzenden, keuchenden Menge zu stellen.
Außerordentlich ansprechend ist eins dieser Reigenspiele, das von den Frauen aller Gegenden, die ich bisher berührt habe, bei jeder nur denkbaren Gelegenheit ausgeführt wird. Es hat den Namen Liquata, das Händeklatschen. Die Frauen und Mädchen treten zusammen und stellen sich, die Gesichter nach innen, im Kreise auf. Plötzlich fliegen die Arme in die Höhe, der Mund öffnet sich, die Füße zucken zum ersten Takt. Im gleichen Takt und im gleichen Rhythmus setzt nun alles ein, Händeklatschen, Gesang und Tanz. Mit der eigentümlichen Grazie, die alle Bewegungen der Negerin kennzeichnet, bewegt sich der ganze Kreis nach rechts; zuerst erfolgt ein relativ großer Schritt, dem drei merklich kleinere folgen; diesem Rhythmus ist das Händeklatschen nach Intensität und Takt genau angepaßt, desgleichen auch der Gesang, den ich sogleich wiedergeben werde. Plötzlich, bei einem bestimmten Takt, lösen sich aus der Reihe der Tänzerinnen zwei Figuren los; sie tänzeln in die Mitte des Kreises hinein, bewegen sich dort in bestimmten, dem Auge leider nur zu schnell entschwindenden Figuren umeinander herum und treten dann wieder an bestimmte Stellen des Kreises zurück, um im gleichen Augenblick zwei anderen Solotänzerinnen Platz zu machen. So geht das Spiel reihum; unermüdlich, ohne auszusetzen und ohne Abschwächung setzt es sich Stunde um Stunde fort; unbekümmert auch um die Babys, die in dem unvermeidlichen Rucksack auf dem Rücken der Mama alles mitmachen müssen. In dem engen, heißen und oft genug auch schmutzigen Behälter schlafen, wachen und träumen sie, während die Mutter die derbe Mörserkeule schwingt oder den schweren Läufer zur Mehlbereitung über den Reibstein führt; während sie die Felder hackt, das Unkraut jätet und die Ernte einholt; während sie den schweren Tonkrug vom weitentlegenen Quell auf dem Kopf nach Hause trägt, und während sie sich im Tanze wiegt. Es ist kein Wunder, wenn unter solchen Umständen der Negersprößling über[S. 86] Takt und Rhythmus seines Volkes schon vollkommen im Bilde ist, kaum daß er das Tragtuch und die mütterliche Brust verlassen hat. Fast möchte es allein die Reise nach Ostafrika lohnen, diese winzigen Knirpse von drei und vier Jahren mit absoluter Sicherheit im Reigen der Alten dahinschweben zu sehen.
Und hier der überaus geistvolle Text zum sinnvollen Spiel! Steht man dabei und sieht die Frauenwelt im wiegenden Tanz sich regen, bedient man vielleicht gar den Kinematographen, so achtet man allen vorgefaßten Absichten zum Trotz doch viel zu wenig auf den Wortlaut des Tanzgesangs. Baut man dann nach vollendetem Tanz die Teilnehmerinnen vor dem Phonographentrichter auf, so möchte man schier glauben, man hätte sich verhört, so inhaltlos ist dieser Sang. Ich habe die Liquata an den verschiedensten Stellen aufgenommen, aber niemals ist mehr herausgekommen, als ich hier bieten kann. Hier Text und Tonfall:

 ,
sondern ein zwischen diesem und
,
sondern ein zwischen diesem und
 ,
doch näher an
,
doch näher an
 liegender Ton.
liegender Ton.
Sie werden zugeben, Herr Geheimrat, übermäßig viel Geist wird in diesem Liede keineswegs vergeudet; allein, das ist ein Zug, der allen Negerliedern hier im Süden eigen ist; selbst die Meister des Gesanges in Afrika, meine Wanyamwesi, liefern in dieser Beziehung nicht übermäßig viel mehr. Hier können wir wirklich und mit Fug und Recht sagen: „Wir Wasungu sind doch bessere Sänger!“
Massassi, 25. Juli 1906.
Seit reichlich einer Woche bin ich in Massassi. Mein Heim ist eine im reinsten Yaostil gebaute Hütte, die von den Eingeborenen auf Befehl des kaiserlichen Bezirksamts eigens für durchreisende weiße Herren gebaut worden ist. Die Hütte oder, wie man wohl sagen muß, das Haus, denn es ist ein stattlicher Bau von zirka 12 Meter Länge bei 6 Meter Tiefe, liegt außerhalb der Boma, welche den hiesigen Polizeiposten beherbergt. Es ist ein Ovalbau, dessen Dachform aufs täuschendste einem umgekehrten Boote gleicht. Das Material der Wände ist wie überall im Lande Bambus und Holz, das innen und außen sauber mit grauschwarzem Lehm verputzt ist. Im Gegensatz zu den Eingeborenenhäusern hat mein Palais den Vorzug von Fenstern. Das heißt: Fensterscheiben fehlen; kriecht man abends unter sein Moskitonetz in das Tippelskirchsche Feldbett hinein, so schließt man vorher die Luken mit Türen aus derben Bambusstäben. Der Fußboden ist, wie auch in allen Eingeborenenhütten, gestampfter Estrich. Er läßt sich im allgemeinen ziemlich sauber halten, ist[S. 88] aber nicht für die scharfen Kanten europäischer Stiefelabsätze eingerichtet; sie richten in ihm sehr bald erhebliche Verwüstungen an. Das ganze Innere stellt ein ungeteiltes Ganzes dar, das lediglich unterbrochen wird durch die zwei gleichsam in den Brennpunkten der Ellipse stehenden Pfeiler, auf denen das schwere Strohdach ruht. Dieses ragt nach außen und unten hin weit über die Hauswand hinaus, wird an seinem Außenrande von einer weiteren Ellipse von kürzeren Pfeilern getragen und bildet damit jenen schattigen, breiten Umgang um das ganze Haus, der unter dem Namen Barasa ein unumgänglicher Bestandteil jedes ostafrikanischen Wohngebäudes ist. —
Mit dem Namen Massassi bezeichnen die Eingeborenen einen ganzen Bezirk. Er ist geologisch, geographisch, botanisch und ethnographisch gleich interessant. Sehr bald hinter Nyangao, von der Küste aus gerechnet, beginnt die berühmte lichte Baumgrassteppe; gleichzeitig treten die Ränder des Makondeplateaus im Süden und der verschiedenen kleinen Hochländer im Norden des Lukuledi immer weiter zurück. So wandert man Tag um Tag in vollkommen horizontaler Ebene und in gleich einförmiger Vegetation dahin. Das ist nichts weniger als anregend und interessant. Aber was ist das? Eine glänzend graue, riesige Felswand grüßt bei einer Biegung des Weges unverhofft über das endlose Meer dürrer Baumkronen herüber. Man atmet auf und vergißt angesichts des neuen landschaftlichen Reizes alle Müdigkeit. Auch der Schritt der schwerbelasteten Träger wird schneller. Plötzlich hört der Wald, der mit der Annäherung an jenen Fels dichter, grüner und frischer geworden ist, auf; statt der einen steilen Felswand erblickt das Auge nunmehr aber eine ganze lange Reihe solcher Berggipfel, die sich dem Scheine nach quer über unseren Weg hinüberzieht und ihn versperrt. Doch dem ist nicht so, denn hart am Fuß der ersten dieser Kuppen schwenkt auch der Weg nach Südsüdosten ab, um nunmehr die ganze Bergreihe in nächster Nähe zu begleiten. Wo sie endlich zu Ende geht, da ist auch er zu Ende, denn[S. 89] dort liegt, eingebettet in einen förmlichen Kreis von Bergkindern, wie der Neger in seiner Sprache sagen würde, d. h. zwischen niedrigen, nur 100 oder wenige 100 Meter hohen Hügeln, die Militärstation Massassi.
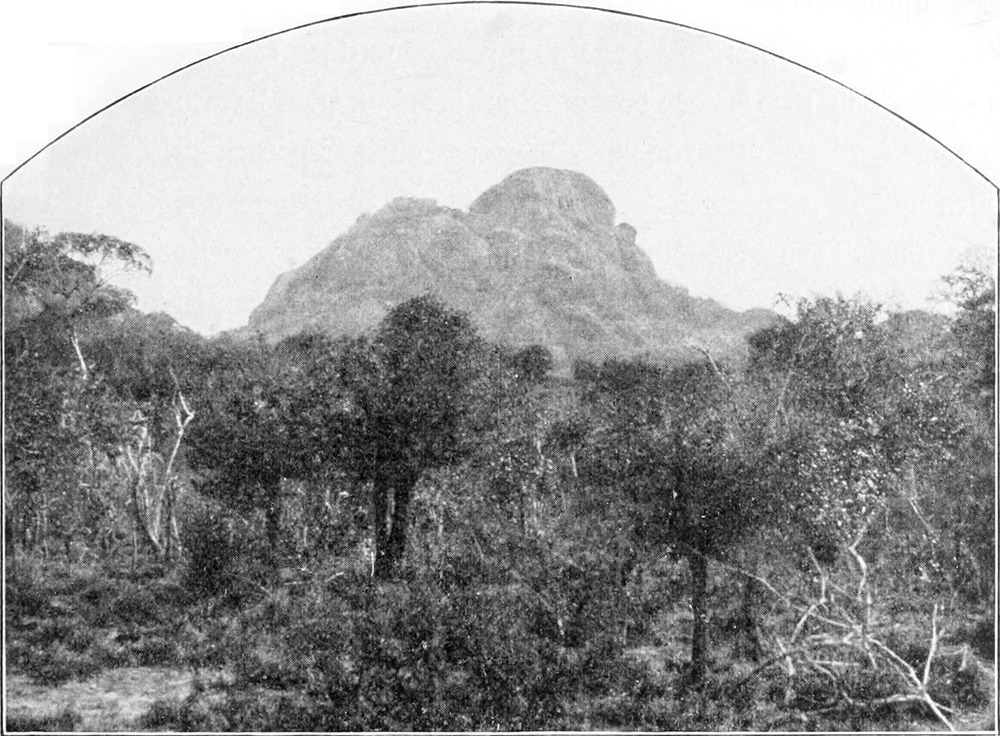
Die Gneiskuppen von Massassi sind in der geologischen Literatur über Afrika hochberühmt; sie sind aber auch etwas Einzigartiges, nicht ihren petrographischen Bestandteilen nach, sondern wegen ihrer enggeschlossenen Reihenform. Orographisch wird dieser ganze Osten Afrikas, in dem ich mich befinde, charakterisiert durch „Inselberge“, wie sie der Geologe Bornhardt nennt. Der Name ist gar treffend; würde sich der Erdteil um etliche hundert Meter senken, oder der Indische Ozean um ebensoviel steigen, so würde das ganze Lukuledital, auch das des Umbekuru und des Rovuma, sicher auch das mancher Flüsse von Portugiesisch-Ostafrika, fernerhin dann die ganze riesige Ebene westlich vom Wamuera- und vom Makondeplateau, einen gewaltigen[S. 90] See bilden. Über dessen Oberfläche würden hier im Westen lediglich diese klobigen, plumpen Gneiskuppen als winzige Inseln hervorragen, während nach der Küste zu die genannten Plateaulandschaften sozusagen die Kontinente auf diesem Stück Erdoberfläche darstellen würden.
Im allgemeinen sind diese Inselberge völlig regellos über das ganze, weite Land zerstreut. Klettere ich auf eine der kleinen Kuppen unmittelbar hinter meinem Wohnhaus, so vermag ich nach Norden, Westen und Süden eine fast unabsehbare Schar dieser merkwürdigen Gebilde zu überblicken. Meist liegen sie einzeln oder in Gruppen angeordnet da; nur eine Anzahl von Tagereisen weiter im Westen häufen sie sich in der Madjedjelandschaft in dichter Scharung zusammen. In unmittelbarster Nähe bildet dann die Massassikette die andere Ausnahme. Der Regellosigkeit der Anordnung entspricht auch eine große Verschiedenheit der Höhe; viele dieser Kuppen sind nur winzige Hügel; andere wieder ragen steil und unvermittelt noch 500 Meter und mehr über die hier bei Massassi schon reichlich 400 Meter hochgelegene Ebene empor. Damit erreichen also die höchsten dieser Berge die Höhen unserer deutschen Mittelgebirge.
Über die Entstehung dieser seltsamen Bergformen habe ich als Nichtgeologe natürlich kein Urteil. Nach Bornhardt, der in seinem großartigen Werke „Zur Oberflächengestaltung und Geologie Deutsch-Ostafrikas“ (Berlin 1900) die erdgeschichtlichen Züge dieses Landschaftsbildes in bewunderungswürdiger Plastik geschildert hat, sind alle diese Inselberge Zeugen eines uralten und niemals unterbrochenen Kampfes zwischen der aufbauenden Tätigkeit des Meeres und der abflachenden, nagenden, grabenden, erniedrigenden Wirkung des fließenden Wassers und der Atmosphärilien. Er sieht diese Gegend zur Primordialzeit als eine ungeheure Ebene lückenlosen Urgneises. In sie gruben die Bäche und Flüsse im Laufe der Zeit ihre Täler, alle in mehr oder weniger gleicher Richtung. Es blieben also nach Ablauf dieses langdauernden Prozesses langgestreckte Bergrücken zwischen jenen einzelnen Tälern stehen.[S. 91] Dann kam aber eine andere Zeit: an die Stelle der Zerstörung trat die der Auflagerung; wo vordem Regen, Quellen, Bäche und Ströme das zerkleinerte und zersetzte Gestein abwärts und meerwärts getragen hatten, flutete jetzt das Meer selbst; es füllte die Täler wieder aus und deckte auch wohl den ganzen, alten Schauplatz mit seinen Sedimenten zu. Diese Sedimente wurden im Laufe weiterer Zeiträume selbst wieder zu hartem Gestein. Und abermals wechselte die Szenerie; wieder lag der Boden trocken, und wieder konnten Wind, Regen und strömendes Wasser ihr Zerstörungswerk beginnen. Aber sie arbeiteten diesmal in anderer Richtung; hatten sie den Detritus vordem nach Norden oder Süden geführt, so schleppten sie ihn diesmal rechtwinkelig dazu nach Osten. Und sie feilten und feilten, trugen die ganze Oberdecke ab und zernagten auch die langen Rücken, die als Reste der ersten Zerstörungsperiode noch übriggeblieben waren. Und als sie schließlich auch dieses Urgestein bis zur Sohle der ersten Täler hinweggenagt hatten, siehe, da zeigte sich, daß als kümmerlicher Rest der alten, stolzen Gneisdecke lediglich diese in den Kreuzungspunkten der beiden Abrasions- und Erosionsrichtungen gelegenen festen Kerne übriggeblieben waren. Das sind eben diese Inselberge. Die Bornhardtsche Theorie ist kühn; auch setzt sie ganz unmeßbare Zeiträume voraus, aber sie ist als der plausibelste von allen Erklärungsversuchen allgemein angenommen worden. In jedem Fall ist sie ein glänzender Beweis der Kombinationsgabe deutscher Gelehrter.
Mit ihrem ungemein steilen Anstieg und der Unmittelbarkeit, mit der diese wuchtigen Steinmassen der Ebene entsteigen, wirken alle diese Berge, wo sie auch immer erscheinen, beherrschend auf die Umgebung ein; wo sie aber so wundervoll geschlossen auftreten wie hier im Mkwera, im Massassi, Mtandi, Chironji, Kitututu, im Mkomahindo, und wie sie alle heißen die großen und die kleinen Erhebungen hier in meinem Gesichtskreis, da sind sie etwas Unvergleichliches und dem Forscher Unvergeßliches. Wird erst einmal die geplante Südbahn das Stromgebiet des Umbekuru durchschneiden, so[S. 92] wird es keinen lohnenderen Ausflugspunkt für unsere Weltreisebureaus geben als die Bergreihe von Massassi!
Auch floristisch kommt der Besucher auf seine Kosten. Weilt man erst im Schatten dieser Berge, so ist die Öde und Eintönigkeit des Pori mit einem Schlage vergessen; Pflanzung reiht sich an Pflanzung, Beet an Beet; Hirsefelder der verschiedensten Varietäten neigen ihre fruchtschweren Kolben und Rispen in dem frischen Morgenwinde, der nach der stickigen, heißen Luft des tagelangen Porimarsches eine wahre Erquickung ist. Bohnen aller Art, Kürbisse und Melonen erfreuen das Auge durch ihr frisches Grün; rechts und links vom Wege breitet der Mhogo, der Maniok, seine sperrigen Zweige. Wo aber alle jene Fruchtpflanzen noch eine Lücke gelassen haben, da klappert die Basi-Erbse in ihrer Schote. Möglich ist diese für den Süden Deutsch-Ostafrikas erstaunliche Fruchtbarkeit nur durch die geologische Beschaffenheit des Bodens. Wohin der Fuß auf der großen Barrabarra getreten ist, und wohin das Auge nördlich und südlich geschaut hat, überall ist lehmiger Sand und sandiger Lehm an der Zusammensetzung der obersten Erdschicht in erster Linie beteiligt; nur an Stellen größerer Wasserwirkung sind hie und da nackte, glatte Gneisfelsen zutage getreten, oder aber die Fußsohle ist knirschend über harte Quarzite dahingewandert. Lediglich wo diese mächtigen Gneiszeugen das Einerlei unterbrechen, da findet das den wirtschaftlichen Wert des Landes prüfende Auge sich in vollem Maß befriedigt. Gneis verwittert leicht und gibt einen guten Boden. Das haben auch die Schwarzen seit langem entdeckt, und wenn sie auch die weniger fruchtbaren Teile ihrer Heimat durchaus nicht verschmähen, so sind diese Zonen um die Gneisinseln doch stets das bevorzugte Ziel autochthoner Besiedelung gewesen. Massassi mit seiner gewaltigen, sich stundenlang hinziehenden Ausdehnung ist ein typisches Beispiel eines solchen wirtschaftlichen Verständnisses.
Bei diesem Zusammenströmen aus aller Welt ist es kein Wunder, wenn die Frage nach der Stammeszugehörigkeit der Massassileute[S. 93] ein wahres Völkerchaos zur Antwort gibt: Makua, Yao, Wangindo, einzelne Makonde, und zu alledem ein großer Prozentsatz von Küstenleuten; das sind die freiwillig hergewanderten Elemente dieses kleinen Kulturzentrums. Zu ihnen allen kommt ein Konglomerat von Stammeselementen des innersten Afrika, das hier unter dem Namen Wanyassa zusammengefaßt wird. Diese Wanyassa sind der lebende Beweis eines menschenfreundlich im höchsten Sinne gedachten Experimentes, das leider nicht in dem Umfange gelungen ist, wie es von jenen Philanthropen erwartet und erhofft wurde. Gerade der Süden des heutigen Deutsch-Ostafrika ist vor Jahrzehnten der Schauplatz des lebhaftesten Sklavenhandels gewesen; durch diese leicht gangbaren, damals noch dichtbevölkerten Gefilde hat sich der von den Arabern Sansibars und der Küste genährte und gepflegte Sklavenhandel mit Vorliebe bewegt. Die Lage von Kilwa Kiwindje an einer Meeresbucht, die so flach ist, daß wohl eine arabische Sklavendhau, nicht aber die Überwachungsschiffe sittenstrenger Mächte dort landen und ankern konnten, ist noch heute eine sprechende Erinnerung an diese dunklen Zeiten der auch sonst nicht übermäßig sonnigen Geschichte Ostafrikas.
Um das Übel an der Wurzel zu fassen und es um so sicherer auszurotten, haben englische Menschenfreunde viele Jahre hindurch die unglücklichen Opfer, die in der Sklavengabel des Weges daherkeuchten, von ihren Glaubensboten, den Missionaren, aufkaufen lassen und als freie Männer angesiedelt. Das ist vor allem im Bannkreis der Gneiskuppen von Massassi geschehen. Die christliche Welt hat die stille Hoffnung gehegt, aus jenen Befreiten dankbare Glaubensgenossen und tüchtige Menschen heranbilden zu können. Doch wenn man das Urteil erfahrener Landeskenner hört, so gehört schon eine bedeutende Dosis von Voreingenommenheit dazu, um in diesen befreiten Bekehrten etwas Besseres zu sehen, als es die übrigen Neger sind. Es ist nun einmal so und wird sich mit keinem Mittel wegleugnen lassen, daß das Christentum dem Schwarzen nicht recht „liegt“,[S. 94] viel weniger jedenfalls als der Islam, der ihm alle seine geliebten Freiheiten anstandslos beläßt.
Ich persönlich habe übrigens von irgendwelchen Nachteilen des Charakters dieser Massassileute bis jetzt nichts gemerkt; wer mit mir in Berührung gekommen ist, hat sich ebenso freundlich benommen wie alle übrigen Landeskinder. An solchen Berührungen hat es trotz der Kürze meines hiesigen Aufenthaltes bisher keineswegs gefehlt; ich habe mich mit aller Energie, der ich fähig bin, in die Arbeit gestürzt und habe die Überzeugung, daß ich bereits einen großen Teil des hiesigen Volkstums mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört habe.
Gleich der Anfang meiner Studien war außerordentlich vielversprechend. Die Missionsstation Massassi liegt eine kleine Stunde weit nord-nordöstlich von uns unmittelbar unter der Steilwand des Mtandi. Dieser Mtandi ist der imposanteste Berg in der ganzen Kette; er steigt nahezu senkrecht gleich hinter den Strohhütten der Mission in einer riesigen Wand in die Höhe, um oben, 940 Meter hoch, in einer flachen Kuppe zu endigen. Herr Bezirksamtmann Ewerbeck und ich hatten schon beim Vorbeireiten am Tage unserer Ankunft in Massassi beschlossen, diesem Mtandi einen Besuch abzustatten, und schon an einem der nächsten Tage haben wir den Plan ausgeführt. Die Sache entbehrte nicht eines gewissen Reizes; schon früh um 4½ Uhr, bei stockdunkler Tropennacht, waren wir beiden Europäer und etwa ein halbes Dutzend unserer Träger und Boys, sowie Ewerbecks Maskatesel und mein altes Maultier marschbereit. So rasch es die Dunkelheit erlaubte, ging der Zug aus der Barrabarra dahin, um in der Höhe des Mtandi links abzuschwenken. Am Fuße des Berges blieben die Reittiere nebst ihren Wärtern zurück; wir andern aber begannen unter Umgehung des Stationsgeländes unsere Kletterübung.
Für meine Afrika-Expedition hatte ich mich mit Tippelskirchschen Tropenschnürstiefeln ausgerüstet. Als ich diese in Lindi den „alten Afrikanern“ zeigte, lachten sie mich aus. Was ich denn mit der[S. 95] einen kümmerlichen Nagelreihe am Sohlenrande hier in Afrika wolle? Gleich solle ich die Dinger zum Bruder Wilhelm senden, einem Laienbruder der Benediktinermission, der sich zu Nutz und Frommen aller Europäer mit der Verbesserung lederner Gehwerkzeuge befasse. Bruder Wilhelm hat denn auch eine ganz herrliche Doppelreihe schwerer Alpennägel an meine Stiefel gesetzt, und ich habe ein Paar von ihnen am ersten Marschtage von Lindi aus getragen, — aber dann nicht mehr! Sie zogen die Füße wie Blei zur Erde, und zudem zeigte sich, daß der schwere Beschlag auf der feinsandigen Barrabarra absolut überflüssig war. Später habe ich zu meinen leichten Leipziger Schnürschuhen gegriffen, die das Marschieren zum Vergnügen machen. Hier auf den scharfen Graten des Mtandi taten mir die so schnöde behandelten Bergstiefel indessen ausgezeichnete Dienste.

Ich will die Schilderung meiner Gefühle bei jenem Aufstieg lieber übergehen! Es wurde heller und heller; wir kamen höher und höher; aber ein Vergnügen war dieses Kraxeln, einer hinter dem anderen, von Fels zu Fels und von Baum zu Baum wenigstens für uns beiden sehr behäbigen und wohlgenährten Europäer keineswegs. Wir haben uns denn auch damit begnügt, nicht die[S. 96] alleroberste Kuppe zu erreichen, sondern in einem etwas niedrigeren Vorsprung das Ziel unserer Wünsche zu sehen. Dies war verständig, denn von der erwarteten großartigen Aussicht war keine Rede; Nebel in der Höhe, Nebel auch über das ganze weite Land hin, so daß selbst die längste Expositionszeit so gut wie nichts auf meine photographischen Platten brachte.
Dieser sonst so erfolglose Aufstieg hat wenigstens ein hübsches, kleines Denkmal afrikanischer Kunst gezeitigt: eine zeichnerische Wiedergabe der kraxelnden Karawane. Umstehend ist sie. Die Steilheit des Berges deutet der schwarze Künstler ganz richtig durch die senkrechte Stellung der Weglinie an. Das Gewirr von Kreisen und Kurven am unteren Ende der Linie stellt die Missionsstation Massassi mit ihren Gebäuden dar: dem Fundament einer Kirche, die, wenn sie jemals fertig werden sollte, sämtliche bekehrten Heiden Afrikas und der umliegenden Erdteile aufzunehmen vermöchte, so riesenhaft sind die Abmessungen; dem ehemaligen Kuhstall, in dem die beiden alten Reverends nach der Zerstörung ihrer schönen, alten Gebäude durch die Majimaji ihre primitive Unterkunft gefunden haben; der Mädchen- und der Knabenschule, beides ein paar große Bambushütten im Eingeborenenstil, und den Wohngebäuden für das schwarze Lehrerpersonal und die Schüler. Das Rankengewirr am obern Ende der Linie stellt den Gipfel des Berges mit seinen Gneisblöcken dar. Die beiden obersten der kraxelnden Männer sind der Kirongosi, der landeskundige Führer, und einer unserer Leute; der dritte ist Herr Ewerbeck, der vierte bin ich. Der kaiserliche Bezirksamtmann ist kenntlich an seinen Achselstücken mit den beiden Hauptmannssternen; sie gehören zum Dienstanzug dieser Beamtenklasse. Von allen Attributen der Weißen imponieren sie den Schwarzen sichtlich am meisten, denn überall, wo z. B. Offiziere auf den in meinem Besitz befindlichen Eingeborenenzeichnungen erscheinen, ist ihr Dienstgrad unweigerlich und stets ganz richtig durch die Sterne angegeben worden. Auch in der Zahl der Chargenwinkel auf den Ärmeln der weißen und der schwarzen Unteroffiziere irren sich die schwarzen Künstler niemals.

[S. 97]
Was doch eine volle Figur macht! Ewerbeck, Seyfried und ich sind etwa gleichaltrig und verfügen auch über ungefähr dieselben Körperdimensionen. Dieser Umstand muß wohl die Veranlassung gewesen sein, daß die Einwohnerschaft von Lindi und später auch die des Innern mich ohne weiteres ebenfalls zum Hauptmann avancieren ließ; in Lindi war ich einfach der Hoffmani mpya, der neue Hauptmann. Auf dem wiedergegebenen Kunstblatt ist der Beweis für meine Beförderung zu sehen: auch mir hat der Künstler die Achselstücke verliehen. Die Figuren hinter uns beiden Europäern sind belanglos; das ist eben der Rest unserer Begleitung.
Doch nun kommt das psychologisch Seltsame: ich bin zweimal auf dem Bilde; einmal klettere ich mühselig den Berg hinan, das andere Mal stehe ich bereits in stolzer Pose oben und banne mit dem Momentverschluß in der Hand die Gefilde Afrikas auf meine Platte. Der Dreibein oben ist nämlich mein 13 × 18-Apparat; die Zickzacklinien zwischen dem Stativ sind die Verfestigungs-Messingleisten; die lange Schlangenlinie ist der dünne Gummischlauch der Momentauslösung, von der ich allerdings bei dem Nebel keinen Gebrauch machen konnte; der Photograph bin, wie gesagt, ich. Die Männer hinter mir sind meine Leibdiener, denen für gewöhnlich die zerbrechlicheren Teile des Apparates anvertraut werden.
Die zeichnerische Wiedergabe dieser Bergbesteigung ist ein ebenso anspruchsloses Geisteserzeugnis des Negerintellekts wie alle anderen; aber sie ist bei alledem ein sehr wichtiges Dokument für die Anfänge der Kunst im allgemeinen und für die Auffassungsweise des Negers im besonderen. Gerade für den Volksforscher ist auch das Unscheinbarste nicht ohne Bedeutung. Und deswegen fühle ich mich so unendlich glücklich, selbst einmal eine ganze Anzahl von Monaten in einem solchen Milieu hoffentlich recht ungestört und nach Herzenslust arbeiten zu können.
Ihren vorläufigen Abschluß hat unsere Mtandibesteigung in einem solennen Frühstück gefunden, zu dem uns die beiden Reverends[S. 98] freundlichst eingeladen hatten. Der Engländer lebt ja anerkanntermaßen zu Hause ausgezeichnet; doch auch in der Fremde, und sei es im Innern irgendeines Erdteils, weiß er sich zu helfen. Ich gewann denn auch gerade hier den Eindruck, als sei Massassi eine „sehr nahrhafte Gegend“, wie Wilhelm Raabe sagen würde. Nur Sekt gab es heute nicht; den hatte Reverend Carnon uns schon am Vortage kredenzt, und zwar in einem riesigen Wasserkruge. Sektgläser habe er nicht, meinte der freundliche Geistliche. Es ging auch so.
Das Lustigste des ganzen Mtandiunternehmens war indessen der Abschluß. In dichtem Haufen trabte die Schar der Missionszöglinge bei unserem Heimritt neben uns her. Die kleinen Kerle sahen recht kriegerisch aus; alle trugen Bogen und Pfeile und schrien lustig um die Wette. Ich konnte mir zunächst kein klares Bild von dem Sinn des ganzen Tuns machen; zu Hause, d. h. bei unserem Polizeiposten angekommen, verstand ich allerdings sehr bald, daß die Leutchen nichts anderes beabsichtigten, als mir ihre gesamte kriegerische Ausrüstung für meine ethnographische Sammlung zu überlassen! Doch beileibe nicht etwa als hochherziges Geschenk; für Schenken ist der Neger nicht; darin gleicht er unserem Bauer. Im Gegenteil, die jungen Leute verlangten geradezu phantastische Preise für ihre doch eigens für den merkwürdigen Msungu, der allen Negerplunder kauft, gefertigten Schießzeuge. Ich habe später von dem Kram erworben, was mir tauglich schien, habe es im übrigen aber doch für nötig gehalten, die Leerausgehenden vor einer Enttäuschung zu bewahren, indem ich jedem ein paar Kupfermünzen aus meinem berühmten Hellertopf zukommen ließ. Vorher habe ich jedoch erst noch ein ganz nettes Experiment gemacht, mir und meiner Wissenschaft zum Nutzen, der Negerjugend von Massassi aber zur höchsten Lust: die Veranstaltung eines wirklichen und wahrhaftigen Schützenfestes mitten im ernsten Afrika.
Die vergleichende Völkerkunde hat sich seit langem bemüht, alle technischen und geistigen Tätigkeiten des Menschen zu klassifizieren[S. 99] und zu analysieren. So hat der Amerikaner Morse schon vor Jahrzehnten festgestellt, daß die Menschheit, soweit sie mit Bogen schießt oder je geschossen hat, sich ganz bestimmter Spannweisen bedient. Es gibt etwa ein halbes Dutzend verschiedene Arten, die über den Erdball derartig verteilt sind, daß hier und da ganz große Provinzen einer einheitlichen Spannmethode feststellbar sind, während anderswo die schärfsten Unterschiede von Volk zu Volk und von Stamm zu Stamm bestehen.
„Aber, Herr Professor,“ höre ich in diesem Augenblick im Geiste einen meiner Leipziger Hörer einwerfen, „Bogenspannen ist doch Bogenspannen; was sollen denn da für Unterschiede bestehen?“
„Hier, mein Herr,“ antworte ich, „bitte schießen Sie einmal, aber mit Vorsicht; bringen Sie Ihren Nachbar nicht um und sich selbst auch nicht!“ Wie oft schon habe ich während meiner Dozentenzeit dieses Experiment gemacht, und wie übereinstimmend ist jedesmal das Ergebnis gewesen! Man kann tausend gegen eins wetten, daß jeder Deutsche — die Engländer und Belgier nehme ich aus; diese Völker schießen heute sportmäßig und mit Verständnis mit dem Bogen und wissen eine gute Spannweise wohl von einer schlechten zu unterscheiden —, wenn er den Bogen in die Linke genommen hat und mit der Rechten Pfeil und Sehne erfaßt, das untere, mittels der Kerbe auf der Sehne ruhende Pfeilende zwischen Daumen und Zeigefinger ergreift und nunmehr die Sehne erst indirekt mittels des Pfeiles zurückzieht. Das ist dieselbe Methode, mit der wir als Knaben den Flitzbogen gespannt haben. Diese Spannweise ist die denkbar schlechteste. Davon kann sich jeder, der die anderen Methoden ebenfalls beherrscht, bei jedem Schuß überzeugen. Es liegt ja auch nahe, daß der Pfeil den Fingern bei stärkerem Zurückziehen entgleiten muß. Der beste Beweis für die Minderwertigkeit gerade dieser Spannart ist ihre geringe Verbreitung innerhalb desjenigen Teils der Menschheit, der den Bogen noch als wirkliche und wehrhafte Waffe, sei es zum Krieg, sei es zur[S. 100] Jagd, benutzt. Diese Völker und Stämme handhaben ihre Waffen ganz anders. Nur wo der Bogen zu einem Überlebsel geworden ist wie z. B. bei uns, d. h. wo er aus dem Kranz der Manneswehr durch vollkommenere Waffen verdrängt worden ist, und wo er seine ehemalige Berechtigung nur noch als Spielzeug bei dem konservativsten Teil unserer Spezies, beim Kinde, dartut, da ist diese zum wirksamen Schuß gänzlich unbrauchbare Spannweise aus Unkenntnis einer bessern im Gebrauch.
Wäre ich gezwungen, die Missionsjugend von Massassi als Kulturmaßstab zu betrachten, so müßte ich sagen: auch beim Neger ist der Bogen ein Überlebsel, denn von dem ganzen großen Haufen schossen neun Zehntel in derselben Weise wie unsere Knaben. Doch mit einem Unterschiede: wir halten unseren Flitzbogen wagerecht, die Negerknaben hielten ihn senkrecht; der Pfeil lag links vom Bogen und lief zwischen Zeige- und Mittelfinger hindurch. Nur das restliche Zehntel schoß mit anderer Spannung; es waren bezeichnenderweise lauter ältere Zöglinge, die also augenscheinlich noch eine bestimmte Dosis altafrikanischen Konservativismus mit in ihr Christentum hinübergerettet hatten.
Bei meinem Preisschießen kam es mir weniger auf die Treffergebnisse an als auf die Beobachtung der Spannmethoden; trotzdem, muß ich sagen, zogen sich die kleinen Schützen ganz gut aus der Affäre. Zwar schossen sie nur auf geringe Entfernungen; auch war mein Ziel nicht gerade klein, bestand es doch aus einer Nummer der „Täglichen Rundschau“, aber die Mehrzahl blieb doch innerhalb der rasch auf diese improvisierte Scheibe gemalten Ringe. Und stolz waren sie auch, die kleinen Schützen; wenn ich einen besonders guten Schuß laut über das Blachfeld hin lobte, blickte der schwarze Held triumphierend im Kreise umher.
„Nun bitte, Herr Professor, die anderen Spannmethoden!“ höre ich wieder meine getreuen Schüler mir zurufen. In Leipzigs Hörsälen muß ich in solchen Fällen natürlich sofort Rede und Antwort[S. 101] stehen. Afrika ist in dieser Beziehung toleranter; hier blüht mir die Freiheit, vom Recht des Forschers Gebrauch zu machen und an der Hand vieler anderen Beobachtungen Material zu sammeln. Ich antworte also mit höflicher Bestimmtheit: „Wenn ich die ganze Ebene nördlich vom Rovuma abgegrast haben werde und dann schließlich auf dem kühlen Makondeplateau die Muße finde, auf meine so vielseitigen Studien zurückzublicken, dann will ich mich ernsthaft bemühen, Ihre Wißbegier auch in dieser Richtung zu befriedigen. Also auf Wiedersehen, meine Herren!“
[S. 102]
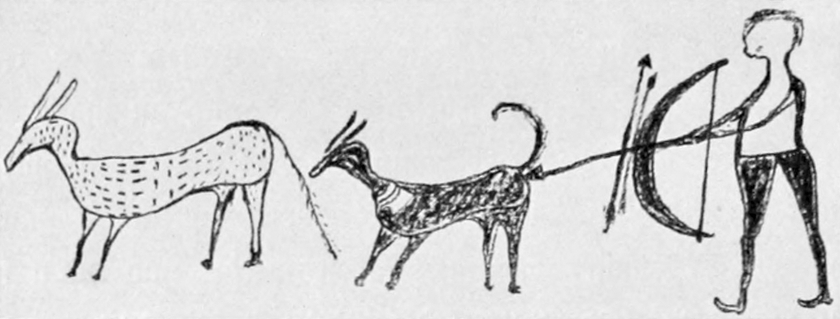
Massassi, Ende Juli 1906.
Jeder normale Mensch ist ein wandelnder Beweis für die Wahrheit der Anpassungstheorie; ich bin noch kaum zwei Monate im Lande Afrika und nur erst den Bruchteil eines Monats im Innern, und doch fühle ich mich hier schon ganz heimisch. Was blieb mir auch anderes übrig! Schon am 21. Juli, also nach einem Zusammenleben von nur wenigen Tagen, ist Herr Ewerbeck in aller Herrgottsfrühe und unter dem Schein einer durch das Dunkel der Tropennacht vorangetragenen Laterne von dannen marschiert, um daheim in Lindi der höhern Pflicht des Empfangs der acht Reichstagsabgeordneten obzuliegen, von deren kühnem Reisemut unsere Tagespresse seit Monaten widerhallt.
Als einziger Rest europäischer Kultur ist nur Nils Knudsen zurückgeblieben. Schon der Name besagt, daß wir es mit einem nordischen Recken zu tun haben; Nils ist denn auch in der Tat der hochblonde Nachkomme der alten Wikinger. Der Expedition hatte er sich hinzugesellt, ohne daß ich viel von der Anwesenheit eines dritten Europäers gemerkt hätte. Während Ewerbeck und ich[S. 103] stolz und kühn an der Spitze unserer langen Karawane marschierten oder ritten, hielt Nils Knudsen sich meist an deren Ende auf; im Lager aber blieb er bescheiden im Hintergrunde. Jetzt, im Standort Massassi, ist er von Amts wegen in den Vordergrund gerückt worden; er soll hier nach dem Rechten sehen und den schwarzen Lokalbehörden etwas auf die Finger passen. Ob das nötig ist, kann ich einstweilen nicht entscheiden, da ich in die Schwierigkeiten der innern Verwaltung eines so großen Bezirks, wie es der von Lindi ist, noch keinerlei Einblick habe; aber die Maßnahme wird schon richtig sein, sonst hätte ein so alter Landeskenner wie Ewerbeck sie nicht getroffen. Einstweilen habe ich Knudsen veranlaßt, den Wohnsitz in seinem Zelt, das, nach seinem ehrwürdigen Äußern zu urteilen, schon Vasco da Gama bei seiner Landung an der Ostküste Afrikas benutzt und wegen Schadhaftigkeit zurückgelassen hat, aufzugeben und zu mir in das Rasthaus zu ziehen. Jetzt haust er mit seiner kümmerlichen Habe, die aus zwei anscheinend nicht einmal ganz gefüllten, alten Blechkoffern besteht, auf der einen Seite des großen Raumes, während ich mit meiner fürstlichen Ausstattung auf der andern residiere. Dafür ist aber das Herz des blonden Norwegers um so goldener und sein Gemüt um so reicher.
Das Vorleben Knudsens ist abenteuerlich genug; es erinnert mich einigermaßen an das Schicksal jenes englischen Matrosen, der vor 100 Jahren unter die Eingeborenen Süstostaustraliens verschlagen wurde und als Wilder unter Wilden leben mußte. Ganz so schlimm ist es zwar mit meinem blonden Nachbar nicht gewesen, aber Zeit zum Vernegern hätte er doch schon genug gehabt. Soweit ich mich bisher über seine Personalien habe unterrichten können, ist Knudsen vor fast einem Jahrzehnt von einem Kauffahrteischiff, wo er als Schiffsjunge amtierte, in einem Hafen Madagaskars ausgerissen, hat sich dann einige Jahre lang auf dieser großen Insel umhergetrieben und ist schließlich an die gegenüberliegende Festlandsküste in das Hinterland von Lindi verschlagen worden. Ein eigentliches Handwerk hat[S. 104] er nach seiner eigenen Aussage nicht erlernt, er rühmt aber von sich, alles zu können, mauern und zimmern, schnitzen und bauen, tischlern und schlossern. Tatsächlich hat er alle Gebäude des Bergbaufelds Luisenfelde weit im Süden in der Nähe des Rovuma, zu dem ich vielleicht auch noch einmal kommen werde, gebaut, war dort überhaupt Faktotum, und auch die Kommune Lindi hat ihn der Anstellung als Leiter der Handwerkerschule für würdig erachtet. In dieser Stellung befindet sich Knudsen augenblicklich; er ist nur beurlaubt.
Meine Lebensweise ist hier, im Zustande der Ruhe, natürlich eine wesentlich andere als auf dem Marsch. Jedes Marschleben ist reizvoll, um wieviel mehr ein solches innerhalb einer fremdartigen und vordem ungekannten Natur. Das meinige ist zudem bisher ganz ungetrübt verlaufen. In unsern afrikanischen Reiseschilderungen beginnt fast jede Expedition mit tausend Schwierigkeiten; der Abmarsch ist auf eine bestimmte Stunde festgesetzt, aber es ist kein Träger da; und hat der Expeditionsleiter seine Leute schließlich mit Mühe beisammen, so haben diese noch hunderterlei Verrichtungen und sind schon am ersten Abend den Blicken des Reisenden von neuem entschwunden. Der Abschied von der Bibi, der Frau, der Geliebten, ist ja auch zu schwer. Bei mir hat der Betrieb vom ersten Tage an funktioniert; die viertelstündige Verspätung beim Aufbruch von Lindi fällt niemand als mir selbst zur Last, der ich mich beim Frühstück verspätet hatte. Am Morgen des zweiten Marschtages ging es dann mit dem Zusammenlegen des Zeltes seitens der Askari noch nicht so recht; auch konnte Moritz die Tippelskirchsche Reiselampe mit dem besten Willen nicht in ihren allerdings sehr knapp bemessenen Behälter verpassen; aber seitdem haben wir Reisenden uns alle benommen, als wenn wir schon seit Monaten unterwegs gewesen wären.
Wer etwa nach englischer Sitte schon in der Morgenfrühe ein substanzielles Mahl einzunehmen gewohnt ist, soll in Afrika nicht auf die Reise gehen. Um 5 Uhr hat man das Wecken angeordnet. Pünktlich ruft der Posten sein leises: „Amka, bwana, wach auf,[S. 105] Herr“ in das Zelt; mit beiden Füßen schnellt man sich elastisch über den hohen Rand des trogförmigen Feldbettes hinüber und fährt in sein Khaki. In der kalten Nacht der tropischen Trockenzeit ist das Wasser, welches Kibwana, der das Amt des Stubenmädchens versieht, fürsorglich schon am Abend vor dem Zelt bereitgestellt hat, zu einem erfrischenden Naß abgekühlt; scharf hebt sich die Silhouette des Europäers bei der Toilette im Schein der brennenden Lampe von der Zeltwand ab. Doch diese Lampe leuchtet nicht ihrem Herrn allein; ringsum treffen ihre Strahlen braune, glänzende Gesichter. Das sind die Träger und die Askari, von denen jene eifrigst bemüht sind, ihre Last für den Marsch zusammenzuschnüren, während die Soldaten sich auf das Zelt stürzen wie der Tiger auf seine Beute, sobald der Weiße fertig gekleidet ins Freie tritt. Im Nu ist es zusammengelegt; kein Wort fällt dabei, und kein überflüssiger Handgriff wird dabei getan; es ist Arbeitsteilung im besten Sinn und in tadellosester Durchführung. Unterdessen steht der Weiße an seinem zusammenlegbaren Tisch; in Hast und Eile nimmt er einen Schluck Tee oder Kakao, oder was sonst sein Leibgetränk ist, kaut dazu ein Stück selbstgebackenen Brotes und steht nun marschbereit da. „Tayari, fertig?“ schallt seine Frage laut über den Platz; „bado, noch nicht“, ertönt es unweigerlich zurück. Und es sind immer dieselben Faulen oder Ungeschickten, deren Munde dieses Lieblingswort jedes afrikanischen Bediensteten entströmt. Der Anfänger im Reisen läßt sich wohl dadurch beirren; nach ein paar Tagen kehrt er sich nicht mehr an das bado; er ruft sein „Safari!“ (wörtlich „Reise“), oder, wie ich es sehr bald eingeführt habe, sein „Los!“ über die Schar seiner Mannen hin, schwingt seinen Wanderstab unternehmend durch die Luft, dadurch den beiden Spitzenaskari die Marschrichtung andeutend, und das Tagewerk hat begonnen.
Ich weiß nicht, wie andere Stämme und Völkerschaften sich im Moment des Aufbruchs verhalten; meine Wanyamwesi sind in diesem Augenblick außer Rand und Band. Mit sichtlicher Mühe hat[S. 106] jeder seine Last auf den Kopf oder die Schulter hinaufgebracht; gebückt von ihrer Schwere, steht jeder an seinem Platz. Da ertönt jenes Kommando „Safari“, und nun erhebt sich ein Lärm und Getöse, das jeder Beschreibung spottet; was aus der Kehle heraus will, hallt in den schweigenden Urwald hinaus; wild und regellos schmettern derbe Stöcke gegen die Reisekisten und leider auch gegen die Blechkoffer, die einen nur zu guten Resonanzboden abgeben. Es ist ein Höllenspektakel; aber er ist ein Ausbruch der Lust und der Freude; es geht vorwärts, und Wandern und Marschieren ist nun einmal das Lebenselement des Mnyamwesi. Schon nach kurzer Zeit kommt Ordnung in das Chaos der Lärmgeräusche; die Leute haben einen unendlich feinen Sinn für Takt und Rhythmus, und so löst sich das Getöse alsbald in eine Art getrommelten und gesungenen Marsches auf, der auch die Beine der Askari, die in ihrer vornehmen Reserve sich natürlich an solch kindischem Tun nicht beteiligen, in seinen Bann zwingt.

Ach, und schön ist der frühe Tropenmorgen. Es ist mittlerweile stark auf 6 Uhr gegangen; die dunkle Nacht ist schnell der kurzen Dämmerung gewichen; glänzende Strahlen der rasch emporsteigenden Sonne huschen über das leichte Gewölk am Firmament; unversehens steigt die Scheibe des Tagesgestirns in wunderbarer Majestät über den Horizont empor. In rüstigem, ausgiebigem Schritt, noch eng aufgeschlossen, eilt der Zug durch das taufeuchte Pori dahin; vorn, wie auf einem Kriegsmarsch, zwei Soldaten als Spitze; in einigem Abstand dahinter wir Europäer; unmittelbar nach uns die Leibdienerschaft mit Gewehr, Reiseflasche und Reisestühlchen; dann der Haupttrupp der Soldaten; dahinter der lange Zug der Träger und Askariboys; am Schluß endlich, zur Aufmunterung für alle Säumigen, doch auch zur Unterstützung etwaiger Maroder, zwei Soldaten als Nachspitze. Eine bewunderungswürdige Erscheinung ist der Mnyampara, der Trägerführer. Er bekleidet eigentlich eine Art Ehrenstellung, denn er bekommt keinen Heller mehr als der letzte seiner[S. 107] Untergebenen. Vielleicht ist dieser Ausdruck auch nicht einmal richtig; primus inter pares sollte man ihn lieber nennen. Der Mnyampara ist überall; er ist an der Spitze, wenn der Herr ihn ruft, und er ist weit hinten am äußersten Ende des mit jeder Marschstunde länger werdenden Zuges, wenn dort ein Kranker seiner Hilfe benötigt. Den stützt er; er nimmt ihm ganz ohne weiteres die schwere Last ab, um sich selbst damit zu beladen; er bringt ihn sicher ins Lager. Mit meinem Pesa mbili scheine ich einen besonders glücklichen Griff getan zu haben. Er ist jung wie die allergrößte Mehrzahl meiner Leute, vielleicht 23 bis 25 Jahre, tiefschwarz in seiner Hautfarbe; mit katzenhaft funkelnden Augen im ausgeprägten Negroidengesicht; nur mittelgroß, aber ungemein sehnig und kräftig; er spricht ein schauderhaftes Suaheli, weit schlechter als ich, und noch dazu so rasch, daß ich ihm kaum zu folgen vermag; aber er ist bei alledem ein Juwel. Nicht bloß, daß er ein unvergleichlicher Sänger ist, dessen angenehmer Bariton[S. 108] niemals ruht noch rastet, ob wir lagern oder marschieren, nein, auch in der Organisation des Lagerlebens, der Aufteilung und Anstellung seiner Leute ist er ein Meister.
Der Anforderungen gibt es genug, die an einen solchen Reisemarschall am Schluß des Tagesmarsches gestellt werden. Längst ist die herrliche Morgenkühle einer recht fühlbar hohen Temperatur gewichen; der Europäer hat seinen leichten Filzhut oder die noch leichtere Reisemütze mit dem schweren Tropenhelm vertauscht; die nackten Leiber der Träger aber überziehen sich mit einer glänzenden Politur. Sie, die schon von 4 Uhr an am Lagerfeuer fröstelnd den warmen Tag herbeigesehnt haben, haben jetzt dies Ziel ihrer Wünsche im vollsten Maße erreicht; ihnen ist sehr warm, und der Weiße tut jetzt sehr wohl daran, nicht in oder hinter der Karawane zu marschieren; er möchte sonst mehr, als ihm angenehm sein würde, Gelegenheit zu Studien über den Rassengeruch finden. Nach 2 oder 2½ Stunden erste Rast. „Kiti kidogo, den kleinen Stuhl“, ruft der Europäer nach hinten. Blitzschnell hat der Leibpage das nette, zierliche Gerät, das äußerlich einem kleinen Sägebock gleicht, das aber unter seiner obern, abknöpfbaren Sitzfläche noch eine sehr sinnreich erdachte andere, länglichoval durchbrochene Zeugfläche aufweist, die die Benutzung dieses nützlichen Möbels auch im verschwiegenen Urwalde gewährleistet, dem Europäer untergeschoben; langsam wälzt sich jetzt auch die lange Schlange der Lasten heran, um schwer von Kopf und Schulter der Leute zu Boden zu sinken. Des weißen Herrn harrt jetzt ein keineswegs opulentes Frühstück von ein paar Eiern, einem Stück kalten Fleisches, oder ein paar Bananen; die Schwarzen aber, die ganz nüchtern aufgebrochen sind, fasten auch jetzt noch unentwegt weiter. Man begreift nicht, wie die Leute die immerhin beträchtliche Arbeitsleistung eines vielstündigen Marsches unter einer 60 bis 70 Pfund schweren Last bei solcher Anspruchslosigkeit zu leisten vermögen; doch sie verlangen es gar nicht anders. In den spätern Marschstunden tritt zwar eine merkliche Ermüdung ein; der Schritt wird langsamer und kürzer, die[S. 109] Lasten bleiben auch mehr und mehr hinter der unbepackten Suite der Weißen zurück, doch wenn sie schließlich an den Lagerplatz herankommen, so sind die Leute noch ebenso vergnügt und fröhlich wie am frühen Morgen. Derselbe Lärm, dasselbe Getöse, doch jetzt ein ganz anderer Wortlaut aus den Kehlen der Sänger — alles das rasselt auf den längst dasitzenden Europäer hernieder. Meiner Truppe scheint es das Zentralmagazin zu Daressalam angetan zu haben; dort sind sie in meine Dienste getreten, und dieses weitläufige Gebäude feiern sie nunmehr auch im Schlußgesang ihres Tagemarsches.
Das Ende des Marsches bedeutet noch längst nicht den Abschluß der Obliegenheiten meiner Leute, weder der Boys, noch der Askari, noch der Träger. Prüfend hat sich der Expeditionsführer nach einem Zeltplatz umgeschaut. Ihn gut zu treffen, ist, glaube ich, eine Sache des Talents und der Begabung. Als Grundregeln sind dabei zu beachten: die Nähe trinkbaren Wassers und Abwesenheit schädlicher Insekten wie Rückfallfieberzecken, Moskitos und Sandflöhe. Sekundär, aber doch auch wichtig, ist die Festlegung der Zeltachse zur Sonnenbahn und eine möglichst anzustrebende Lage im Schatten belaubter Bäume. Ich zeichne der Einfachheit halber den Zeltgrundriß auf den sorgsam gesäuberten Sandboden, wobei ich die gewünschte Lage der Zelttür durch Unterbrechung der Linienführung andeute. Das genügt meinem kommandierenden Gefreiten vollkommen. Kaum sind die beiden Unglücklichen, deren Schultern das schwere Tippelskirchzelt drückt, herangekeucht, so sind auch schon die Lasten aufgerollt; im Nu hat jeder Krieger seinen Platz eingenommen; eins, zwei, drei stehen die beiden Tragpfähle senkrecht; dann hallen auch bereits die Schläge auf die Zeltpflöcke. Währenddem ergötzen sich Moritz und Kibwana, die beiden Boys, an meinem Bett. Diese Betätigung muß für die Neger den Himmel auf Erden bedeuten. Sie werden und werden damit nicht fertig; Schelte und selbst angedrohte Prügel nützen nichts; es ist, als ob das auch sonst schon so schwerfällig arbeitende Hirn der schwarzen Gentlemen sich hier ganz einlullte.[S. 110] Mechanisch bauen sie das Gestell auf; mechanisch breiten sie Korkmatratze und Decken aus; ebenso stumpf und dumpf errichten sie schließlich den Kunstbau des Moskitonetzes. Die Soldaten sind längst von dannen geeilt; da erst schleppen meine Herren Diener das Schlafgerät ins Zelt hinein.
Auch meinen Trägern ist inzwischen noch allerlei Arbeit erblüht. Wasser muß für die ganze Karawane geholt werden, Feuerholz für die Küche; schließlich muß auch noch jene verschwiegene Baulichkeit errichtet werden, die im Kisuaheli den Namen Choo führt. Es ist weit über Mittag geworden, da endlich kommen auch die Träger zu ihrem Recht; sie sind nunmehr Herren ihrer Zeit und können sich für ein paar kurze Stunden selbst leben. Auch jetzt schwelgen sie nicht. Der Süden Deutsch-Ostafrikas ist sehr wildarm, zudem habe ich zum Jagen keine Zeit; Fleisch ist also etwas kaum Gekanntes in dem Speisezettel meiner Leute. Ugali und immer wieder Ugali, d. h. Tag für Tag den steifen, zu einer glasigen Konsistenz eingekochten und schließlich mittels des Rührlöffels zu einer Art Puddingform zurechtgeklopften Brei aus Hirse, Mais oder Maniok, das ist das Normalgericht, um mit Oskar Peschel zu reden, auf das sich die Lebenshaltung unserer schwarzen Brüder stützt.

Hier in Massassi hat sich das Blatt gewendet; jetzt haben es meine Leute gut, während ich kaum eine Minute aus der Arbeit herauskomme. Meine Schutztruppe wohnt sehr vornehm; sie hat die Barasa, die auf Pfeilern ruhende Beratungshalle links von meinem Palais, bezogen und nach Negerart ausgebaut. Der Neger liebt keinen gemeinsamen Raum; er kapselt sich gern ein. Das ist schnell geschehen; ein paar Horizontalstangen als Baugerüst rings um die geplante Kabine; dann eine dichte Lage hohen afrikanischen Strohs daran gebunden, und ein netter, bei Tag kühler, bei Nacht warmer Raum ist für jeden einzelnen geschaffen. Die Träger dagegen haben sich auf dem weiten Platz vor meinem Hause Hütten gebaut, einfach und nett, doch zu meinem maßlosen Erstaunen ganz im Massaistil. Nichts[S. 111] von Rundhütte und nichts von Tembe, sondern wirklichen und wahrhaftigen Massaistil. Über die Rundhütte und ihre Eigenart werde ich mich später genugsam äußern können; wer aber nicht wissen sollte, wes Art eine Tembe ist, dem sage ich: das ist eine Bauart, die man sich am besten vergegenwärtigen kann, wenn man zwei oder drei oder vier gedeckte Güterwagen unserer Eisenbahnen rechtwinklig aneinanderstellt, so daß sie ein Rechteck bilden mit den Türen nach innen. Verbreitet ist diese Tembe über große Teile des Nordens und des Zentrums von Deutsch-Ostafrika, von Unyamwesi im Westen bis in die küstennahen Landschaften im Osten, und vom abflußlosen Gebiet im Norden bis nach Uhehe im Süden. Der Wohnbau der Massai endlich läßt sich am besten einem Rohrplattenkoffer mit seinen abgerundeten Vorder- und Hinterkanten vergleichen. Während nun die Massai bekanntermaßen baumlange Kerle sind, sind ihre Hüttchen, die ganz im Sinne ihrer Erbauer als eines Volkes von Viehzüchtern par excellence nett und geruchvoll mit Kuhdung beworfen werden, so niedrig, daß auch ein normal gewachsener Mensch in ihnen nicht stehen kann. Solches tun auch meine Wanyamwesi in ihren leichten Strohbauten nicht;[S. 112] dafür liegen und lungern sie den ganzen Tag faul auf ihren Strohschütten herum.
Um so fleißiger bin ich. Der Tropentag ist kurz, er mißt jahraus jahrein nur 12 Stunden; deshalb heißt es, ihn ausnutzen. Um Sonnenaufgang, also 6 Uhr, ist schon alles auf den Beinen; rasch ist das Frühstück erledigt; dann gehts ans Tagewerk. Es beginnt kurios genug. Wohl jeder Führer einer Afrika-Expedition hat die Erfahrung gemacht, daß die Landeskinder in ihm einen der Heilkunst kundigen Helfer sehen; in langer Reihe stehen denn auch bei mir allmorgendlich die Patienten da. Zu einem Teil gehören sie der Schar meiner eigenen Leute an, zum anderen sind es Einwohner aus der näheren und weiteren Umgebung von Massassi. Einem meiner Träger ist es schlimm ergangen. Die beliebteste Form der Trägerlast ist in Ostafrika die amerikanische Petroleumkiste. Das sind leichte, aber festgebaute Holzbehälter von etwa 60 cm Länge und 40 cm Höhe bei 30 cm Breite. Ursprünglich haben sie zwei sogenannte Tins mit amerikanischem Petroleum enthalten, sehr stattliche Blechgefäße von quadratischem Querschnitt, die jenen Kisten längst entfremdet sind, um im Haushalt der Suaheli ein hochgeachtetes Dasein als Gebrauchsgefäße für alles zu spielen. In der Tat steht die Küstenkultur offenkundig unter dem Zeichen dieses Blechgefäßes; Tins überall, in der Markthalle, auf den Straßen, vor den Hütten und in den Hütten; selbst das Klosett für die Farbigen auf unserem Dampfer „Rufidyi“ enthielt als wesentlichsten Bestandteil lediglich einen solchen Tin.
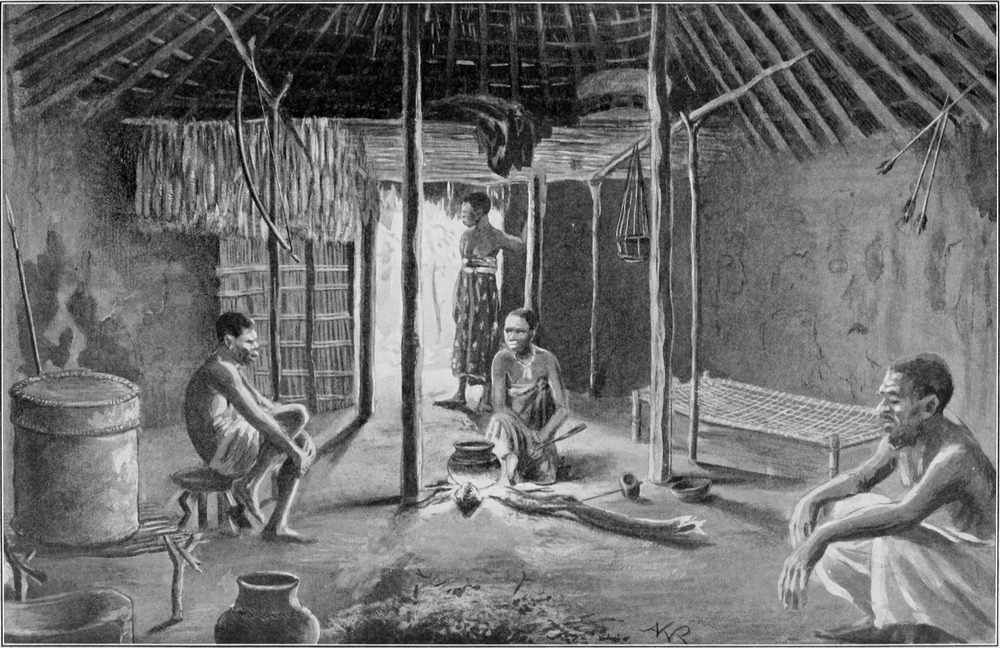
Nur eine meiner Kisten war noch ihrer ersten Bestimmung treu geblieben; in ihrem Bauche wanderten zwei bis an den Rand mit Petroleum gefüllte Blechgefäße auf der Schulter des Mnyamwesi Kasi Uleia (zu deutsch etwa „er nimmt Arbeit beim Europäer“) von der Küste ins Innere. Rüstig schreitet der Wackere vorwärts. „Es ist warm,“ denkt er, „ich fange an zu schwitzen. Na, das schadet weiter nichts, das tun die andern auch.“ — „Ach, es ist doch wirklich sehr warm,“ sagt er nach einiger Zeit halblaut vor sich[S. 113] hin, „selbst mein mafuta ya uleia, mein Petroleum, fängt an zu riechen.“ Es riecht auch immer weiter; der Träger wird naß und nässer. Schließlich ist der Tagemarsch zu Ende, und Kasi Uleia setzt seine duftige Last mit einem doppelten Gefühl der Erleichterung zur Erde. Leicht ist ihm einmal durch die Erlösung von dem sogar für eine Negernase starken Geruch; sodann ist auch seine Last selbst im Laufe des mehr als sechsstündigen Marsches seltsamerweise immer leichter geworden. Endlich dämmert dem guten Schwarzen und seinen Freunden die Wahrheit auf; es ist nur gut, daß sie keine Streichhölzer besitzen; wäre eins von ihnen in Kasi Uleias Nähe entzündet worden, der ganze Kerl wäre in Flammen aufgegangen, so durchtränkt war der Ärmste mit dem Leuchtmaterial des Herrn Rockefeller.
Entweder muß man es als Beweis höchster Disziplin oder höchsten Stumpfsinns betrachten, Tatsache ist, daß dieser Träger sich nicht etwa gleich am ersten Tage, wo er und seine Freunde die Undichtigkeit eines der beiden Blechgefäße entdeckt hatten, bei mir meldete, sondern daß er in aller Seelenruhe seine fröhlich weiterrinnende Petroleumquelle am nächsten Frühmorgen von neuem aufgenommen und ohne Murren bis zum Halteplatz weiter getragen hat. Auch jetzt hat er wieder förmlich in Petroleum geschwommen; dies hätte Kasi Uleia in seiner Gemütsruhe auch jetzt nicht gestört, hätten sich nicht bereits die ersten Anzeichen eines Ekzems bemerkbar gemacht, das ihn doch etwas beunruhigte. So kam er denn endlich an und sagte, was eben jeder Neger sagt, wenn ihm etwas fehlt und er vom alles vermögenden Weißen Hilfe erheischt: „Daua, bwana, Medizin, Herr“, und wies mit bezeichnender, aber keineswegs entrüsteter Gebärde auf seinen körperlichen Zustand hin. Zu allererst hielt ich hier eine tüchtige Seifenkur für angebracht, einmal des Petroleums wegen, sodann auch, um den Schmutzüberzug, der sich während des siebentägigen Marsches auf dem Körper des sonst außerordentlich reinlichen Trägers abgelagert hatte, zu entfernen. Später habe ich den Mann mit Lanolin behandelt, von dem ich zum Glück eine ungeheuer[S. 114] große Büchse mitgenommen habe. Jetzt ist der Patient allmählich wieder von seinem Leiden befreit.
Auch die Gelegenheit, von den verheerenden Wirkungen des Sandflohes einen schwachen Begriff zu bekommen, habe ich bereits hier in Massassi gehabt. Einer der Askariboys, ein baumlanger Maaraba aus dem Hinterlande von Ssudi, tritt allmorgendlich an, um für seine stark angefressene große Zehe die übliche Daua zu empfangen. Ich bin in der höchst merkwürdigen Lage, einstweilen nicht einmal Sublimat und Jodoform in meiner Apotheke zu besitzen, sondern lediglich über Borsäure in Tabletten zu verfügen. Es muß auch mit dieser gehen, und geht auch, nur müssen sich meine Patienten wohl oder übel an eine etwas hohe Temperatur meines schwachen Desinfektionsmittels gewöhnen. Bei solchen gleichgültigen Patronen wie diesem Maaraba, der den Verlust seines Zehennagels — dieser ist gänzlich verschwunden; an seiner Stelle breitet sich eine große, völlig vereiterte Wunde aus — lediglich seiner negroiden Gleichgültigkeit zuzuschreiben hat, ist übrigens das heiße Wasser gleichzeitig ein sehr verdientes Strafmittel. Der Bursche brüllt jedesmal, als wenn er am Spieße stäke, und schwört, er wolle von nun an aber ganz genau auf den funsa, den Sandfloh, Obacht geben. Zur Verfestigung seiner löblichen Vorsätze bekommt er dann von seinem Herrn und Gebieter, den das kindische Gebaren des Riesen weidlich ärgert, ein paar derbe, aber gutgemeinte Püffe.
Über den Gesundheitszustand der hiesigen Eingeborenen will ich mich einstweilen lieber noch nicht auslassen; das wenige, was ich in der kurzen Zeit hier in meiner Morgensprechstunde an hygienischer Vernachlässigung und hygienischem Unvermögen gesehen habe, läßt in mir den Entschluß reifen, erst noch andere Bezirke in dieser Richtung zu studieren, bevor ich mir ein Urteil bilde und es auch ausspreche. Nur soviel sei bereits hier gesagt: so glänzend wie wir es uns daheim in unserem überfeinerten Kulturleben gemeiniglich vorstellen, ist die Widerstandsfähigkeit des Negers gegen die Angriffe[S. 115] seines heimtückischen Erdteils durchaus nicht, und vor allem scheint eine Kindersterblichkeit zu herrschen, von deren Höhe wir uns gar keine Vorstellung machen können. Ach, ihr Ärmsten! muß man angesichts dieses Elends ausrufen.
Nach der Sprechstunde hebt das eigentliche Tagewerk an; dann ziehe ich als Diogenes durchs Land. Die ersten Tage bin ich nur mit einer Schachtel „Schweden“ bewaffnet in die Hütten der Eingeborenen gekrochen. Das war recht romantisch, doch nicht zweckentsprechend. Ich habe mir nie einen Begriff von der ägyptischen Finsternis des Alten Testaments machen können; jetzt weiß ich, daß die Benennung eines besonders hohen Ausmaßes von Lichtmangel nach dem Lande der Pharaonen nur ein pars pro toto ist; sie ist dem ganzen Erdteil eigen und ist hier in der Tiefebene im Westen des Makondeplateaus in allererster Qualität zu haben. Die Negerhütten sind nämlich ganz fensterlos. Das mag uns rückständig erscheinen, ist jedoch der Ausfluß einer langen, langen Erfahrung. Der Schwarze will sein Haus kühl haben; das kann er nur erzielen durch den Abschluß jeder Außentemperatur. Deswegen öffnet er auch so ungern Vorder- und Hintertür seines Heims, und aus dem gleichen Grunde reicht das schwere Strohdach weit über die Hauswand hinaus nach außen und unten.
Meine Stallaterne, vom Knaben Moritz morgens oder nachmittags brennend durchs Land getragen, macht den Eingeborenen viel Spaß; es ist ja auch etwas Absonderliches, gegen den Glast der strahlenden Tropensonne mit einem solch kümmerlichen Beleuchtungsapparat ankämpfen zu wollen. Um so mehr am Platz ist sie nachher im Dunkel des Hauses. Höflich habe ich oder Herr Knudsen den Besitzer gefragt, ob er gestattet, sein Haus zu besichtigen; ebenso höflich ist die Genehmigung erfolgt. Das ist dann ein lustiges Suchen in den Zimmern und Verschlägen, aus denen sich zu meiner Überraschung das Heim der hiesigen Schwarzen zusammensetzt. Die Räume sind nicht elegant, diesen Begriff kennt der Neger einstweilen noch nicht, aber[S. 116] sie geben ein unverfälschtes Zeugnis von der Lebensführung ihrer Insassen. In der Mitte des Hauses, zwischen den beiden Haustüren, die Küche mit dem Herde und den zum Haushalt zunächst nötigen Gerätschaften und Vorräten. Der Herd der Inbegriff der Einfachheit: drei kopfgroße Steine oder wohl gar nur Kugeln von Termitenerde, im Winkel von je 120 Grad zueinander gelagert. Darauf über schwelendem Feuer der große irdene Topf mit dem unvermeidlichen Ugali; andere Töpfe ringsum; dazwischen Schöpflöffel, Rührlöffel, Quirle. Über dem Herde, aber noch im Vollbereich seines Rauches, ein Gerüst von vier oder sechs gegabelten Stangen. Auf seinen Latten liegen Hirseähren in dichter, gleichmäßiger Lagerung; unter ihnen hängen, wie auf der Räucherkammer unserer deutschen Bauern die Schlack-, Blut- und Leberwürste, zahlreiche Maiskolben von außergewöhnlicher Größe und Schönheit, die jetzt bereits von einer glänzend schwarzen Rauchkruste überzogen sind. Wenn diese nicht vor Insektenfraß schützt, etwas anderes tut’s sicher nicht. Das ist denn auch der Endzweck dieses ganzen Verfahrens. Bei uns zulande, im gemäßigten Europa, mag es eine Wissenschaft sein, das Saatkorn keimfähig bis zur nächsten Saatperiode zu erhalten; hier im tropischen Afrika mit seiner alles durchdringenden Luftfeuchtigkeit, seinem alles zerstörenden Reichtum an Schädlingen, endlich seinem Mangel an geeignetem, dauerhaftem Baumaterial, ist dieses Hinüberretten der Aussaat eine Kunst. Es wird nicht meine undankbarste Aufgabe sein, diese Kunst in ihren Einzelheiten gründlich zu studieren.
Auch über die Wirtschaft meiner Neger, ihren Kampf mit der widerstrebenden Natur Afrikas und ihre Fürsorge für den morgenden Tag will ich mich erst später, nachdem ich mehr von Land und Leuten gesehen habe als bis jetzt, auslassen. In der völkerkundlichen und auch der nationalökonomischen Literatur gibt es eine lange Reihe von Werken, die sich mit der Klassifikation der Menschheit nach ihren Wirtschaftsformen und Wirtschaftsstufen befassen. Selbstverständlich nehmen wir die alleroberste Stufe ein; wir haben ja die Vollkultur auf allen[S. 117] Gebieten gepachtet; darin sind alle Autoren einig. In der Unterbringung der übrigen Menschenrassen und Völker gehen sie dafür um so weiter auseinander; es wimmelt von Halbkulturvölkern, seßhaften und nomadischen, von Jäger-, Hirten- und Fischervölkern, von unsteten und Sammlervölkern; die eine Gruppe übt ihre Wirtschaftskünste auf Grund traditioneller Überlieferung aus, eine andere kraft des angeborenen Instinkts; schließlich erscheint sogar eine tierische Wirtschaftsstufe auf der Bühne. Wirft man alle diese Einteilungen in einen gemeinsamen Topf, so entsteht ein Gericht mit vielen Zutaten, aber von geringem Wohlgeschmack. Sein Grundbestandteil läuft im großen und ganzen darauf hinaus, gerade die Naturvölker weit zu unterschätzen. Wenn man jene Bücher liest, so hat man das Gefühl, daß zum Beispiel der Neger direkt von der Hand in den Mund lebe und daß er in seinem göttlichen Leichtsinn nicht einmal für den heutigen Tag sorge, geschweige denn für den anderen Morgen.
In Wirklichkeit ist es ganz anders, anderswo wie auch hier. Und gerade hier. Für unsere intensive norddeutsche Landwirtschaft charakteristisch sind die regellos über die Feldmarken verteilten Feldscheunen und die neuerdings stets gehäuft erscheinenden Diemen oder Mieten; beide haben seit dem Aufkommen der freibeweglichen Dreschmaschine die alte Hofscheune stark entlastet, ja beinahe überflüssig gemacht. Das Wirtschaftsbild meiner hiesigen Neger unterscheidet sich von jenem deutschen nur dem Grade nach, nicht im Prinzip; auch hier Scheunen en miniature regellos über die Schamben, die Felder, verteilt, und andere Vorratsbehälter in meist erstaunlicher Anzahl und Größe neben und im Gehöft. Und leuchtet man das Innere des Hauses selbst ab: auch dort in allen Räumen große, mittels Lehm dicht und hermetisch geschlossene Tongefäße für Erdnüsse, Erbsen, Bohnen und dergleichen, und sauber gearbeitete, meterhohe Zylinder aus Baumrinde, ebenfalls lehmüberzogen und gut gedichtet, für Maiskolben, Hirseähren und andere Getreidesorten. Alle diese Vorratsbehälter, die draußen im Freien stehenden wie die im Hause selbst untergebrachten, stehen zum Schutz[S. 118] gegen Insektenfraß, Nagetiere und Nässe auf Pfahlrosten, Plattformen von 40 bis 60 Zentimeter Höhe, die aus Holz und Bambus gefertigt und mit Lehm bestrichen sind. Das Ganze ruht auf gegabelten, kräftigen Pfählen.
Die freistehenden Vorratsbehälter sind oft von sehr erheblichen Dimensionen. Sie gleichen mit ihrem weitausladenden Strohdach riesigen Pilzen, sind entweder aus Bambus oder aus Stroh hergestellt und innen und außen stets mit Erde ausgestrichen. Einige besitzen in der Peripherie eine Tür, ganz in der Art unserer Kanonenöfen; bei anderen fehlt dieser Zugang. Will der Herr von ihrem Inhalt entnehmen, so muß er zu dem Zweck das Dach lupfen. Dazu dient ihm eine Leiter primitivster Konstruktion. Ich habe manch eine von ihnen skizziert, doch hat mir jede ein stilles Lächeln entlockt: ein paar ästige, krumm und schief gewachsene Stangen als Längsbäume; in meterweitem Abstand darangebunden ein paar Bambusriegel — das ist das Beförderungsmittel des Negers zu seinem Wirtschaftsfundament. Trotz seiner Ursprünglichkeit ist es indessen doch der Beweis einer gewissen technischen Erfindungsgabe.
Ein uns Europäer sehr anheimelnder Zug in der Wirtschaft der hiesigen Neger ist die Taubenzucht; kaum ein Gehöft betritt der Besucher, ohne auf einen oder mehrere Taubenschläge zu stoßen. Sie sind anders als in Uleia, doch auch sie sind durchaus praktisch. Im einfachsten Falle nisten die Tiere in einer einzelnen Röhre aus Baumrinde. Diese ist der Rindenmantel eines mittelstarken Baumes, den man ablöst, an den Enden mit Stäben oder platten Steinen verkeilt und anderthalb bis zwei Meter über dem Boden anbringt, nachdem man in der Mitte der Peripherie erst noch das Flugloch ausgespart hat. Meist ruht die Röhre auf Pfählen, seltener hängt sie, einem schwebenden Reck gleich, an einem besonderen Gestell. Diese Anlage ist dann besonders günstig, denn das Raubzeug findet keinen Zugang. Und mehrt sich dann der Bestand der Tierchen, so schichtet der Hausherr Röhre auf Röhre, daß eine förmliche Wand entsteht. Neigt[S. 119] sich die Sonne, so tritt er oder seine Hausgenossin heran an die luftige Behausung; ein freundliches Gurren begrüßt den Nahenden aus dem Innern der Zylinder; behutsam hebt der Züchter einen bearbeiteten Klotz vom Boden auf; sacht verschließt er mit ihm das Flugloch des untersten Rohres; der zweite folgt, dann der dritte und so fort. Beruhigt verläßt der Mensch den Ort; so sind die Tierchen vor allem Raubzeug gesichert.
Seit einigen Tagen weiß ich auch, warum bei meinen Rundtouren so wenig Männer sichtbar sind. Die Negersiedelungen hierzulande verdienen kaum den Namen Dörfer; dazu sind sie zu weitläufig gebaut; von einem Hause aus sieht man nur ganz vereinzelt das nächste herüberwinken, so weit liegt es abseits. Gehindert wird der Ausblick zudem durch die zwar sehr sperrigen, aber doch saftig grünen und darum sehr undurchsichtigen Mhogofelder, die jetzt, nach der Einerntung von Hirse und Mais, neben den mit Basi bestellten Schamben allein noch die Fluren bedecken. So kann es vorkommen, daß man, um kein Haus zu übergehen, sich lediglich der Führung der ausgetretenen Feldpfade anvertrauen muß, oder aber, daß man den Geräuschen und Lauten nachgeht, die von jeder menschlichen Siedelung unzertrennlich sind. Und wie bedeutend sind diese Geräusche und Laute, denen ich hier in Massassi so ziemlich alle Tage habe nachgehen können! Wie eine lustige Frühschoppengesellschaft hört es sich an, wenn ich mit Nils Knudsen durch das Gelände streiche. Lauter und lauter werdende Stimmen, die ohne Beobachtung parlamentarischer Umgangsformen regellos durcheinanderlärmen. Mit einemmal wendet sich der Pfad, unversehens stehen wir in einem stattlichen Gehöft, und da haben wir auch die Bescherung! Es ist wirklich und wahrhaftig ein Frühschoppen, und ein recht kräftiger dazu, der Stimmung aller Teilnehmer nach zu urteilen und nach Anzahl und Ausmaß der bereits ganz oder halb geleerten Pombetöpfe. Wie bei einem Steinwurf in einen Poggenpfuhl, so verstummt bei unserem Erscheinen das Getöse. Erst auf unser: „Pombe msuri?, ist der Stoff gut?“[S. 120] schallt ein begeistertes „Msuri kabissa, bwana! Ausgezeichnet, Herr!“ aus rauhen Kehlen zurück.
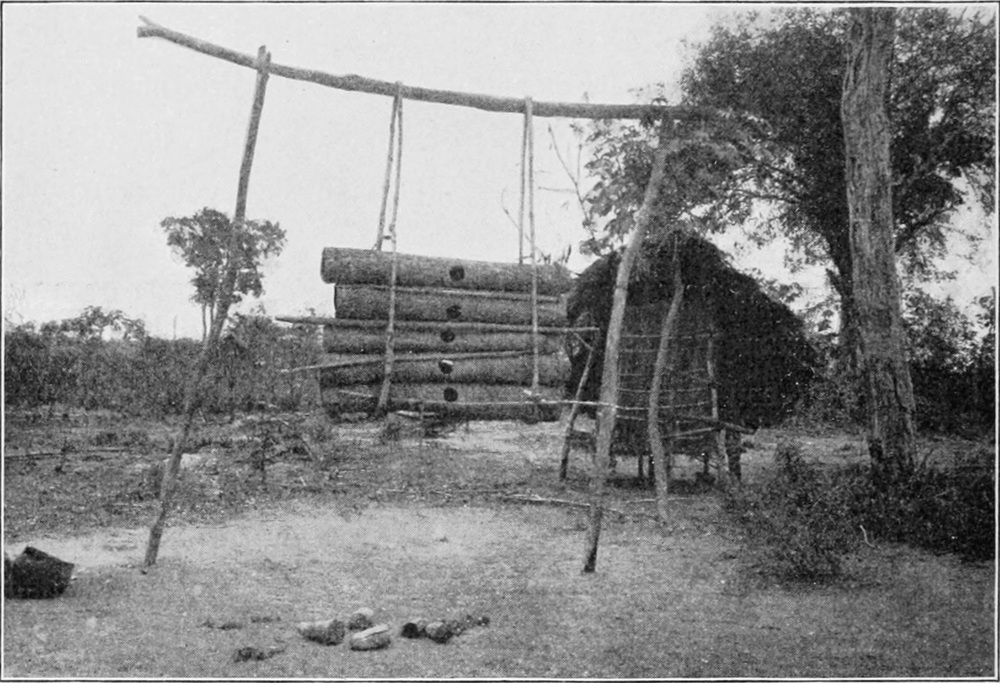
O diese Pombe! Wie gut wir es im alten Bierlande Deutschland haben, begreifen wir erst, wenn wir ihm einmal schnöde den Rücken kehren. Schon in Mtua, unserem zweiten Lagerplatz nach Lindi, war uns drei Weißen ein gewaltiger Tonkrug mit dem Nationalbräu des östlichen Afrika als Ehrengabe kredenzt worden. Bei mir hatte die schmutzig graugelbe Flüssigkeit damals keine Gegenliebe gefunden; um so größere bei unseren Leuten, die mit den 25 oder 30 Litern im Nu fertig gewesen waren. Auch hier in Massassi hat die Gattin des Wanyassagroßen Massekera-Matola, eine nasenpflockbehaftete, außerordentlich nette Frau von mittleren Jahren, es sich nicht nehmen lassen, Knudsen und mir gleich an einem der ersten Abende ebenfalls den Ehrentrunk in Gestalt eines solchen Riesentopfes zu übersenden. Die Ehrengabe ausschlagen oder sie vergeuden ging doch nicht, wie wir uns sagen mußten; also deshalb mit Todesverachtung heran an das[S. 121] Gebräu. Ich bin der glückliche Besitzer zweier Wassergläser; eins von ihnen senke ich energisch in die trübe Flut. Es zeigt sich gefüllt mit einem Naß, das der Farbe nach unserem Lichtenhainer gleicht, der Konsistenz nach aber eine Million mal dicker ist. Eine kompakte Masse von Hirseschrot und Hirsemalz füllt das Gefäß bis fast obenhin; nur einen Finger breit hoch lagert darüber ein wirkliches Lichtenhainer. „Ä, das geht doch nicht“, knurre ich. „Kibwana, ein Taschentuch,“ rufe ich meinem „Stubenmädchen“ zu, „aber ein reines.“ Das gute, dumme Tier aus Pangani kommt nach endlosem Suchen mit dem Wahrzeichen unseres katarrhalischen Zeitalters heran; ich forme einen Filter aus dem feinen, weißen Stoff und lasse die Pombe hineinschütten. Ja, was ist denn das? Kein Tropfen rinnt in das untergestellte Gesäß. Ich rüttele und schüttele; es nützt alles nichts. „Nun,“ sage ich, „der Stoff wird zu dicht sein; Lete sanda, Kibwana, bring etwas von dem Leichentuch.“ Wie? Leichentuch? Verroht denn dieser dunkle Erdteil selbst deutsche Professoren so fürchterlich, daß sie sogar Leichentücher zu ihrem Wirtschaftsbetriebe heranziehen? Gemach, meine Gnädigste! Freilich, ein Leichentuch ist dieses Sanda oder Bafta, daran läßt sich nicht drehen noch deuteln; aber erstens hat dieser Stoff den Vorzug, noch nicht gebraucht zu sein, und zweitens möge es das Schicksal verhüten, daß er jemals seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt werden wird. Wer ins Innere von Afrika geht, der rechnet wohlweislich mit den Tücken dieses Landes und auch mit den Sitten seiner Bewohner, indem er sich mit einem Ballen eines stark appretierten weißen, leichten Stoffes versieht, wie ihn die Neger bei ihren Begräbnissen gebrauchen. Sie lieben es nicht, auch im Tode mit der bloßen Mutter Erde in Berührung zu kommen, sondern lassen ihre Leiber in ein Stück solcher Sanda einnähen. Und je reiner und weißer der Stoff ist, um so sicherer ist dem Verblichenen das Paradies.
Warum sollte ich also Sanda nicht als Filter benutzen, wohlgemerkt erst, nachdem durch Herauswaschen der Appretur nur ein weitmaschiges Netz feiner Fäden zurückgeblieben war! Doch auch[S. 122] das nützte nichts; ein paar spärliche Tropfen rannen an dem Beutel herab, das war alles. Ich habe dann mein Teesieb versucht und mein Kaffeesieb; auch sie waren einem solchen Aggregatzustande nicht gewachsen. „Prosit, Herr Knudsen!“ rief ich deshalb, das letzte Sieb dem in der Türe stehenden Koch in hohem Bogen in die geschickt auffangende Hand werfend. Es ist auch so gegangen; und nicht einmal schlecht schmeckt das Zeug, ein wenig nach Mehl zwar, aber sonst doch mit einem merkbaren Anklang an unseren Studententrank aus dem Bierdorfe von Jena. Ich glaube sogar, ich könnte mich an ihn gewöhnen.
Diese Angewöhnung scheint bei den Männern von Massassi leider zu sehr erfolgt zu sein. Gewiß, ich gönne den würdigen Hausvätern nach der schweren Arbeit der Ernte ihren Bürgertrunk von Herzen, nur will es mir nicht so recht behagen, daß meine Studien unter dieser ewigen Fröhlichkeit leiden sollen. Eine größere Anzahl von Erwachsenen ist überhaupt nicht zusammenzutrommeln, um sich von mir auf ihr Volkstum, ihre Sitten und Gebräuche auspressen zu lassen; die wenigen aber, die es mit ihrer Zeit und ihren Neigungen vereinbaren können, sich für kurze Zeit von ihrem ambulanten Kneipleben zu trennen, sind sehr wenig geneigt, es mit der Wahrheit genau zu nehmen. Selbst als ich neulich eine Schar dieser wackeren Zecher herbestellt hatte, um mir ihre Flechttechnik anzusehen, hatte das seine Schwierigkeiten; die Männer flochten mir zwar was vor, aber zu langen Auseinandersetzungen über die einheimischen Namen der Materialien und des Geräts waren sie unmöglich zu gebrauchen; ihr Morgentrunk war zu ausgiebig gewesen.
Die Sitte afrikanischer Völker, nach reichlicher Ernte einen Teil der Körnerfrüchte in Bier umzuwandeln und in dieser Form rasch und in großen Massen zu vertilgen, ist bekannt; sie vor allen Dingen hat wohl zur Stärkung jener Ansicht beigetragen, nach der der Schwarze im Besitz des Überflusses alles vertut und verpraßt, um nachher zu darben und zu hungern. Ein Fünkchen oder vielleicht gar[S. 123] ein ziemlich großer Funken göttlichen Leichtsinns läßt sich unserem schwarzen Freunde allerdings nicht absprechen, aber man darf ihn doch noch nicht auf ein einziges Indizium hin verurteilen. Ich habe vorhin schon betont, wie ungemein schwierig es für den schwarzen Ackerbauer ist, sein Saatgut zu überwintern. Noch viel schwieriger würde es für ihn sein, die ungleich größere Menge der zum Lebensunterhalt der Familie bestimmten Erntevorräte über einen großen Teil des Jahres hin genießbar aufzubewahren. Daß er es versucht, bezeugen die zahlreichen Vorratsbehälter bei jedem größeren Gehöft; daß es ihm nicht immer gelingt und daß er daher vorzieht, diesen dem Verderben ausgesetzten Teil seiner Ernte in einer Weise anzulegen, die das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet, indem er ihn in der Form seines ganz annehmbaren Bieres vertilgt, beweisen dagegen die bei aller Fröhlichkeit doch harmlosen Früh- und Abendsitzungen. Sie weichen übrigens von unserem europäischen Schankbetrieb insofern ab, als sie reihum gehen; es kommt jeder als Wirt an die Reihe, und jeder ist auch Gast; im ganzen eine herrliche Einrichtung.

[S. 124]
Der gelinde chronische Alkoholdusel der Männerwelt ist es nicht allein, was mir Schwierigkeiten bereitet. Zunächst die Not mit dem Photographieren. Im fernen Europa ist man froh, wenn die liebe Sonne dem Amateur das Handwerk erleichtert; und meint sie es ein wenig zu gut, nun, so hat man hohe, dichtbelaubte Bäume, grünendes Buschwerk, hochragende schattige Häuser. Nichts von alledem in Afrika. Zwar hat man Bäume, aber sie sind weder hoch, noch schattig; Büsche, aber sie sind nicht grün; Häuser, aber sie sind im besten Fall höchstens von doppelter Mannshöhe, und dann auch nur in der Firstlinie. Dazu der unheimlich hohe Sonnenstand schon von 9 Uhr morgens an und bis über 3 Uhr nachmittags hinaus, und eine Lichtstärke, von der man sich am besten dann einen Begriff machen kann, wenn man einmal versucht, die Hautfarben der Neger an der Hand der Luschanschen Farbentafel festzustellen. Nichts als Licht und Glast hier, nichts als schwarzer, tiefer Schatten dort. Und dabei soll man weiche, stimmungsvolle Bilder machen! Herr, lehre mich diese Kunst, und ich will dir danken ewiglich.
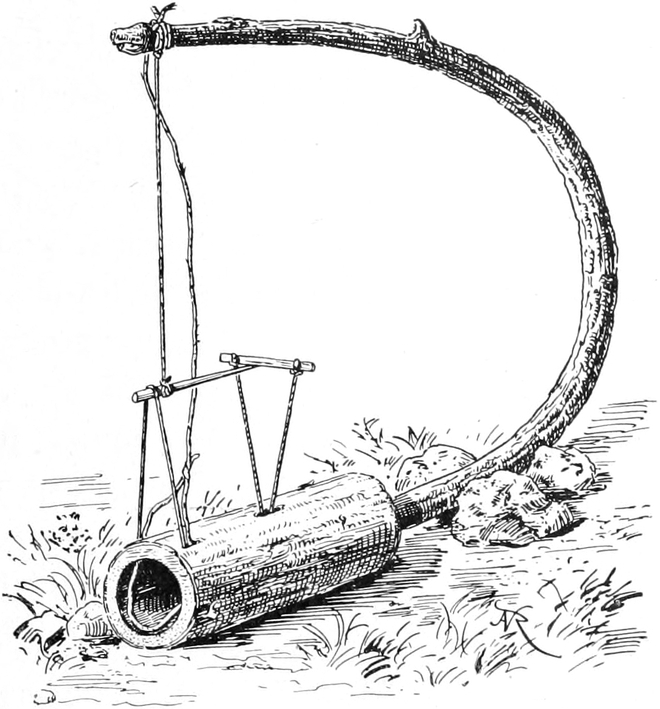
Auch das Thema Dunkelkammer ist wenig erbaulich. Die deutsche Regierung ist fürsorglich; sie baut, um Hungersnöten unter den Eingeborenen vorzubeugen, wohl mehr aber noch, um in einem etwaigen neuen Aufstande von der Landesbevölkerung unabhängig zu sein, in der Boma von Massassi augenblicklich ein stolzes Haus. Es ist der einzige Steinbau im ganzen Lande und bis zur Küste hin, nur einstöckig zwar, aber mit starken, nur von engen, schießschartenartigen Löchern durchbrochenen Mauern und festem, flachem Lehmdach. In diesem Architekturwunder lagern schon jetzt ungezählte Säcke mit Hirse neuer Ernte und Berge roher Baumwolle. Ich habe mir beides zunutze gemacht: mit der Baumwolle habe ich die Luftlöcher verstopft, auf den Säcken aber sitze ich; auf ihnen ruht gleichzeitig mein Dunkelkammer-Arbeitstisch. Dieser war bis jetzt der wesentliche Bestandteil einer Baumwollpresse, die draußen auf dem Hofe einsam über ein verfehltes Dasein dahintrauert. Den Türverschluß endlich habe ich[S. 125] durch eine Kombination dicker, von meinen Trägern gefertigter Strohwände und einiger meiner Schlafdecken hergestellt. Dergestalt kann ich zur Not sogar am Tage entwickeln, nur herrscht schon jetzt, nach so kurzer Tätigkeit, eine erstickende Atmosphäre in dem auch sonst wenig anheimelnden Raum. Gerne entrinne ich ihm daher, um mich neuen Taten zuzuwenden.
Diese sind denn auch wirklich von viel ansprechenderer Natur. Bei einem meiner ersten Bummel bin ich inmitten einer Schambe auf ein zierliches Etwas gestoßen, das mir als Tego ya ngunda, als Taubenfalle bezeichnet wird; ein System von Stäbchen, Bügeln und feinen Schnüren, von denen einer mit einem kräftigen, starkgekrümmten Bügel verbunden ist. Mich interessiert von Jugend auf alles Technische, um wieviel mehr hier, wo wir in frühere Entwicklungsphasen des menschlichen Intellekts tiefe Einblicke zu tun die beste Gelegenheit haben. Also daheim Appell aller meiner Leute und möglichst zahlreicher Eingeborener, und Ansprache an alles versammelte Volk des Inhalts, daß der Msungu ein großes Gewicht darauf legt, alle Arten von Fallen für alle Arten von Tieren zu sehen und zu besitzen. Versprechen recht annehmbarer Preise bei Lieferung authentischer, guter Stücke und zum Schluß die höfliche, aber bestimmte Aufforderung:[S. 126] „Nendeni na tengeneseni sasa, nun geht los und baut eure Dinger zusammen.“
Wie sind sie geeilt an jenem Tage, und wie eifrig sind alle meine Mannen seitdem Tag für Tag an der Arbeit! Ich habe meine Träger bisher für lauter Wanyamwesi gehalten; jetzt ersehe ich an der Hand der Kommentare, die mir jeder einzelne zu seinem Kunstwerk geben muß, daß sich unter meinen 30 Mann eine ganze Reihe von Völkerschaften verbirgt. Zwar das Gros sind Wanyamwesi, doch daneben gibt es Wassukuma und Manyema und sogar einen echten Mgoni von Runssewe, also einen Vertreter jenes tapfern Kaffernvolkes, das vor einigen Jahrzehnten vom fernen Südafrika bis ins heutige Deutsch-Ostafrika vorgedrungen ist und dabei eine seiner Gruppen, eben diese Runssewe-Wangoni, bis weit oben an die Südwestecke des Viktoria-Nyansa vorgeschickt hat. Und nun meine Askari erst! Es sind zwar nur 13 Mann, aber sie gehören nicht weniger als einem Dutzend verschiedener Völkerschaften an, vom fernen Darfor im ägyptischen Sudan bis zu den Yao in Portugiesisch-Ostafrika. Und alle diese Getreuen zermartern ihr Gehirn und üben in Busch und Feld von neuem die Künste ihres Knaben- und Jünglingsalters, und dann kommen sie heran und errichten auf dem weiten, sonnigen Platz neben meinem Palais die Früchte ihrer schweren Geistesarbeit.

Der typische Ackerbauer steht in der Literatur als Jäger und Fallensteller nicht hoch im Kurse; sein bißchen Geist soll durch die Sorge um sein Feld völlig absorbiert werden; nur Völker vom Schlage des Buschmanns, des Pygmäen und des Australiers hält unsere Schulweisheit für fähig, das flüchtige Wild in Wald und Steppe mit Geschick zu erlegen und mit List und Geistesschärfe in schlau ersonnener Falle zur Strecke zu bringen. Und doch, wie weit schießt auch diese Lehrmeinung am Ziel vorbei! Freilich, unter den Völkern meines Gebietes gelten die Makua sogar als gute Jäger; dabei sind sie in der Hauptsache genau wie die anderen Völker typische Hackbauern, d. h. Leute, die ihre mühselig urbar gemachten Felder Jahr für[S. 127] Jahr unverdrossen mit der Hacke beackern. Sind ihre Tierfallen nicht trotz alledem Beweise eines geradezu bewunderungswürdigen Scharfsinns? Ich gebe einige meiner Skizzen als Belege bei; die Konstruktion der Fallen und die Art ihrer Wirksamkeit ergibt sich aus der Zeichnung von selbst. Wer aber der Kunst technischen Sehens gänzlich ermangeln sollte, für den füge ich bei, daß alle diese Mordinstrumente auf folgendes Prinzip hinauslaufen: entweder die Falle ist für einen Vierfüßer bestimmt; dann ist sie so eingerichtet, daß das Tier beim Vorwärtsschreiten oder -laufen mit der Nase gegen ein feines Netz oder mit dem Fuß gegen eine feine Schnur stößt. Netz und Schnur werden dadurch vorwärts gedrückt; jenes gleitet mit seinem oberen Rande nach unten, das Ende der Schnur hingegen bewegt sich etwas seitwärts. In beiden Fällen wird durch diese Gleitbewegung das Ende eines kleinen Hebels frei, eines Holzstäbchens, das in einer in der Zeichnung klar ersichtlichen Weise die Falle bisher gespannt erhalten hat. Es schlägt jetzt blitzschnell um sein Widerlager herum, bewegt von der Spannkraft eines Baumes oder[S. 128] eines sonstwie angebrachten Bügels. Dieser schnellt nach oben und zieht dabei eine geschickt angebrachte Schlinge zu; das Tier ist gefangen und stirbt eines qualvollen Erstickungstodes. Ratten und ähnlich lieblichem Getier geht der schwarze Fallensteller zwar nach ähnlichen Prinzipien, doch noch grausamer zu Leibe, und leider stellt er auch den Vögeln mit gleicher Gerissenheit nach. Vielleicht finde ich später noch einmal Gelegenheit, auf diese Seite des hiesigen Völkerlebens zurückzukommen; verdient hat sie es, denn auf kaum einem anderen Gebiet zeigt sich die Erfindungsgabe auch des primitiven Geistes so schön und deutlich ausgeprägt wie in dieser Art des Kampfes ums Dasein.
Psychologisch interessant ist das Verhalten der Eingeborenen gegenüber meiner eigenen Tätigkeit bei der Lösung dieses Teils meiner Forschungsaufgabe. Wenn wir beiden Europäer unser karges Mittagsmahl verzehrt haben, Nils Knudsen sich zum wohlverdienten Schlummer niedergelegt hat und das Geschnarch meiner Krieger zwar rhythmisch, aber nicht harmonisch aus der Barasa herübertönt, dann sitze ich im sengenden Sonnenbrand, dem schattenlosen Schlemihl gleich, und nur kümmerlich geschützt durch den größeren meiner beiden Tropenhelme draußen auf dem Aufstellungsplatz meiner Tierfallen und zeichne. Bis in mein 30. Lebensjahr habe ich zum Spott für alle meine in dieser Hinsicht recht begabten Verwandten als talentlos gegolten; da „entdeckte“ ich mich als königlich preußischer Hilfsarbeiter im Berliner Museum für Völkerkunde eines schönen Tags selbst, und wenn einer meiner Freunde mich dereinst einer Biographie für würdig erachten sollte, so mag er nur ruhig betonen, daß mir in meiner wissenschaftlichen Entwicklungszeit meine bescheidenen zeichnerischen Leistungen eigentlich mehr Freude und Genugtuung bereitet haben als die schriftstellerischen. Für den ethnographischen Forschungsreisenden ist die Fähigkeit, von welchem Forschungsobjekt es auch immer sei, eine genaue Skizze rasch und mit wenigen Strichen entwerfen zu können, eine Zugabe, die nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die Photographie ist gewiß eine wunderbare Erfindung,[S. 130] im Kleinkram der täglichen Forschungsarbeit versagt sie indessen häufiger als man glaubt, und nicht nur im Dunkel der Negerhütte, sondern auch bei tausend anderen Sachen in heller Luft.
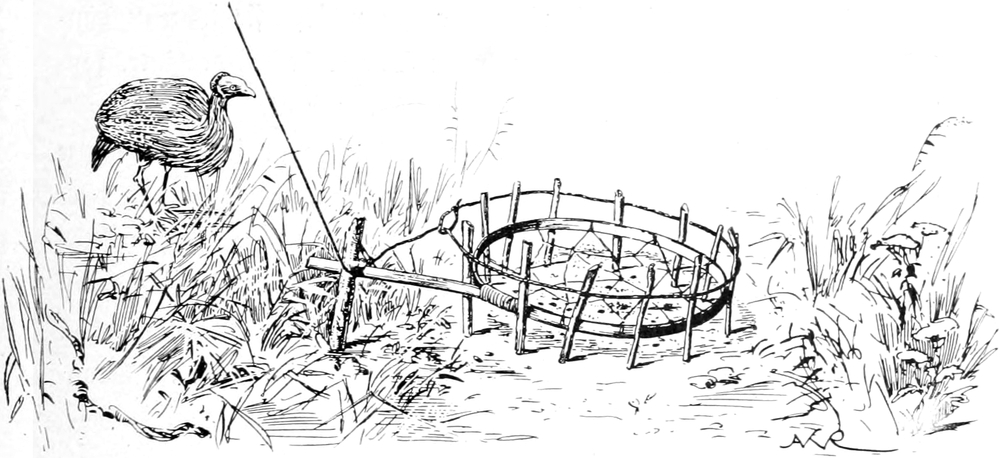

Also ich sitze und zeichne. Kein Lüftchen regt sich; die ganze Natur scheint zu schlafen. Auch mir wird die Feder müde, da höre ich unmittelbar hinter meinem Rücken Geräusch. Ein flüchtiger Blick lehrt mich, daß das Moment allgemein menschlicher Neugier selbst die Urkraft negroider Faulheit überwunden hat. Meine Träger sind’s, ein ganzer Haufen; auch Eingeborene dabei. Sie müssen leise herangetreten sein, was auf dem weichen Sandboden und bei dem Mangel an Schuhen nicht befremdlich ist. Gespannt schaut die enggedrängte Schar über meine Schulter hinweg ins Skizzenbuch. Ich lasse mich nicht stören; Strich folgt auf Strich; das Werk nähert sich seinem Ende; schließlich ist es fertig. „Sawasawa?“ (wörtlich: „gleich?“, hier etwa in dem Sinn: „Na, ist das Ding denn getroffen?“) frage ich gespannt zurück. „Ndio, jawohl“, ertönt es mir unverzüglich und mit einer Begeisterung in die Ohren, daß die Trommelfelle platzen möchten. „Kisuri? Ist es schön?“ „Kisuri sana kabissa, ausgezeichnet!“ gellt es noch stärker und begeisterter in meine Hörorgane. „Wewe Fundi, du bist ein Meister.“ Es sind meine Kunstverständigen, die ausübenden Künstler selbst, die hier in für mich so schmeichelhafter Art das Richteramt üben; die paar Schensi, die unbeleckten, von der Muse ungeküßten, die nicht zum Kreis meiner Künstler gehören, haben nur als Herdenvieh mitgebrüllt.
Und nun kommt der Versuch einer Nutzanwendung. Ich erhebe mich von meinem Stühlchen, stelle mich in Positur und lege meinen Kunstjüngern nahe, da sie nun sähen, wie ich, der Fundi, eine solche Falle zeichne, so wäre es angezeigt, daß nun doch auch sie sich einmal an einem solchen schwierigeren Gegenstand versuchten; immer bloß ihre Freunde abzumalen, oder aber Bäume und Häuser und die Tiere, das sei langweilig; außerdem seien sie doch so kluge Kerle, daß ihnen eine solche Vogelfalle kaum Schwierigkeiten[S. 131] bieten würde. Ich habe auf den Ausdruck verschämter Verlegenheit, wie er mir beim Beginn meiner Studien in Lindi entgegentrat, schon einmal hingewiesen; hier kam er noch verstärkter und auch allgemeiner zum Ausdruck. Ich habe dabei das bestimmte Gefühl gehabt, daß den Leuten jetzt zum erstenmal der Begriff dessen klar wurde, was wir Perspektive nennen. In ihren Gegenreden und Gebärden suchten sie sichtlich etwas Derartiges auszudrücken, sie verfolgten mit den Fingern die merkwürdig verkürzten Kurven, die doch in Wirklichkeit Kreisbögen waren, kurz sie standen etwas Neuem, vorher nie Gekanntem und Geahntem gegenüber, und das brachte ihnen einesteils das Gefühl ihrer geistigen und künstlerischen Unterlegenheit zum Bewußtsein, während es sie andererseits wie ein Magnet an mein Skizzenbuch bannte. Bis jetzt hat noch keiner von ihnen sich an die Wiedergabe einer solchen Tierfalle herangewagt.
Alle Afrikareisenden früherer Tage oder in weniger gut erschlossenen Ländern, als Deutsch-Ostafrika es ist, haben durch nichts mehr zu leiden gehabt als durch die Schwierigkeiten des Tauschverkehrs. Mit wieviel Hunderten von Lasten der verschiedenartigsten Zeugstoffe, mit wieviel Perlensorten ist noch ein Stanley zu seinen Entdeckertaten ausgezogen; wie unsicher war es bei alledem, ob man gerade den Geschmack der Eingeborenen seines Forschungsgebietes getroffen hatte; und wie ungeheuer vergrößerte diese primitive Art des Geldes den Troß jeder Expedition. Bei uns in Deutsch-Ostafrika mit seiner sooft zu Unrecht angefeindeten Kolonialregierung reist der Weiße heute fast ebenso bequem wie daheim im Mutterlande. Zwar sein Kreditbrief reicht nur bis zur Küste; trägt sein Unternehmen jedoch wie das meinige amtlichen Charakter, so ist jede Station und jeder Posten, der über eine Regierungskasse verfügt, angewiesen, dem Reisenden unter Beachtung sehr einfacher Formalitäten Kredit zu gewähren und ihn mit Barmitteln auszustatten. Des Rätsels Lösung ist sehr einfach: unsere Rupienwährung gilt nicht nur an der Küste, sondern zwingt auch alle Völker des Innern, sich ihr wohl[S. 132] oder übel anzubequemen. Meine Operationsbasis ist auch in finanzieller Hinsicht das Städtchen Lindi mit seinem kaiserlichen Bezirksamt; von dort habe ich mir ein paar große Säcke mit ganzen, halben und Viertelrupien und für den ersten Bedarf auch einige Kisten mit Hellern mitgenommen. O dieser unglückliche Heller! Was wird er, sein echt „afrikanischer“ Name und seine Einführung überhaupt von den bösen, weißen Küstenmännern bespöttelt, und wie schlecht sind die Witze, die über ihn gemacht werden! Der billigste ist noch der, daß der gegenwärtige Zolldirektor in der Landeshauptstadt, der in der Tat den Namen dieses bei uns längst veralteten Zahlmittels führt, bei der ostafrikanischen Scheidemünze Gevatter gestanden habe. So viel merke ich schon jetzt: den Eingeborenen geht es wie bei uns den alten Leuten vor 30 Jahren; ebenso wie diese sich nicht an die Mark gewöhnen konnten und ruhig mit dem guten, alten Taler weiterrechneten, so zählt hier alles höchst despektierlich und illoyal nach Pesas weiter, der alten Kupfermünze der vierundsechzigteiligen Rupie. Dies ist auch viel einfacher und bequemer; ein Ei kostet einen Pesa, und damit basta. Seinen Wert in Heller umzurechnen fällt niemandem ein.
Doch der Neger müßte nicht Neger sein, wenn er sich nicht trotz alledem der Tätigkeit des Hellereinnehmens mit Begeisterung hingäbe. Und sein Geschäft blüht jetzt! Es paßt zu dem Bilde des Diogenes wie die Faust aufs Auge, wenn hinter dem laternenschwingenden Moritz der Mgonimann Mambo sasa durch die sonnige Landschaft zieht, hoch oben auf dem krauswolligen Haupte ein stattliches Gefäß mit gleißender Münze. Es sind frisch in Berlin geprägte Kupferheller, mit denen ich die Negerherzen zu betören ausziehe.
Nach langem, doch durchaus nicht langweiligem Ableuchten aller Salons der Negerpaläste kehre ich, geblendet von der überhellen Tropensonne, an das Tageslicht zurück; mit verständnisvollem Schmunzeln schleppt meine Leibgarde — das sind diejenigen meiner Leute, die immer um mich sind und die mit der dem Natursohn eigenen Auffassungsgabe[S. 133] rasch begriffen haben, worum es sich handelt — einen Haufen Krimskrams hinterher; mit gemischten Gefühlen, erwartungsvoll und zweifelnd zugleich, folgen schließlich Hausherr und Hausfrau. Jetzt beginnt das Feilschen. Einen kleinen Vorgeschmack hat der Ausreisende schon in Neapel und Port Said, in Aden und Mombassa bekommen; hier spielt sich das Verfahren nicht wesentlich anders ab. „Kiassi gani? Was kostet der ganze Plunder?“ fragt man so leichthin, mit einer summarischen Handbewegung den ganzen Haufen umschließend. Diesem Verfahren steht der glückliche Besitzer jener Kostbarkeiten gänzlich ohne Verständnis gegenüber; er sperrt Mund und Nase weit auf und schweigt. So geht’s also nicht; diese abgekürzte Methode wäre auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu verwerfen. „Nini hii? Was ist das?“ Und ich halte ihm irgendeins der Stücke unter die Augen. Dies erst ist der richtige Weg. Jetzt öffnet sich der vordem so schweigsame Mund, und nun heißt es sich schnell auf die Kollegbank der seligen Fuchsenzeit zurückversetzt denken und eifrigst nachschreiben, was zur Abwechselung einmal nicht aus dem Munde hochwohlweiser Professoren auf das Auditorium herniederplätschert, sondern dem prachtvollen Zahngehege eines ganz unbeleckten Schensi entströmt. Und wenn ich dann alles weiß, den Zweck, den Namen, die Herstellungsart und die Wirkungsweise, dann endlich ist auch der Schwarze geneigt und imstande, den Einzelpreis zu fixieren. Bis jetzt habe ich dabei zwei Extreme feststellen können: die eine Kategorie der Verkäufer fordert ohne Rücksicht auf die Art des Verkaufsobjektes ganze Rupien, Rupia tatu oder Rupia nne, 3 oder 4 Rupien; die andere verlangt ebenso konsequent den Einheitspreis eines Sumni. Dieser Sumni ist im hiesigen Sprachgebrauch der vierte Teil einer Rupie, gilt also 33⅓ Pfennig. In der Währung Ostafrikas ist er ein bildhübsches, zierliches Silberstück von etwas kleinerer Größe als unsere halbe Mark. Vielleicht ist es diese Handlichkeit, verbunden mit dem ungebrochenen Glanz gerade meiner funkelnagelneuen Stücke, was dieser Münze seine Bevorzugung sichert.
[S. 134]
Eins muß man der hiesigen Bevölkerung im Gegensatz zu der Schwefelbande von Neapel, Port Said und Aden nachrühmen: keiner von ihnen zetert und jammert, wenn wir ihm statt des geforderten Talers den zwanzigsten oder zehnten Teil bieten. In voller Gemütsruhe geht der Neger in seiner Forderung nach und nach bis zu einer billigen Einigung herunter, oder aber er sagt gleich beim ersten Gegenangebot: „Lete, gib’s her.“ In diesem Augenblick beginnt dann die Glanzrolle des Knaben Moritz und meines Hellertopfes. Mit raschem Griff hat der Boy das Gefäß vom Haupte seines Freundes Mambo sasa heruntergeholt; mit Kennerblick mustert er den Kassenbestand, und dann zahlt er aus mit der Würde, wenn auch nicht mit der Geschwindigkeit des Kassierers einer großen Bank.
So oder ähnlich spielt sich das Handelsgeschäft auch um die übrigen Stücke ab. Es ist viel zeitraubender als mir lieb ist, jedoch nicht zu umgehen. Schließlich ist auch das letzte Stück erhandelt; mit der staunenswerten Geschicklichkeit, die ich an meinen Trägern sooft bewundere, haben diese die Beute im Handumdrehen zu großen Bündeln verschnürt; noch ein prüfender Rundblick nach photographischen Motiven, ein anderer Blick nach dem ob seines Reichtums schmunzelnden Hausbesitzer; dann ein kräftiges „Kwa heri, leb’ wohl“, und Laterne samt Hellertopf ziehen weiter.
Bei uns im alten Uleia haben Fürstensöhne im allgemeinen nicht viel Muße; sie müssen viel oder zum mindesten doch vielerlei erlernen und sind deshalb in ihrer Jugend stark angespannt. O wie anders und um wieviel besser hat es da mein edler Prinz Salim Matola! Kaum hatten wir uns hier in Massassi etwas menschlich eingerichtet, da erschien die junge Hoheit schon auf dem Plane; ein überschlanker, sehr langgewachsener Jüngling von 17 bis 18 Jahren; nach der Sitte des Landes sehr vornehm mit einer europäischen Weste bekleidet und sehr zutraulich. Salim ist seither kaum von mir gewichen; er kann alles, weiß alles, findet alles und schleppt erfreulicherweise auch alles herbei; er macht die besten Fallen, zeigt mir, mit[S. 135] welch teuflischer Gerissenheit seine Landsleute Leimruten stellen, spielt meisterhaft auf allen Instrumenten und bohrt mit einer Geschwindigkeit Feuer, daß man über die Kraft dieses schmächtigen Körpers billig erstaunt sein muß. Er ist mit einem Wort eine ethnographische Perle.
Nur eins scheint mein junger Freund nicht zu kennen: Arbeit. Sein Vater, der bereits erwähnte, stets feucht-fröhliche Massekera-Matola, ist im Besitz eines sehr stattlichen Gehöfts und sehr ausgedehnter Schamben. Ob der alte Herr selbst und in höchsteigener Person sich jemals merkbar auf diesem Grundbesitz betätigt, kann ich leider nicht beurteilen, da er augenblicklich durch seine biervertilgende Tätigkeit sehr stark in Anspruch genommen ist; aber daß die weiblichen Hausgenossen fleißig die Hände rühren, um auch den letzten Teil der Ernte noch einzubringen, habe ich bei jedem Besuche gesehen. Nur das Prinzlein scheint über jede plebejische Betätigung erhaben zu sein; seine Hände sehen nicht nach Schwielen aus, und seine Muskulatur läßt auch stark zu wünschen übrig. Mit frohem Mut und heiterm Sinn schlendert er durchs Dasein hin.

[S. 136]
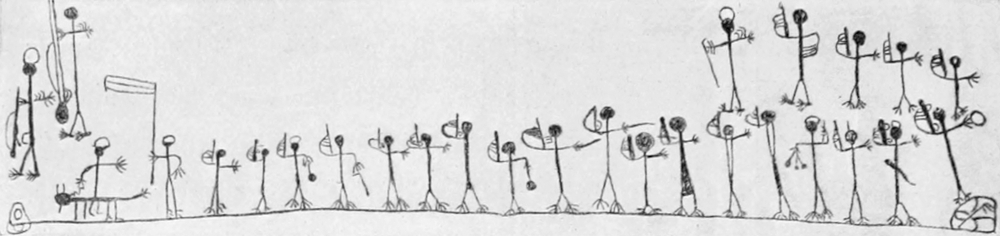
Chingulungulu, Anfang August 1906.
Das Suchen auf der Karte nach meinem jetzigen Standort wird schon schwieriger; ich selbst habe Massassi und seine Lage auf dem Kartenblatt bereits seit vielen Jahren gekannt, aber von der Existenz dieses Ortes mit dem wunderlichen Namen, in dem ich seit ein paar Tagen meine Zeltpflöcke eingeschlagen habe, habe ich erst gehört, nachdem ich in den Dunstkreis der Binnenstämme eingetreten war.
In einem gleicht sich der Orient überall. Aus der Ferne gesehen sind seine Städte Wunderwerke menschlicher Siedelungskunst, tritt man aber in sie ein, so offenbaren sie sich meist als Schmutzgruben in des Wortes verwegenster Bedeutung, und an die Stelle begeisterter Illusionen tritt das Grau der Ernüchterung. Was hat mir Nils Knudsen nicht alles von Chingulungulu vorgeschwärmt! Eine herrliche Barasa, das Prunkstück negroider Baukunst im ganzen Osten; köstlich klares Wasser in Hülle und Fülle; Fleisch aller Art nach Belieben; Früchte und Gemüse von idealer Beschaffenheit. Dazu eine Bevölkerung, die sich aus lauter vornehmen Gentlemen zusammensetze, schöne Frauen und stattliche Häuser, und zum Schluß die Gelegenheit, nach allen Weltgegenden der ganzen weiten Ebene die [S. 137]bequemsten Rundtouren machen zu können. Ich bin noch zu kurze Zeit hier, als daß ich die so begeistert gepriesenen Vorzüge in allen ihren Einzelheiten schon hätte nachprüfen können, aber das habe ich doch schon heraus: ganz so paradiesisch wie der allerdings etwas lokalpatriotisch angehauchte Nils mir die Residenz Matolas II. gepriesen hat, ist weder Ort noch Bevölkerung.

Doch alles zu seiner Zeit; zwischen Massassi und Chingulungulu liegt nicht nur ein großer Streifen Afrika, sondern zwischen dem Ende der Schilderung meines dortigen Aufenthaltes und dem Anfang dieses Kapitels liegt auch ein zeitlich ziemlich großer Zwischenraum, groß wenigstens für einen Mann, auf den die neuen Eindrücke in solcher Fülle und mit solcher Wucht einstürmen wie auf mich.
Der Aufbruch von Massassi ist früher erfolgt, als er ursprünglich geplant war. Es waren eine ganze Reihe von Übelständen, die unsern Weitermarsch als notwendig erscheinen ließen. Zu meinem großen Mißvergnügen mußte ich bei meinen späteren Photographier-, Sammlungs- und Zeichenbummeln bemerken, daß an die Stelle der ursprünglichen Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, mit der die Einwohner uns das Betreten ihrer Grundstücke gestattet, und des Entgegenkommens, mit der sie in den Verkauf ihres Hausinventars gewilligt hatten, eine entschieden entgegengesetzte Stimmung getreten war; fast überall fanden wir verschlossene Türen und anscheinend völlig menschenleere Gehöfte. Auch diese Erscheinung gehört zum Kapitel der Rassenpsychologie; selbst wenn der Besuch eines Fremden ihm nur wirtschaftliche Vorteile bringt, will der Neger in seinen vier Pfählen nicht gestört sein.
Auch mit unserer Unterkunft in dem Rasthause erlebten wir auf die Dauer keine ungetrübte Freude. Knudsen, der in dieser Beziehung recht empfindlich war, behauptete, es sei feucht. Tatsächlich brauchte man nur ein klein wenig in den Boden zu graben, so kam das Grundwasser zutage; in ganz geringer Entfernung unterhalb des Hauses trat es als starker Quell an die Oberfläche hervor. Knudsen hatte[S. 138] bereits auf dem Marsche von der Küste aus vereinzelte Fieberanfälle gehabt; jetzt häuften sie sich derart, daß er kaum noch arbeitsfähig war. Rührend war dabei die Anhänglichkeit und Treue, mit der sein alter Diener Ali den kranken Herrn pflegte; er wich auch des Nachts nicht von seinem Bett. Ich selbst hatte bereits des öftern ein merkwürdiges Kribbeln auf meinem Haupte verspürt; jedesmal vorgenommene Untersuchungen hatten indessen über die Ursache keine Aufklärung erbracht. Eines schönen Tages nun eile ich, ein paar gewässerte Platten in der Hand, aus der Dunkelkammer zum Rasthaus hinüber. Da kribbelt es wieder äußerst intensiv in meinem spärlichen Gelock. „Moritz,“ rufe ich, „nimm mir mal den Hut ab und schau nach, was das ist.“ Moritz nimmt den Tropenhut her, besieht ihn außen, beschaut ihn innen, guckt hinter das Futter und wird dann aschfahl. „Wadudu wabaya“, bringt er mit sichtlichem Entsetzen heraus, „bösartige Insekten“. Jetzt interessiert der Fall mich doch etwas mehr; ich setze meine Platten ab und unterziehe Moritzens Fund ebenfalls einer genaueren Untersuchung. Es sind verschiedene kleine Tierchen, die sich hinter dem Futter meiner Kopfbedeckung tummeln; auch vereinzelte zeckenartige größere Lebewesen sind dabei. Nun ist es ein eigen Ding um die Beeinflussung des menschlichen Geistes durch bestimmte Vorstellungen. Über die Malaria und ihre Bekämpfung bin ich von Hause aus vollkommen beruhigt nach Afrika gegangen, ich schwöre auf Koch und fürchte nichts. Um so unangenehmer ist mir der Gedanke an Rückfallfieber. Was hat man mir in Daressalam nicht alles von dieser neuesten Entdeckung des großen Berliner Bakteriologen erzählt! Es werde durch ein kleines, unscheinbares, zeckenartiges Insekt hervorgerufen, das sich überall da, wo Eingeborene gewohnheitsmäßig lagern, in Erdlöchern einniste. Das Moskitonetz schütze zwar vor den ausgewachsenen Papassi, so heißen diese Zecken, nicht aber vor deren hoffnungsvollem Nachwuchs, der glatt und unbehindert selbst die feinsten Netzmaschen passiert. Und dann die Scheußlichkeit des Fiebers selbst; man sei zwar nicht schwer krank,[S. 139] doch auch niemals so recht gesund und arbeitsfähig, und nichts, weder Chinin noch irgend etwas anderes, nütze im mindesten gegen die Wiederkehr der alle paar Tage erfolgenden Anfälle. „Wadudu wabaya, und noch dazu von Zeckenform; das können doch nur Papassi sein“, fährt es mir blitzschnell durchs Gehirn. Auch ich bin sicher bleich geworden in diesem Augenblick, denn wenn so ein Rückfallfieber auch wohl nicht ans Leben geht, so bedeutet seine Erwerbung in diesem Augenblick nichts mehr und nichts weniger als das unrühmliche Ende meines kaum begonnenen Unternehmens. Gerade zu Arbeiten, wie ich sie tagaus tagein zu bewältigen habe, gehört eine absolute Gesundheit und eine vollkommen ungeschwächte Energie.
Noch ein drittes hygienisches Moment hat uns schließlich aus dem Orte vertrieben. Daß Massassi nichts weniger als der Hort aller Tugenden ist, hatte ich bereits früher bemerkt; unter den Soldaten des Polizeipostens war ein ziemlich großer Prozentsatz geschlechtskrank. Jetzt kam noch etwas für mich ganz Neues hinzu. Der Akide, ein früherer Schutztruppen-Unteroffizier, ist der glückliche Besitzer einer kleinen Rinderherde. Liebenswürdig wie der Neger nun einmal ist, übersendet mir der Beamte Tag für Tag ein kleines Töpfchen mit Milch, die ich mit aufrichtigen Dankgefühlen gegen den edlen Spender ebenso regelmäßig genieße. Da verbreitet sich, immer bestimmter auftretend, das Gerücht, der Akide habe den Aussatz. Damit war es natürlich um meinen Milchgenuß geschehen; der Beamte schickte sie zwar unentwegt weiter, und ich konnte sie ebenso selbstverständlich nicht zurückweisen; so kam sie mir gerade zum Fixieren meiner Bleistiftzeichnungen recht.
In ihrer Gesamtheit bedeuten alle die aufgezählten kleinen Übelstände nicht mehr als eine Summe von Nadelstichen; doch auch solche kleinen Eingriffe in das menschliche Wohlbefinden vermögen schließlich die Freude am Dasein merkbar herabzusetzen. In diesem Fall winkte uns überdies noch das Paradies Chingulungulu; was Wunder also, wenn zwischen dem ersten Auftauchen des Planes, nach Süden zu[S. 140] wandern, und seiner Ausführung nur ein paar kurze Tropentage liegen. Mit gewohnter affenartiger Fixigkeit verschnürten eines Abends meine Träger einen großen Haufen ethnographischer Lasten; ebenso rasch war an den kommandierenden Gefreiten Saleh und den Trägerführer Pesa mbili der Befehl ausgegeben: „Morgen früh 6 Uhr safari!“ Damit war unsererseits so ziemlich alles getan, was getan werden konnte.
Neben dem Yaohäuptling Matola von Chingulungulu wird niemand mehr im Lande genannt als sein erlauchter Kollege, der Yaohäuptling Nakaam von Chiwata auf der Nordweststrecke des Makondeplateaus. An der Küste, unter den Europäern ist man sich nicht einig, wer von ihnen der größere und bedeutendere sei; hier im Innern indes scheint es, als ob Matola sich eines weit größeren Ansehens der Leute erfreut als der Herrscher von Chiwata. Trotzdem hielt ich es für unumgänglich nötig, auch ihm und seinen Untertanen einen Besuch abzustatten. Eine festgebundene Marschroute besteht in meinem Reiseplan überhaupt nicht, sondern ich habe mir vorbehalten, stets das auszuführen, was unter den betreffenden Orts- und Zeitverhältnissen als am günstigsten erscheint. Ich muß mir in diesem Augenblicke freilich sagen, daß ich in Massassi wohl einen ganz hübschen Einblick in die materielle, die äußere Kultur seiner Bewohner gewonnen habe, daß mir aber unter der Ungunst der geschilderten Verhältnisse der zweifellos ebenso interessante Einblick in den andern Teil des Kulturbesitzes, in die Sitten und Gebräuche und die Anschauungen der Schwarzen über dies und das, in einem unerwünscht hohen Grade entgangen ist. Doch auch da hat Nils Knudsen rasch einen wirksamen Trost zur Hand. „Was wollen Sie, Herr Professor?“ sagt er. „Die Leute hier sind ja doch eine schrecklich zusammen- und durcheinandergewürfelte Gesellschaft, bei der alles Ursprüngliche verwischt und bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen worden ist; verlieren Sie hier in dem greulichen Massassi doch keine Zeit mehr, sondern kommen Sie mit nach Chingulungulu; Sie können gar nicht ahnen, wie schön es dort ist.“
[S. 141]
Der frühe Morgen des 31. Juli hat mir eine wundervolle geographische Überraschung gebracht. Die Barrabarra verläuft, wie ich schon einmal bemerkt habe, im Massassibezirk unmittelbar am Ostfuße der großen Inselbergkette. Dieser Fuß ist immerhin ziemlich erheblich mit Verwitterungsprodukten der großen Gneiskuppen aufgefüllt, so daß die Straße einen weiten Ausblick in die Ebene nach Osten und Süden gewährt. In die Ebene? Ein Meer ist es, was sich da vor unseren Augen ausbreitet, ein weißes, unendlich weites Meer, und ein an Inseln reich gesegnetes. Hier ein Eiland und dort ein anderes, und dahinten am verschwimmenden Horizont gleich ganze Archipele. Ziemlich hart am Strande dieses Ozeans wandert der lange Zug der Karawane dahin; auch wir befinden uns demnach wohl auf den Rändern einer solchen Insel. Und so ist’s. Es ist eben nur ein Nebelmeer, was sich da heute vor unseren Augen ausbreitet und über dessen Spiegel die unabsehbare Schar der Inselberge regellos die zackigen Häupter erhebt. Gleichzeitig ist dieses vor dem aufsteigenden Tagesgestirn rasch vergehende Gebilde ein wunderbarer Spiegel einer weitentlegenen Vergangenheit. So und nicht anders muß diese Gegend ausgesehen haben — einmal oder mehrfach, wer vermag das zu sagen —, wenn die blauen Wogen uralter Ozeane dort rollten, wo jetzt der blaue Rauch niederer Negerhütten zum Himmel aufsteigt.
Unser erstes Tagesziel war Mwiti. Nach der Einzeichnung auf der Karte zu urteilen, mußten wir eine stattliche Negersiedelung erwarten. Unmittelbar vor der Missionsstation Massassi biegt der Weg nach Mwiti rechts von der Küstenstraße ab. Ich lasse halten; die Kolonne schließt auf. „Wapagasi kwa Lindi, die Träger für Lindi!“ rufe ich laut in den frischen Morgen hinein. Wie ein Schiff der Wüste pendelt ein baumlanger Träger heran. Es ist Kofia tule, der älteste und gleichzeitig auch der längste meiner Träger, ein Mnyamwesi von ausgesprochenstem Massaitypus. Sein Name verursachte mir in der ersten Zeit unseres Zusammenwirkens manches Kopfzerbrechen. Daß Kofia Mütze hieß, wußte ich, aber auf den Gedanken, im[S. 142] Wörterbuch nach der Bedeutung des Wortes tule nachzusehen, kam ich merkwürdigerweise nicht; zudem nahm ich an, es sei ein Kinyamwesi-Wort. Daß es was Drolliges sein mußte, konnte ich mit einiger Sicherheit dem allgemeinen Gelächter der anderen entnehmen, sooft ich mich von neuem nach dem Sinn dieses Namens erkundigte. Schließlich haben wir es herausgebracht: Kofia tule heißt niedrige Mütze. Das ist an sich schon ein seltsamer Name für einen Menschen; als Bezeichnung für diesen schwarzen Übermenschen mit dem unglaublich unintelligenten Gesicht wirkt er doppelt lächerlich.

Also Kofia tule tritt langsam heran; hinter ihm ein halbes Dutzend weitere Wanyamwesi und mehrere Söhne des Landes selbst, die ich zur Fortschaffung der Lasten als Hilfsträger gedungen habe. Kofia tule soll sie alle als Mnyampara nach Lindi hinunterführen, allwo meine Sammlungsgegenstände in den Kellerräumen des Bezirksamtes bis zu meiner eigenen Rückkehr an die Küste lagern sollen. Er bekommt noch einmal meine Instruktion; dann kommandiere ich: „Ihr hier, ihr[S. 143] geht links; wir anderen gehen rechts. Los!“ Die Marschordnung will heute noch nicht so recht funktionieren; doch schließlich ist alles wieder in der richtigen Reihenfolge. Ein Blick nach Norden hinüber lehrt uns, daß auch Kofia tule mit seinen Getreuen das richtige Safaritempo angeschlagen hat; da tauchen wir auch schon im unbesiedelten, jungfräulichen Pori unter.
Der Marsch in diesem lichten Urwald hat etwas Monotones, Ermüdendes an sich. Es geht bereits stark auf Mittag; schläfrig sitze ich auf meinem Maultier. Da, was ist das? Ein paar schwarze Gestalten, das Gewehr schußfertig in der Hand, lugen vorsichtig um die nächste Waldecke herum. Sind das Wangoni? — —
Seit Tagen schon umschwirren uns Gerüchte von einem Überfall, den Schabruma, der berühmte Wangoniführer im letzten Aufstand und der einzige Gegner, den wir auch bis heute noch nicht untergekriegt haben, gerade auf diese Gegend plant; er soll es auf Nakaam abgesehen haben. Gerade will ich mich nach meinem gewehrtragenden Boy umsehen, um mich in einen etwas verteidigungsfähigeren Zustand zu versetzen, da erschallt von hinten aus einem Dutzend Kehlen der Freudenruf: „Briefträger!“ Ich hatte bis dahin noch keine Erfahrung über den Betrieb unserer deutschen Reichspost im dicksten Afrika; nunmehr weiß ich, daß dieser Betrieb direkt mustergültig, wenn auch für die Unternehmerin keineswegs lukrativ ist; es mag wie eine Hyperbel klingen, entspricht aber trotzdem der Wahrheit, daß dem Adressaten jede Postsendung, und sei es eine einsame Ansichtskarte, unverzüglich zugestellt wird, ganz gleich, wo er sich im Bestellbezirk befinde. Für die schwarzen Stephansjünger oder Krätkemänner, wie man die schwarzen Läufer wohl zeitgemäßer nennen muß, erstehen damit ganz andere Bestellgänge als für unsere heimischen Beamten mit ihren wenigen Meilen am Tage. Briefe und Drucksachen in eine wasserundurchlässige Umhüllung von Ölpapier und Wachstuch verpackt, das Vorderladegewehr stolz geschultert, so zieht der Bote seines Wegs dahin; er legt ganz ungeheure Entfernungen zurück, Strecken, welche die einer[S. 144] gewöhnlichen Karawane oft um das Doppelte übertreffen sollen. Führt der Weg durch unsichere Gebiete, wo Löwen, Leoparden und feindliche Menschen den einzelnen gefährden können, so wächst der friedliche Botengang sich zu einer richtigen Patrouille aus, denn dann marschieren die Männer zu zweien.
Rasch sind die beiden schwarzen Gestalten herangekommen; stramm und exakt nehmen sie Gewehr bei Fuß und melden ganz ordnungsgemäß: Briefe von Lindi für den Bwana kubwa und den Bwana mdogo, für den großen Herrn und den kleinen Herrn. Solange der kaiserliche Bezirksamtmann Herr Ewerbeck bei uns weilte, war die Abstufung für die Neger nicht leicht gewesen; ich galt bei ihnen ja als ein neuer Hauptmann, und den konnten sie doch unmöglich als den Bwana mdogo bezeichnen. Jetzt aber sind sie aus aller Not; wir sind nur noch zwei Europäer, von denen ich einmal der ältere, sodann auch der Expeditionsführer bin; somit steht dieser im ganzen Osten üblichen Rangabstufung kein Hindernis mehr im Wege.
Es ist bereits weit über Mittag geworden; die vordem flachwellige Ebene hat längst einem starkzerschnittenen Hügelgelände Platz gemacht; silberklare Bäche kreuzen alle Augenblicke in senkrecht eingeschnittenen, für mein Reittier und die schwerbepackten Träger nur schwierig zu passierenden Schluchten unseren Weg. Die Vegetation ist dichter und grüner geworden; aber auch um so heißer und stickiger ist jetzt die Glut gerade in jenen schmalen Tälern. Trotzdem ist die Anhänglichkeit an die Heimat, an Weib und Kinder größer als die Sorge um die Fährlichkeiten des Weges; unbekümmert um die hundert starken Baumstämme, die sich quer über den schmalen Negerpfad gelegt haben, nicht achtend aus Dornen und Busch, versuche ich im Sattel meines träge dahinziehenden Maultiers den Inhalt der reichen Post zu genießen. Weit voran marschiert der Führer. Es ist Salim Matola, der schlanke Allerweltskünstler, den ich tags zuvor seiner zahllosen Tugenden wegen durch einen festen Kontrakt an meine Person[S. 145] gekettet habe; er ist feierlich und vor versammeltem Volk zu meinem Hof- und Leibsammler ernannt worden. Vollkommen konsequent hat er diese Tätigkeit damit zu beginnen versucht, daß er sogleich einen stattlichen Vorschuß erheischte. Ländlich sittlich. Leider zieht so etwas bei mir längst nicht mehr, dazu bin ich doch schon zu afrikaerfahren. „Zeig erst einmal, was du kannst,“ heißt es da recht kühl meinerseits, „dann kannst du nach einigen Wochen wiederkommen; und nun geh, aber etwas plötzlich!“
Salim hat geschworen, den Weg ganz genau zu kennen; die Karte ist hier etwas unzuverlässig; nach unserer Berechnung müßten wir längst in Mwiti sein. Mit einem plötzlichen Entschluß hämmere ich meinem im schönsten Träumen dahinpendelnden Maultier die Absätze in die Weichen, so daß es erschreckt einen kurzen Galopp anschlägt, und sprenge zu dem mit langen Schritten weit voraneilenden Führer vor. „Mwiti wapi? Wo liegt Mwiti?“ herrsche ich ihn an. „Si jui, bwana, ich weiß es nicht, Herr“, kommt es jetzt ziemlich kläglich aus dem Munde meines Vertrauten. „Simameni, das Ganze halt!“ brülle ich, so laut ich kann, zurück. Großes Schauri. Von meinen Trägern ist keiner landeskundig; auch von den Askari und ihren Boys scheint keiner mit diesem durchschnittenen Gebiet vertraut zu sein. Ergebnis also: Marschieren nach der Karte, das heißt für uns kurz, aber wenig erfreulich: Das Ganze kehrt, marsch zurück bis zum Mwitibach und diesen aufwärts, bis wir an das gleichnamige Nest selbst kommen. Ziemlich spät am Nachmittag haben wir auch endlich das immer sehnsüchtiger herbeigewünschte Ziel erreicht. Salim Matola aber brachte mir jetzt unter Protest ein halbes Rupienstück zurück, von dem er behauptete, es sei „schlecht“. Es war nun keineswegs schlecht, sondern lediglich das Kaiserbildnis war ein ganz klein wenig verletzt. Des jungen Mannes Abgang ist in diesem Fall nicht gerade sehr langsam gewesen. Was doch ein energischer Griff nach dem Kiboko, der Nilpferdpeitsche, für Wunder tut! Aber so ist der Neger nun einmal.
[S. 146]
Afrika ist der Erdteil der Gegensätze. In Massassi mit seiner Höhenlage zwischen 400 und 500 Meter war es im allgemeinen ganz angenehm kühl gewesen; die Niederung zwischen den Inselbergen und dem Makondeplateau hatte uns beim Durchmarsch halb gebraten; in Mwiti hätte man gerne einen recht dicken Pelz gehabt, so rauh und schneidend kalt fegt von Sonnenuntergang an ein sturmartiger Wind von dem kühlen Hochland mit seinem Luftdruckmaximum hinunter in die soeben noch sonnendurchglühte Ebene mit ihren stark aufgelockerten Luftschichten. Und gerade unser Lagerplatz war ein Windfang sondergleichen. Mit geradezu verblüffendem strategischem Scharfblick hat Nakaam als Bauplatz für sein hiesiges Palais die Nase eines langgestreckten Höhenzuges gewählt, der ganz steil auf drei Seiten zu einer scharfen Schleife des Mwitiflusses abfällt; nur nach Süden zu besteht ein bequemer Zugang. Wenn ich sage Palais, so ist das wirklich nicht übertrieben. Nakaam steht nicht nur im Ruf, der geriebenste aller Neger des Südens zu sein, sondern er muß auch für Negerverhältnisse ganz beträchtliche Barmittel besitzen, denn sonst hätte er sich doch kaum einen bewährten Küstenbaumeister leisten können. Der hat nun ein wahrhaft stolzes Haus mit vielen Zimmern unter einem steilen, hohen Dach errichtet. Die Zimmer sind nicht einmal dunkel, sondern besitzen wirkliche Fensteröffnungen. Wo sich aber der Harem des Negergewaltigen befindet, da sind diese Fensteröffnungen durch Jalousien verschließbar. Die Krone endlich hat der Baumeister seinem Werk dadurch aufgesetzt, daß er alles Holzwerk im typischen Küstenstil mit Kerbschnittarabesken verziert hat. Verwundert mustere ich von meinem Liegestuhl aus, in den ich mich ermüdet geworfen habe, die von breiter Veranda überschattete Fassade des in seiner Umgebung doppelt merkwürdigen Gebäudes. Mit einem Male reißt’s mich nach oben; über das Gewirr der Reisekisten und Blechkoffer, die von den Trägern soeben unter der Veranda niedergelegt worden sind, springe ich hurtig an eins der Fenster. Ei, was muß ich sehen! Eine Swastika, ein Hakenkreuz, das uralte Zeichen des Glücks, hier[S. 147] mitten im dunkeln Erdteil! „Auch mir sollst du Glück bringen“, murmele ich halblaut, doch immer noch höchst verwundert. In sauberer, aus Elfenbeinplättchen gefertigter Einlegearbeit tritt mir in der Tat ein Gebilde entgegen, das eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem bekannten Zeichen aufweist. Unmittelbar nach unserer Ankunft haben wir einen Eilboten nach Chiwata hinaufgeschickt mit dem Auftrage, Nakaam nach Mwiti einzuladen. Kaum vier Stunden später ist der Häuptling angelangt. Eine meiner ersten Fragen nach der üblichen würdevollen Begrüßung ist die nach Namen und Bedeutung des merkwürdigen Elfenbeingebildes in seiner Hauswand gewesen. Ich erwartete, den Ausdruck tiefster Symbolik zu vernehmen; um so größer war meine Enttäuschung, als Herr Nakaam mir schlicht und leichthin antwortete: „Nyota, ein Stern“. Die Swastika ist demnach hier beim Neger des Innern zweifellos etwas Fremdes und Uneingebürgertes; im vorliegenden Fall ist sie, wie auch das übrige Ornament, eine Einfuhr des Küstenbaumeisters.
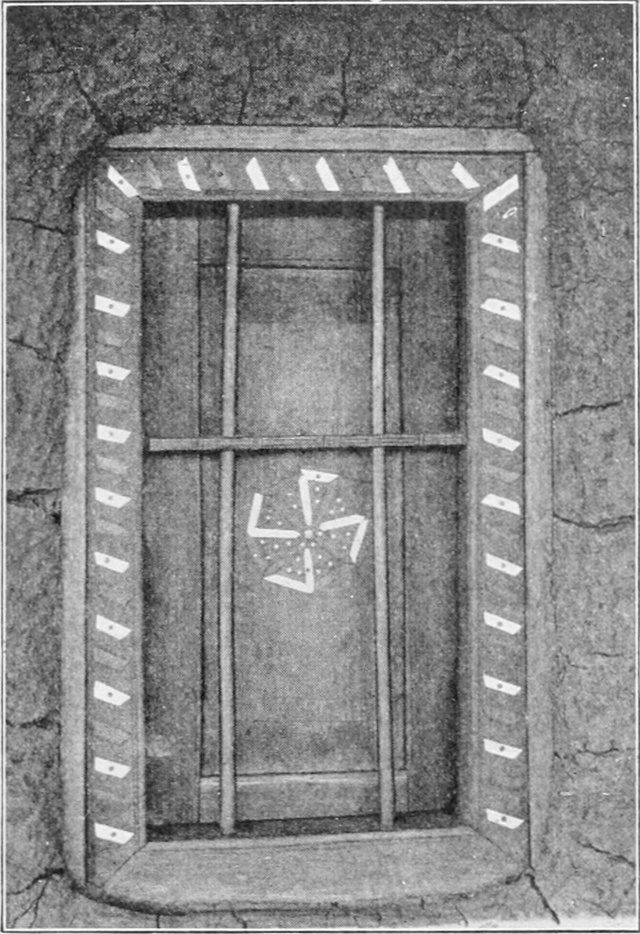
In Mwiti sind wir anderthalb Tage und zwei Nächte verblieben. Für das Wachstum meiner ethnographischen Sammlung ist dieser Aufenthalt sehr wenig fruchtbar geworden, denn entweder hatte Nakaam wenig Einfluß auf seine Untertanen, oder aber die Zahl dieser[S. 148] Untertanen kann nicht übergroß sein. Beurteilen kann der flüchtig Durchreisende dies nicht, denn das stark gebirgige Gelände läßt immer nur ein kleines Gebiet übersehen. Bei der weitläufigen Wohnweise der hiesigen Stämme gibt das kein Bild vom Ganzen.
Um so mannigfaltiger und interessanter sind auch hier wieder meine psychologischen Beobachtungen gewesen. Nakaam selbst ist ein sehr behäbiger, untersetzter Mann in mittleren Jahren, ganz nach Suaheliweise in ein weißes Kansu, das hemdartige lange Obergewand, gekleidet. Über seine Stammeszugehörigkeit war ich bereits vorher unterrichtet worden; die bierfröhlichen Männer von Massassi hatten mir mit hämischem Grinsen erzählt, Nakaam gebe sich zwar aus Eitelkeit für einen Yao aus, er sei aber in Wirklichkeit doch „nur“ ein Makua.
Abends saßen Nakaam, Knudsen und ich unter der Veranda beim traulichen Schein der Tippelskirchlampe, deren lichtspendende Tätigkeit heute allerdings mehr als je gefährdet war. Wohl hatten wir alle verfügbaren Decken und Matten an der Windseite als Schutz anbringen lassen, aber dennoch verlöschte das Licht unter den Böen des vom steilen Plateaukamm herniederbrausenden Sturmes mehr als einmal. Mit Würde hat Nakaam zwei Flaschen sogenannten Yumbenkognaks, die sich in meinen Vorräten befinden, entgegengenommen. Die Unterhaltung hat sich bis jetzt um Chiwata, seine Lage, seine Bevölkerungszahl, deren Stammeszugehörigkeit und ähnliches gedreht. Wir haben festgestellt, daß Nakaams Untertanen vorwaltend Wayao sind. „Und du,“ fahre ich fort, „bist du auch ein Yao?“ „Ndio, jawohl“, klingt es sehr überzeugungsfest zurück. „Ja aber,“ kann ich mich nicht enthalten ihm zu erwidern, „alle Männer hier im Lande sagen, du seiest kein Yao, sondern ein Makua.“ Der Neger kann leider nicht rot werden, es wäre sonst zweifellos sehr interessant gewesen, festzustellen, ob auch dieser edle Vertreter jener Rasse diesem Reflex unterworfen war. So krümmte er sich eine Weile, und dann kam es in einem unnachahmlichen Tonfall heraus:[S. 149] „Vor ganz langer Zeit, da bin ich freilich einmal ein Makua gewesen, aber jetzt bin ich schon lange, lange ein Yao.“
Dem der Völkerkunde Afrikas Fernerstehenden wird diese Metamorphose etwas seltsam erscheinen; man kann sie auch nur verstehen, wenn man sich die Bevölkerungsvorgänge gerade dieses Erdenwinkels im Laufe des letzten Jahrhunderts vergegenwärtigt. Noch zu Zeiten Livingstones, also vor 50 und 40 Jahren, herrscht im ganzen Rovumagebiet eine himmlische Ruhe; die alteingesessenen Völker bauen ihre Hirse und ihren Maniok und gehen auf die Jagd, sooft es ihnen behagt. Da brechen vom fernen Südafrika her in verschiedenen Wellen feindliche Elemente ins Land; westlich und östlich vom Nyassasee wälzt es sich nach Norden. Reisige Scharen sind es, die in überraschendem, sich durch nichts verratendem Angriff die wenig wehrhaften alten Völker über den Haufen werfen und aufrollen. Erst in der Höhe des Nordendes vom Nyassa kommt die Flut zum Stehen; ein paar Sulureiche — denn Angehörige dieses kriegerischen, tapferen Volkes sind diese neuen Eindringlinge — werden gegründet, und man richtet sich ein.
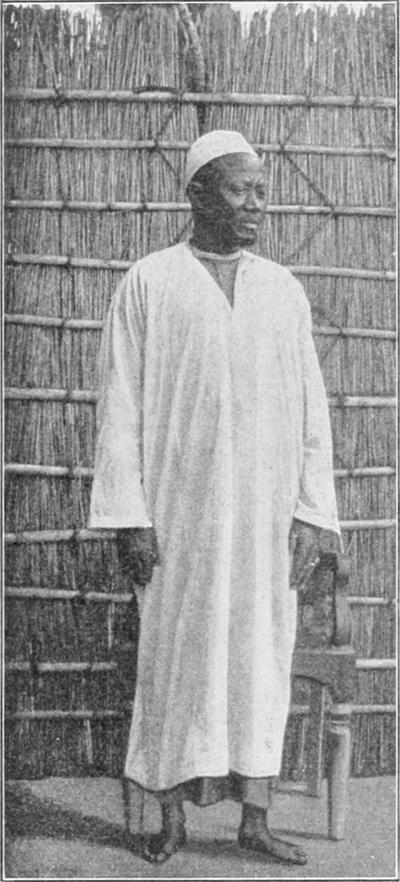
Doch welche Folgen hat diese Einrichtung für den ganzen Osten Afrikas gezeitigt! In immer und immer wiederholten Kriegs- und Raubzügen über viele Hunderte von Kilometern haben die neuen Herren des Landes aus dem alten, dichtbebauten Gebiet eine Einöde[S. 150] gemacht. Unter dem Namen der Masitu sind sie schon am Ende der 60er Jahre der Schrecken zwischen Nyassa und Tanganyika; unter dem Namen der Mafiti sind sie später, in den ersten Zeiten unserer deutschen Kolonialherrschaft, der noch weit größere Schrecken des ganzen riesigen Gebietes zwischen dem Nyassa und der Ostküste; unter den weiteren Bezeichnungen Wamatschonde, Magwangwara und Wangoni spricht man von ihnen an den Lagerfeuern der Karawanen mit unangenehmen Gefühlen. Heute indes ist dieser Schrecken kaum mehr gerechtfertigt, denn gerade im Laufe der letzten Jahre ist es auch mit der Vorherrschaft dieser Sulu zu Ende gegangen; die deutschen Hiebe sind doch zu nachhaltig gewesen. Nur ein einziger ihrer Führer, der bereits obenerwähnte Schabruma, macht mit einer kleinen Schar von Anhängern noch das Land unsicher; alle anderen haben sich unseren Friedensbedingungen rückhaltlos unterworfen.
Diese Wangoni-Einwanderung — Wangoni ist der Name, unter dem wir heute nach stillschweigender Übereinkunft alle diese eingewanderten südafrikanischen Elemente zusammenfassen — ist zunächst die Ursache für den folgenden seltsamen Vorgang geworden.
Die alteingesessenen Völker, soweit ihre Männer nicht von den Wangoni erschlagen, ihre Frauen und Kinder nicht in die kühlen, feuchten Gefilde am Ostufer des nördlichen Nyassa abgeführt und dem Stammestum der Wangoni einverleibt worden waren, sahen, daß der Mgoni mit seinem kurzen Speer, seinem ovalen Fellschild und seinem phantastischen Schmuck aus Geierfedern, Fellstreifen vom Leoparden, der Wildkatze und ähnlichem Getier, unwiderstehlich war. Daß diese Unwiderstehlichkeit nur zu einem sehr geringen Teil auf dem furchtbaren Äußern des Feindes beruhte, in Wirklichkeit vielmehr in der größeren Tapferkeit und dem geschlossenen Angriff der Kaffern mit dem kurzen, festen, im Handgemenge allerdings schrecklichen Speer bestand, haben die Leute hier nie begriffen. Sie nahmen den Schein für die Wirklichkeit, kleideten sich fortan wie die Wangoni und suchten auch deren sonstige kriegerische Ausrüstung nachzuahmen. In diesem Zustande befinden sich diese[S. 151] Völker auch heute noch. Biologisch läßt sich dieser ganze Vorgang als eine Art Mimikry auffassen, die auch deswegen überaus interessant ist, weil sie weiter im Norden der Kolonie, am Kilimandscharo und in den Gegenden westlich und südwestlich davon, ihr genaues Gegenstück gefunden hat. Dort haben die alteingesessenen Bantuvölker die Erfahrung gemacht, daß die Massai mit ihren Riesenspeeren, ihren großen, festen Lederschilden und ihrem phantastischen Kriegsschmuck ihnen weit überlegen waren; flugs haben auch sie ihre Schlüsse daraus gezogen, und heute trifft man alle diese Völker, die Wadschagga, Wapare, Wagueno, Wagogo usw. in einer Verfassung, die den ihnen beigelegten Spottnamen der Massai-Affen sehr gerechtfertigt erscheinen läßt.
Hier im Süden ist indessen mit der Nachäffung der Wangoni die Mimikry im Negerleben noch nicht erschöpft. Veranlaßt durch die ungeheuer weitgreifenden Wirren, die seit dem 1818 erfolgten Auftreten des Sulukönigs Tschaka den ganzen Osten des Erdteils nicht wieder zur Ruhe haben kommen lassen, sind auch andere Völkerschaften als die Sulu selbst von einer süd-nördlichen Wandertendenz ergriffen worden. Das sind vor allem die Makua und die Wayao; jene drängen aus ihren Ursitzen zwischen dem Rovuma im Norden und dem Sambesi im Süden langsam aber nachhaltig über den Rovuma hinüber ins deutsche Schutzgebiet hinein, die Wayao aber kommen ebenso unmerklich, doch vielleicht noch nachhaltiger aus dem weiter westlich gelegenen Gebiet am Südende des Nyassa aus südöstlicher Richtung zu uns herüber. So stoßen beide Völkerwellen gerade hier in meinem Forschungsgebiet im spitzen Winkel zusammen, und das ist gerade einer der Hauptgründe für mich gewesen, statt nach dem aufstanddurchloderten Iraku hier nach dieser entlegenen Ecke zu reisen. Nun scheint es den Makua oder doch wenigstens einzelnen von ihnen zu ergehen wie so manchem Deutschen im Auslande: er sieht sich und sein Volkstum als etwas Minderwertiges und Verächtliches an und hat nichts Eiligeres zu tun, als die letzte Erinnerung an Vaterland und[S. 152] Muttersprache zugunsten der neuen Nationalität abzustreifen. Hier im Lande sind, nachdem der Wangonischrecken seit den 1880er Jahren, dem Zeitraum der letzten Einfälle, im Bewußtsein der heranwachsenden Generation verblaßt ist, die Wayao die Vornehmen; was Wunder, wenn gerade eine so eitle Persönlichkeit, wie Nakaam es unzweifelhaft ist, sein eigentliches Volkstum glatt verleugnet, um als vollwertig und ebenbürtig zu gelten.
Höchst spaßhaft klingt es, wenn die Angehörigen der hiesigen Sprachen einen Begriff als etwas ganz Außerordentliches hervorheben wollen, z. B. als sehr hoch oder sehr weit entlegen, als sehr schön oder in ferner Zukunft erst zu erwarten, und dergleichen. Das tun diese Leute durch eine unnachahmliche Hinaufschraubung des betreffenden Adjektivs oder Adverbs zur höchsten Fistel. Ich werde später noch auf diesen sprachlich so ungemein interessanten Punkt zurückkommen; jetzt kann ich nur mit innigem Behagen an mein Lustgefühl zurückdenken, welches ich empfand, als Nakaam in seinem „Mimi Makua, lakini ya samāni, ich bin ein Makua, aber einer von ganz, ganz weitentlegener Zeit“, die beiden Silben „māni“ so lang dehnte und das „ni“ so in die Höhe schraubte, daß man fürchten konnte, er möchte den Rückweg zur Gegenwart nicht wiederfinden.
Also Nakaam war, wenn auch nicht gerade zu seiner freudigen Genugtuung, seiner eigentlichen Stammeszugehörigkeit überführt worden. Gerade wollten wir zu einem anderen, für ihn erquicklicheren Gesprächsgegenstande übergehen, da saßen wir plötzlich im Dunkeln. Das Brausen des Sturmes war im Lauf des Abends immer stärker, die Böen waren immer häufiger und heftiger geworden; jetzt umraste ein wirklicher Orkan Swastikapalais und Zelte; unsere Matten und Decken schlugen uns wie gepeitschte Segel um die Ohren. Das schwere Hausdach ächzte und stöhnte in allen seinen Bindelagern; unsere Zelte hielten nur mit sichtlicher Mühe dem riesigen Winddruck stand. Jeder Versuch, die Lampe wieder zu entzünden, wäre vergeblich und im Hinblick auf die ganze Umgebung auch im höchsten Grade feuergefährlich[S. 153] gewesen. So blieb denn nichts anderes übrig, als die Unterhaltung für dieses Mal gerade da abzubrechen, wo sie anfing interessant zu werden, und sich in sein Tippelskirchbett im Zelt zu verkriechen.
Mit dem Schlaf in Afrika ist es ein eigen Ding. Freilich, die riesenbreiten Eisenbettstellen der Küste gewährleisten einen Schlummer, wie er erquicklicher auch bei uns im kühlen Europa nicht gedacht werden kann; die Trogform des Safaribettes ist an sich schon weniger bequem; kommt nun zu dem Temperaturminimum etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang, das den Schläfer stets erwachen und nach einer zweiten Decke greifen läßt, auch noch das Hustenkonzert einer größeren Karawane, dann ade süßer Schlummer! Bei unserem Marsch von Lindi bis Massassi hatte sich die große Schar der Polizeisoldaten stets im engen Kreis, die Köpfe nach außen, um unsere Zelte gelagert; dann war in den schneidend kalten Nächten von Nangoo und Chikugwe alsbald ein Gehuste und Gespucke losgegangen, daß man wirklich nicht wußte, ob man die unglücklichen frierenden Kerle draußen oder aber sich selbst mehr bedauern sollte. Hier in Mwiti hätte ich meine Leibgarde wie auch meine Träger sehr gern weit von unserem Zeltplatz untergebracht, aber der kommandierende Gefreite hat mir erklärt, daß das nicht gehe; die Wangoni seien im Anzuge. So hat sich mein Dutzend Krieger, denn so viel hat mir Herr Ewerbeck als Schutztruppe mitgegeben, wieder rings um uns herum gelagert; wieder tönt das Gehuste ohne Unterlaß in mein warmes Zelt hinein, so daß an Schlaf kaum zu denken ist; aber diesmal ist das Mitleid mit den Kriegern doch größer als der Ärger über die unausgesetzte Störung. Und es ist auch nur zu berechtigt. Die kleine Ebene vor Nakaams Palais, auf der wir lagern, ist fast baumlos; steil von oben, durch nichts aufgehalten, stürzt auf sie der eisigkalte Plateauwind herunter. Zwar hat sich jeder Soldat neben der Matte, auf der er liegt, und dem Pfahl, an dem Gewehr und Patronengürtel hängen, ein kräftiges Feuer gemacht, doch was nützt das den Männern, deren Körper durch das dünne Khaki trotzdem einer ungehinderten Ausstrahlung ausgesetzt sind.
[S. 154]
Es begreife die Negerseele wer da kann. Ich habe am nächsten Morgen Soldaten und Träger versammelt und habe ihnen gesagt: „Kerls, ihr friert doch wie die Schneider; gleich geht los und baut euch Strohhütten, oder, wenn euch das zuviel ist, wenigstens Windschirme.“ „Ndio, Bwana, jawohl, Herr!“ hat die ganze Schar geantwortet; als ich mich aber am Nachmittag erkundigte, wo denn ihre Bauten seien, da kam’s heraus: ich marschiere, hieß es, doch bald weiter, da hätte es keinen Zweck, erst noch Wände zu bauen. „Gut,“ habe ich ihnen da sehr kühl erwidert, „dann friert ihr eben. Wer mir aber in den nächsten Tagen mit Katarrh kommt — fügte ich für mich in Gedanken hinzu —, den werden wir zur Abwechselung einmal nicht mit dem lieblichen Aspirin behandeln, sondern mit Chinin, notabene ohne Wasser, und kauen sollen die Burschen diese schöne, kräftige Daua vor meinen Augen.“ So verdirbt Afrika den Charakter, leider nicht nur den der Schwarzen.
Mein zweiter Tag in Mwiti hat mir auch noch manches Lehrreiche geboten. Mir mußte das Fieber, von dem ich soeben erst erstanden bin, bereits in den Gliedern stecken; in merkwürdiger körperlicher Erschlaffung war ich vormittags in meinem Liegestuhl unter Nakaams Barasa sanft entschlummert. Klatsch — huuh; klatsch — huuuh; klatsch — huuuh, tönt es dem Erwachenden ans Ohr. Ein Blick nach links lehrt mich, daß der blonde Nils in seiner Eigenschaft als interimistischer Unterpräfekt wie ein zweiter Salomo als Richter waltet. Nun kenne ich zwar Gerichtssitzungen schon seit Lindi, aber sie sind hier immer interessant, und so war ich im nächsten Augenblick zur Stelle. Der Delinquent hatte unter bedeutendem Wehgeheul inzwischen seine fünf wohlgezählten Hiebe erhalten; er stand jetzt wieder aufrecht und rieb sich mit erklärlichen gemischten Gefühlen die wunde Stelle; doch frech sah er immer noch aus. Nach gegenwärtiger Landessitte etwas angesäuselt, hatte er sich im Verhör erkühnt, Nils Knudsen mit einem besonderen Namen, anscheinend dem Spitznamen des Norwegers bei den Negern, zu belegen; dies durfte natürlich nicht ungerochen[S. 155] bleiben, und daher die Exekution. Der Neger betrachtet sie übrigens als ganz selbstverständlich; er würde sich aufs höchste wundern, wenn nicht jede Ungebühr in dieser Weise und ohne Verzug gesühnt würde, ja er würde uns direkt für schlapp und keineswegs als seine Herren betrachten.

Einen ebenso tragikomischen Anstrich hatte auch der nächste Fall, zu dem ich ebenfalls erst am Schluß des Verhörs der drei Beteiligten hinzukam. Ich sehe, wie der Gefreite Saleh mit einem derben Kokosstrick, wie er von den Trägern benutzt wird, ihre Last durch Umschnüren mit ihm handlich zu gestalten, über den Platz eilt. Im selben Augenblick hat er auch schon einem vor dem Richter Nils stehenden schwarzen Jüngling die Arme stramm auf dem Rücken gefesselt. Dieser hat die Prozedur stillschweigend über sich ergehen lassen; nun aber erhebt sich ein unglaublich lebhaftes Gerede. Mit einer Art Lassowurf hat Saleh einem ebendort stehenden jugendlichen Frauenzimmer, an dem mir nichts so sehr auffällt wie die geradezu hottentottenhaft weit ausladende Gesäßpartie, das andere Ende des Strickes um die Hüfte geworfen; blitzschnell ist auch sie gefesselt und gefangen. „Nanu, was ist[S. 156] denn hier los?“ wage ich in den merkwürdigen Auftritt hineinzuwerfen.
„Sehen Sie sich nur einmal den andern an“, sagt der moderne Salomo. „Dieser hier und das Weibsbild sind Mann und Frau; mit dem andern aber hat die Frau, während der Mann verreist war, monatelang zusammengelebt. Und als der ahnungslose Ehemann zurückkommt und das Pärchen hübsch beisammen findet, da hat ihn dieser Halunke hier zum Überfluß auch noch in die Hand gebissen.“
„So, und zur Belohnung binden Sie das saubere Pärchen nun auch noch zusammen?“
„Zur Belohnung gerade nicht, aber die beiden müssen nach Lindi hinunter zu ihrer Aburteilung — ein paar Monate Kette wird er wohl schon kriegen — und da weiß ich wirklich nicht, wie ich sie anders transportieren soll.“
Ich habe selten ein paar so vergnügte Gesichter gesehen wie die Visagen dieses netten Pärchens, als sie abgeführt wurden.
Schon den ganzen Tag hatte ich einen meiner Träger um mein Zelt herumschleichen sehen. Am Nachmittag kam der Bursche näher; er wolle Daua, sagte er. Wofür? frage ich ihn kühl. Für eine Wunde, lautet die Antwort. Ich, in der Meinung, der Mensch habe sich eine Verletzung auf dem Marsch zugezogen, lasse den braven Stamburi holen, jenen Askari, dem ich die therapeutische Behandlung aller jener Fälle anvertraut habe, die ich nicht selbst behandeln mag. Stamburi befreit mit nicht geringer Mühe das fragliche Bein erst von einer fingerdicken Dreckkruste; neugierig bin auch ich näher getreten, doch was muß ich sehen! Eine uralte Wunde vorn auf dem Schienbein, wie eine Handfläche groß, stinkfaul und bis auf den Knochen durchgefressen. Entrüstet fahre ich Herrn Cigaretti — so heißt der Schmierlümmel — an, er habe mich betrogen, er sei kein Träger, sondern ein Kranker, der ins Hospital gehöre; seine Wunde sei nicht frisch, sondern schon Monate alt; er werde mit der nächsten Gelegenheit nach Lindi hinuntergeschickt werden. Sehr ruhig und frech heißt[S. 157] es darauf: Lindi hapana, Bwana, er sei für sechs Monate gedungen, und eher zu gehen fiele ihm gar nicht ein. Ich bin nun in einer etwas unangenehmen Lage, da ich die bezüglichen Bestimmungen nicht kenne; behalte ich den Burschen bei mir, so wird er eines schönen Tags selbst transportunfähig oder geht wohl gar ein; jage ich ihn aber in den Busch, so fressen ihn die Löwen. In jedem Fall ist es mir sehr interessant, zu sehen, wie einseitig das Rechtsgefühl dieses braven Mannes ausgebildet ist; er besteht auf seinem Schein, jedoch nur soweit er ihm zu seinem Vorteil gereicht.
Und dann dieses schreckliche Wort hapana! Man würde die ganze schwarze Rasse am besten mit zwei kleinen Wörtern charakterisieren können. Das eine ist „hapana“, wörtlich: es ist nicht, es gibt nicht, verallgemeinert: nein; das andere lautet: bado, noch nicht. Einen von den beiden Ausdrücken bekommt man unter hundert Fragen mindestens 99mal zur Antwort. „Hast du das und das getan?“ oder: „Ist das und das zur Stelle?“ fragt der Europäer. „Bado“ heißt es das eine Mal, hapana zum andern. Ich habe schon den Vorschlag gemacht, die ganzen Bantu-Idiome des Ostens unter dem Kollektivbegriff des Kihapana oder des Kibado zusammenzufassen. Zunächst macht die Sache dem Weißen Spaß, zumal besonders das bado dem Gehege der Zähne mit einem Schmelz entflieht, daß jede höhere Tochter der sprachberühmten Städte Braunschweig und Celle über eine solche Geziertheit der Aussprache des „a“ neidisch werden könnte; hat man indessen immer bloß bado und immer bloß hapana zu hören bekommen, und niemals ein „Ndio“ oder ein „Me kwisha, ich bin fertig“, so wird man wild und greift am liebsten zum Kiboko. —
Gegen Abend dieses denkwürdigen Tages ist es, etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang. Mit keckem Schritt tritt ein kleines Bürschchen von 8 bis 9 Jahren an meinen Tisch heran, breitet auf mein „Karibu, tritt näher“, eine ganze Anzahl wunderhübsch verzierter, kleiner Kämme vor meinen Augen aus und bleibt in erwartungsvoller Pose stehen. Die Dinger sind in der Tat reizend; der eigentliche[S. 158] Kamm selbst ist aus feinen, gerundeten Holzstäbchen zusammengesetzt, der ganze Oberteil aber bedeckt mit buntfarbigem Stroh, das zu schönen geometrischen Mustern geordnet ist. „Wo werden die Dinger gemacht?“ frage ich den kleinen Kaufmann. „Karibu sana, hier ganz in der Nähe“, lautet die prompte Antwort. „Und wer macht diese Kämme?“ „Ein Fundi, ein Meister“, ertönt es daraufhin, etwas verwundert diesmal, denn der Weiße sollte doch billig wissen, daß hierzulande alles von Berufshandwerkern, von Fundi, gefertigt wird. Schnell werden wir handelseins, ebenso schnell habe ich meinen Tropenhelm mit dem leichten Filzhut vertauscht, habe noch Kibwana, der merkwürdig schnellfüßig mit einem rasch umgehängten Gewehr heranspringt, angeschnauzt, er solle seine Donnerbüchse nur ruhig wieder weghängen und so mitkommen, da sind wir auch schon mitten drin im schönen, grünen Urwald. Der kleine Mann eilt mit erstaunlich raschen Schritten fürbaß, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. „Na, wo ist denn dein Fundi?“ frage ich ihn schon ungeduldig. „Karibu sana“, tönt es beschwichtigend zurück. Aus den 15 Minuten werden 30, werden 40; die Sonne ist schon hinter dem nächsten Bergrücken verschwunden. Auf meine Anfragen stets eine ausweichende Antwort: Dort, wo die Schambe ist, dort wohnt der Fundi, oder aber: Unmittelbar hier vor uns, da ist es. Schließlich springe ich den kleinen, flinken Führer unversehens von hinten an, indem ich ihn in Ermangelung eines anderen passenden Angriffspunktes bei beiden Ohren nehme. Strenges Verhör unter sanfter Nachhilfe an den Ohrläppchen. Da kommt es denn heraus: es sei reichlich noch einmal so weit, als wir schon gelaufen seien, und es sei hoch oben in den Bergen. Demnach wäre ich also frühestens zwischen 7 und 8 Uhr ans Ziel gekommen, in vollkommen dunkler Nacht, gänzlich unbewaffnet, ohne jede Unterkunft. So weit ging meine Begeisterung für das Studium der Negertechnik denn doch nicht; ich zog, unter Zugrundelegung unserer europäischen Ansichten über Nah und Fern, aber zur schmerzlichen Verwunderung des Autochthonen, diesem noch einmal die Ohren[S. 159] lang, entließ ihn dann mit leichtem Klaps und zog unverrichteter Dinge wieder heim. Damals war ich stark entrüstet über dieses unberechenbare Negervolk; heute muß ich zugeben, daß es bei uns doch eigentlich wenig anders ist; dem einen sind 20 Kilometer ein Katzensprung, dem andern die halbe Meile ein Tagemarsch. Das aber habe ich schon gemerkt: der Neger rechnet ganz allgemein mit viel größeren Entfernungen und auch mit größeren Marschleistungen als wir. —
Wieder brennt die Lampe mit unsicher flackerndem Licht unter Nakaams Barasa. Zwar ist diese besser abgedichtet als gestern, aber der Sturm braust heute ungleich gewaltiger wie den Abend vorher.
„Und 60 Millionen Menschen wohnen in Uleia?“ fragt mich Nakaam ganz verwundert. „60 Millionen? Aber was ist eine Million? Ist es elfu elfu elfu, 1000 mal 1000 mal 1000?“
Donnerwetter, denke ich, der geht aber in die vollen; 1000 mal 1000 mal 1000, das ist ja eine Milliarde! 60 Milliarden Deutscher, armes Vaterland! Es lebe die Bevölkerungsstatistik!
Doch soll ich den Nigger enttäuschen? Keinesfalls; wir haben an Prestige sowieso nicht viel mehr zuzusetzen. So antworte ich ihm denn: Ndio, elfu elfu elfu und belasse es bei den 60 Milliarden.
Und wieviel Askari hat der Sultani ya Uleia, der deutsche Kaiser?
Hier konnte ich ruhig bei der Wahrheit bleiben, denn in bezug auf unsere Wehrmacht sind wir Gott sei Dank einstweilen noch allen möglichen Gegnern über.
„Wenn wir keinen Krieg machen, haben wir 600000 Askari; wenn wir aber Krieg machen, dann sind es 6 Millionen.“
Nakaam ist keiner von denen, die sich leicht imponieren lassen, aber als er jetzt stumm nachrechnete: 6 mal elfu elfu elfu, da wuchsen wir in seinem Ansehen ganz offensichtlich. Doch er ist nicht nur kritisch veranlagt, sondern auch mit der Tagesgeschichte wohlvertraut.
„Nicht wahr?“ sagt er, „in dem großen Kriege zwischen den Russen und den Japanern haben die Russen Haue bekommen?“ Diese[S. 160] Tatsache konnte ich allerdings mit dem besten Willen nicht wegleugnen, doch hielt ich es für durchaus angebracht, meiner bejahenden Antwort in einem Atem hinzuzufügen, das wolle nichts bedeuten, denn wir, die Wadachi, wir seien viel stärker als sie alle zusammen, als die Russen, die Japaner und auch die Engländer. Nakaam setzte jetzt endlich eine überzeugte Miene auf; aber ob sie wirklich echt gewesen ist, wer kann das bei diesem schlauen Fuchs ermessen.
In der Geographie hatte bis vor kurzem mein Boy Moritz die beste Note; er hielt seinen Freunden, und auch wer ihm sonst zuhören mochte, lange Kollegien über Uleia und Amerika, sprach von Berlin, Hamburg und Leipzig und erklärte dem wißbegierigen Auditorium mit gleichbleibender Geduld, welchen Daseinszweck auf dieser Erde nun auch ich, sein Herr und Gebieter, dort im fernen Uleia habe. Ich sei der Bwana kubwa eines großen, großen Hauses, und in diesem großen Hause, da seien die Matten und die Stühle und die Töpfe und die Löffel und die Kokosreiber aller Völker der Erde, und ich sei hier ins Land gekommen, um nun auch von hier alle diese schönen Dinge nach Uleia zu bringen. Moritz war also, das muß man billig anerkennen, ein ganz guter Interpret meiner Ziele, aber sein Ruhm war verblaßt, als ein paar Tage vor unserm Abmarsch von Massassi Ali, der Weitgereiste, von Lindi herauf nach Massassi gekommen war, um von neuem in Knudsens Dienste zu treten. Jetzt verstummte Moritzens quäkige Stimme, denn nun konnte Ali berichten, was er mit eigenen Augen in Berlin und Hamburg gesehen hatte. Als Diener eines weißen Herrn war er in der Tat im fernen Deutschland gewesen. Nur daß er Leipzig nicht kannte, betrübte ihn.
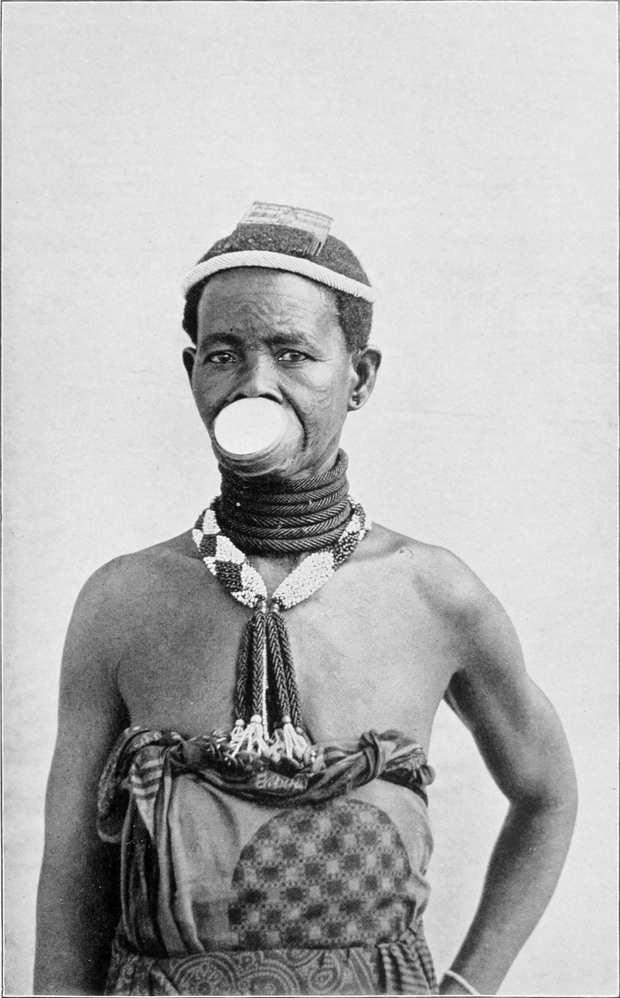
Nakaams topographische Kenntnisse waren, wie die Moritzens, auch nur theoretischer Natur; er kannte zudem nur Berlin. Doch welch tiefes Interesse hatte dieser Mann an allen möglichen Einzelheiten einer europäischen Stadt! Die Länge der Straßen wollte er wissen, die Höhe der Häuser, und wie man hoch oben auf diese Türme von Häusern hinaufkäme; und wieviel Menschen in einem Hause[S. 161] wohnten, und wo sie ihre Chakula, ihr Essen, kochten, und hundert andere Dinge mehr. Für mich mit meinem immerhin geringen Suaheliwortschatz war es natürlich ganz unmöglich, diese Wißbegier in ihrem ganzen Umfange zu befriedigen; um so dankbarer konnte ich Knudsen für seine Aushilfe sein.
Den nächsten Tag sind wir bis zu einem gottverlassenen Nest namens Mkululu marschiert; es ist noch auf keiner Karte verzeichnet. Wie stachen die elenden Hütten hier von Nakaams Palast ab, und wie unendlich schmutzig und verwahrlost waren Dorfplatz und Barasa! Beide bedurften erst einer gründlichen Reinigung, bevor wir unsere Zelte unmittelbar am Rasthaus selbst aufrichten konnten. Und doch müssen wir dem Schicksal danken, daß wir ganz instinktiv den Schutz dieses dörflichen Strohdaches gesucht haben. Der Sturm, der uns in Mwiti die Abende so verleidet hatte, setzte auch hier bald nach Sonnenuntergang ein. Im Freien wäre überhaupt keines Bleibens gewesen, so wirbelten Staub und Laub und Gras und Zweige in der Luft herum; doch auch unter der Barasa war es nicht zum Aushalten. Also marsch ins Zelt und ins warme Bett hinein. Aber was ist das? Das Bett will heute gar nicht warm werden; ich nehme zu der einen, gewohnten Kamelhaardecke noch die zweite. Es nützt alles nichts; ein wahnsinniger Frost schüttelt meine Glieder, und die Zähne klappern, daß es zeitweise selbst das Brausen des Sturmes übertönt. Dieses Brausen ist mit jeder Viertelstunde lauter und fürchterlicher geworden; ich schiebe mein Frieren auf den üblichen abendlichen Temperatursturz und stehe auf, um das Zelt noch dichter zu machen. Ich bin gar nicht einmal ganz aus seinem Innern ins Freie getreten; dennoch bin ich heilfroh, mich wieder in seinen Schutz zurückgerettet zu haben. Ein wahrer Hexensabbat umtobte Barasa und Zelt; heulend, sausend, pfeifend umrasten dicke Wolken von Staub und Unrat meine schwanke Segeltuchhütte, und wirbelnd umfaßte mich die Windsbraut, als ich nur ein wenig ins Freie trat. Dazu ein unaufhörliches Krachen und Brechen ringsum; starke Äste mußten es[S. 162] sein, die von den hohen Dorfbäumen herabgeschleudert wurden, und selbst die Bäume schienen einem solchen Aufruhr der Natur nicht standhalten zu können. Ich habe in jener Nacht kein Auge schließen können; der starke Schüttelfrost wich bald einem starken Schweißausbruch; nur der unerbittliche Zwang weiter zu marschieren, hat mich am frühen Morgen auf die Beine gebracht.


Über den Gewaltmarsch von Mkululu bis Chingulungulu möchte ich mich am liebsten ausschweigen; eine rühmliche Rolle kann ich in[S. 163] meinem Zustand in den Augen unserer Mannschaft an jenem Tage kaum gespielt haben. Auch Knudsen hatte Fieber. Am frühen Morgen, solange es noch kühl und der Wald frisch und grün war, ging es noch. Zwar mit dem Reiten war es nichts. Der Weg führte zunächst am Westfuß des Makondeplateaus entlang. Es ist dies ein Gebiet hoher Aufschüttung, zugleich auch eines starken Quellenreichtums. Alle paar hundert Meter steht infolgedessen die Karawane am Rande einer viele Meter tief senkrecht eingeschnittenen Schlucht, die sich die Gewässer in das lockere Erdreich gegraben haben. Unsicheren Fußes stolpert man den steilen Abhang hinunter; nur mit Anspannung aller Kräfte des fiebergeschwächten Körpers kommt man an der gegenüberliegenden Seite wieder hinauf. So geht das mehr als ein dutzendmal; da biegt der Führer vom Wege ab und verschwindet rechts im Pori. Dieses wird lichter und lichter, je weiter die Steilwand des Plateaus hinter uns zurückbleibt; schließlich ist es die typische lichte Baumgrassteppe: ein Baum genau wie der andere, frisches Grün nur hier und da; Unterholz auch nur spärlich, aber wo es auftritt, von dorniger Beschaffenheit; das Gras an den meisten Stellen bereits abgebrannt. Dann wirbelt in der glühenden Mittagshitze eine undurchdringliche Aschenwolke, hervorgerufen durch lokale Wirbelwinde, mehr wohl noch durch die Tritte der Marschierenden, um uns herum, alles mit einer dichten schwarzen Schicht überziehend. Ich habe die Zügel meines Tieres längst aus der Hand gelassen; zweimal ist es in seinem angeborenen Stumpfsinn und in seinem natürlichen Bestreben, stets den geraden Weg zu gehen, in einen Dornenbusch gelaufen, so daß ich wohl oder übel mich habe nach hinten fallen lassen müssen. Endlich die erste Erlösung: das stolze Haus des Yaohäuptlings Susa taucht vor uns auf; wenige Minuten später liegen Herren und Diener keuchend in seinem Schatten.
Es ist doch etwas Stolzes um die Willensstärke eines Vollkulturmenschen. Trotz unseres jammervollen Befindens hat es uns nicht[S. 164] fünf Minuten auf unseren Reisestühlchen gelitten, da standen Knudsen und ich auch schon in Susas Haus und fragten und forschten und skizzierten und sammelten. Dieses war auch sehr wohl angebracht, denn Susa scheint nicht nur persönlich ein ganz einzigartiger Vertreter seiner Rasse zu sein, sondern auch sein Haus ist eingerichtet, wie man es beim Neger niemals erwartet hätte. Er selbst mit langem, schwarzem Vollbart, gut und sauber in weiße Stoffe gekleidet, von intelligentem Gesichtsausdruck; seine Räume hoch, außerordentlich sauber mit Lehm ausgestrichen, hell und luftig. Der Herd ein wirkliches kleines Kunstwerk; zwar auch die üblichen drei kopfgroßen Steine, aber diese Steine liegen auf einer erhöhten Plattform aus Lehm, die sich die ganze Küche hindurch in Meterbreite an der Wand entlang zieht. Rings um das Feuer eine ganze Reihe höchst merkwürdiger, ebenfalls aus Lehm hergestellter Konsolen, die, wie der Augenschein lehrt, den rundbäuchigen Töpfen als Standfläche dienen. Und nun erst der Raum des Hausherrn selbst! Zu europäischen Kanapees, wie der Kamerunnigger sie längst in seiner Hütte besitzt, hat es der Ostafrikaner Gott sei Dank noch nicht gebracht; dafür sehen wir aber hier die Urform eines Ruhebetts: ebenfalls eine Plattform aus Lehm, 30 Zentimeter hoch, mehr als meterbreit, die Kanten nach außen abgeschrägt; als Ruhelager für Kopf und Oberkörper eine schiefe Ebene am oberen Ende; das Ganze endlich mit schönen, sauberen Matten überdeckt.
Und doch kann ein Mann wie Susa nicht aus seiner Haut. Nach Besichtigung aller Räume umschreiten wir das Haus. Was hängt denn da? rufe ich und greife nach einer prächtigen Leberwurst, die an einem fingerdicken Holzstabe von der Dachtraufe herniederhängt. Freilich, Form und Aussehen unseres heimatlichen, schätzenswerten Genußmittels hat das Ding wohl, auch führt der Baum, auf dem es heranreift, im Munde der Weißen tatsächlich den Namen Leberwurstbaum, aber im übrigen bestehen zwischen Leberwurst und Kigelia weiter keine Beziehungen. Nach einigem Zögern rückte Herr Susa mit einer Erklärung heraus. Es war natürlich eine Daua, eine Medizin oder ein[S. 165] Amulett oder wie man solch ein Schutzmittel nennen will. Die Frucht hatte die nicht leichte Aufgabe, das Dach des Hauses vor den Folgen der hier in der Ebene angeblich sehr häufigen, starken Windhosen zu schützen, von denen es hieß, sie trügen mit Vorliebe Hausdächer davon. Welche Ideenverknüpfung dazu geführt hat, der harmlosen Baumfrucht die Fähigkeit zuzusprechen, die Natur selbst in ihren stärksten Kraftäußerungen zu besiegen, war aus Susa nicht herauszubekommen.
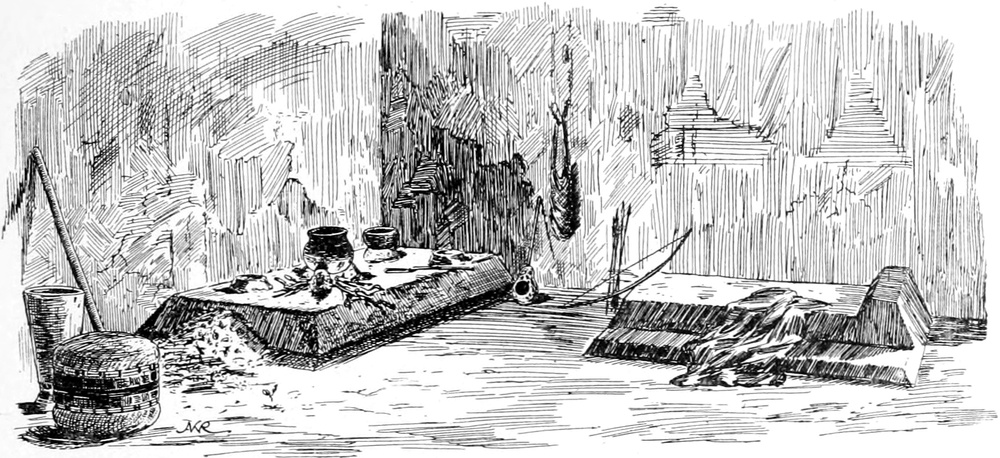
Auch der vorherige Marsch durch das Pori hat mir Gelegenheit zu ein paar hübschen Beobachtungen gegeben. In malerischem Durcheinander lagert meine Karawane zur Frühstückspause an einer verhältnismäßig grünen Stelle im Walde; Knudsen und ich sitzen etwas abseits, weil meine Geruchsnerven in diesem Fieberstadium noch sensibler sind als gewöhnlich. Da schlagen faule Witze an unser Ohr, ganz im Charakter der unserer Soldaten, wenn ein weibliches Wesen in Rufnähe an einer Kriegerschar vorüberkommt. Tatsächlich ist die Sachlage die gleiche; im Abstande von 20 bis 30 Metern sucht ein junges Weib die Gruppe der Fremdlinge zu umgehen. Das ist nun an sich weiter nichts Aufregendes, aber plötzlich rufen alle meine Mannen, die ja längst wissen, was mich am meisten interessiert: „Kipini, bwana, siehe den Nasenpflock, Herr!“[S. 166] Im nächsten Augenblick haben einige von ihnen die Maid auch schon zu uns herangeführt. Es ist allerdings ein ausnehmend herrliches Exemplar von Ebenholzpflock, was diese Schöne in ihrem linken Nasenflügel trägt, womöglich noch zierlicher und geschmackvoller mit Zinnpflöckchen ausgelegt, als man es sonst zu sehen gewohnt ist. Zuerst steht die Frau unsern Kaufangeboten glatt ablehnend gegenüber, schließlich aber scheint doch die Furcht vor so viel wild aussehenden fremden Männern wirksamer zu sein als selbst der Glanz eines Viertelrupienstücks. Zögernd fährt sie mit der Linken an die Nase, fast gleichzeitig folgt die Rechte nach. Mit einem geschickten Druck muß die Linke das Kipini aus seinem gewohnten Lager befreit haben, denn schon reicht sie das Ding herüber. Sichtbar ist der ganze Vorgang nicht gewesen, denn mit einer geradezu unerklärlichen Ängstlichkeit und Beharrlichkeit hat sie die ganze Nasenpartie mit der ausgebreiteten Rechten überdeckt. Auch jetzt, nachdem sie längst ihr Silberstück in Empfang genommen hat, steht sie noch in dieser Haltung da; meine Leute witzeln von neuem, doch immer fester drückt die Frau die Rechte auf die entblößte Stelle. Mit diesem Hinweis auf die lokale Nacktheit haben wir den Vorgang psychologisch unzweifelhaft richtig gedeutet; mit der Entfernung des Kipini wird das Schamgefühl verletzt, daher das krampfhafte Zudecken jener Stelle.

Eine solche „Verlagerung“ des Schamgefühls ist in der Völkerkunde nichts Seltenes. Mit innigem Behagen lese ich in meiner Bibel, der Peschelschen Völkerkunde, immer wieder jene köstliche Stelle, wo der Autor schildert, was ein frommer Moslim aus Ferghana tun würde, wenn er einem unserer Bälle beiwohnte. Peschel meint, daß dieser brave Moslim, wenn er die Entblößungen unserer Frauen und Töchter, die halben Umarmungen bei unseren Rundtänzen wahrnähme, im stillen nur die Langmut Allahs bewundern würde, der nicht schon längst Schwefelgluten über dieses sündhafte und schamlose Geschlecht habe herabregnen lassen. Denselben Anschauungen entspricht es, daß die Araberin Fuß, Bein und Busen ohne Verlegenheit sehen läßt, daß[S. 167] aber die Entblößung des Hinterhauptes bei ihr für noch unanständiger gilt als die des Gesichts, das ja auch sorgsam verborgen wird. Wieder eine andere Verlagerung des Schamgefühls ist die ängstlich angestrebte Bedeckung des Nabels bei den Malaiinnen und auch auf den Tonga-Inseln, während jeder andere Körperteil skrupellos zur Schau gestellt wird. Noch weiter von unseren Anschauungen weicht schließlich diejenige der Chinesen ab, wo es als höchstes Ausmaß der Unanständigkeit angesehen werden würde, wenn die Frau einem Manne ihren künstlich verkrüppelten Fuß zeigte; gilt es dort doch sogar für unschicklich, auch nur von ihm zu sprechen. Würde man in gleicher Weise die ganze Erde absuchen, eine Unsumme der verschiedensten, nach unseren Begriffen seltsamsten Anschauungen über Anstößiges und Gestattetes würde uns dabei entgegentreten. Unsere eigenen Ansichten über diesen Punkt sind in dieser langen Reihe auch nur eine von den vielen; auch ist ihre Berechtigung durchaus nicht besser begründet als irgendeine der anderen, denn alle diese Anschauungen haben genetisch das gemeinsam, daß a priori überhaupt nichts als verwerflich und anstößig erscheint; erst nachdem sich eine bestimmte Ansicht darüber gebildet hat, welcher Körperteil zu verhüllen und welcher unbekleidet zu lassen sei, wird ein Verstoß gegen diese Ansicht zu einer verwerflichen Handlung; nicht früher.
[S. 168]
Die andere Beobachtung hat einen ernsthafteren Einschlag. In dumpfem Brüten zieht die Karawane durch das Pori dahin; alles „döst“, wie man bei uns in Norddeutschland den Zustand zwischen Nichtdenkenwollen und Nichtdenkenkönnen bezeichnet. Plötzlich fliege ich halb aus dem Sattel; mein Reittier ist jäh zur Seite gesprungen und macht Miene, in den dritten Dornenbusch hineinzurasen. Da ist auch schon die Ursache. Ein schräg aus dem Waldboden herausragendes Etwas, das sich bei näherem Zusehen als ein eingegrabener Baumrindenzylinder entpuppt. Das Ding ist reichlich einen halben Meter lang und an dem oberen, unbedeckten Teil mit ein paar vorgesteckten Rindentafeln verschlossen. Von meinen Leuten weiß niemand aus dem Funde etwas zu machen, wohl aber bringen ein paar zufällig des Weges kommende Landeskinder die gewünschte Aufklärung. Es ist ein Kindergrab, und zwar das eines totgeborenen Kindes. Diese werden bei den Makua immer in dieser Weise beerdigt, heißt es.

Nach kurzer Rast bei Susa sind wir von neuem aufgebrochen, um am selben Tage noch Chingulungulu zu erreichen. Dabei werden Knudsen und ich von neuem vom Fieber erfaßt; krampfhaft halte ich mich auf meinem Maultier; auch Knudsen kann sich nur mit Mühe aufrecht erhalten. In ewigem Einerlei gleitet das lichte Pori an uns vorüber; Baum für Baum; es ist kein Ende abzusehen. Ich auf dem Reittier fühle meine Beine nicht mehr; alle paar Minuten schaue ich nach der Uhr; im Schädel hämmert’s und pocht’s — es ist eine Qual. Endlich, endlich ein fester Punkt im schrankenlosen Meer der Bäume: ein umgestürzter Koloß versperrt den Weg. Wie ein Klotz ist der Norweger auf ihn niedergesunken; nur nach langem Zureden bringe ich den Fiebernden wieder empor. Noch einmal geht’s weiter;[S. 169] da hört das Ohr Stimmengewirr. Wie durch einen Schleier erkenne ich Matola, der mir in Massassi bereits begegnet ist; bei ihm sind eine Anzahl weißgekleideter Männer, die sich immerfort feierlich verneigen. Ich lächle und winke mit der Hand. Wir kommen an ein von vielen Säulen getragenes Haus; unendlich mühsam steige ich vom Reittier, ich klappere vor Frost trotz des fast senkrechten Sonnenstandes. Mit freundlicher Miene stellt mir Matola sein Säulenhaus zur Verfügung; ebenso freundlich kredenzt er mir einen Krug kühler Milch. Mein Sinn ist nicht nach materiellen Genüssen; nur ins Bett — nichts weiter. Mein Blick sucht Knudsen. Taumelnd verschwindet er gerade im rasch errichteten Zelt. Zwei Minuten später bin auch ich in zwei warme Kamelhaardecken gewickelt. Tut das wohl! Und nun hinein ins erste Fieber!
Chingulungulu, Mitte August 1906.
Ein Gutes hat so ein richtiges, tüchtiges Fieber bei allen Übeln doch; ist es zu Ende, so hat der Rekonvaleszent einen Appetit, daß unser sanfter Ausdruck „essen“ sich zu dieser Tätigkeit des Nahrungvertilgens verhält wie der liebliche Ton der Hirtenschalmei zum donnernden Schlachtgetöse. Ein ganzes gebratenes Huhn ist in dieser Lebenslage für ein Frühstück gerade knapp ausreichend, wohlgemerkt, wenn man vorher noch einen großen Teller Knorrscher Suppe vertilgt hat und hinterher einem noch viel größeren Eierkuchen mit eingebackenen Bananen entgegensieht. Aber es geht dann auch schnell mit der Wiederherstellung; sehr bald schmeckt wieder die Zigarre, bekanntlich der beste Maßstab des Wohlbefindens seit Wilhelm Busch. Nur ein gewisses „Brägenschülpen“, das Gefühl, als wenn das Gehirn den ihm zur Verfügung stehenden Raum nicht ganz ausfüllte und daher bei jeder Kopfbewegung an den Rändern Wellen schlüge, erinnert noch ein paar Tage lang in allerdings sehr wenig angenehmer Weise an den schweren Fieberanfall.
[S. 171]
Traum und Wirklichkeit oder Poesie und Prosa, so könnte man das berühmte Chingulungulu mit Fug und Recht benennen. Man muß in der Tat wie Nils Knudsen ein Jahrzent im Busch gesessen haben, um dieses Emporium alles Schmutzes, Dreckes und Staubes für das Paradies anzusehen, welches Chingulungulu nach Knudsens Ansicht auch heute noch darstellt. Selbstverständlich haben wir unsern Wohnsitz unter der berühmten Barasa aufgeschlagen. Sie ist wirklich ein gar stolzes Gebäude. Eigentlich ist es nur ein von Säulen getragenes Strohdach, aber dieses Strohdach hat 15 Meter Durchmesser und liegt mit seiner Spitze mindestens 6 bis 7 Meter über dem Estrich. Auch architektonisch ist es eine beachtenswerte Leistung: um den Mittelpfeiler stehen die übrigen Säulen in drei konzentrischen Kreisen; der Fußboden ist gestampfter Lehm, mit Asche vermischt. Gestampft ist nicht der richtige Ausdruck, die Leute benutzen hier vielmehr einen im stumpfen Winkel gebogenen Schlegel, mit dessen breitem, flachem Schlagende die nötige Bodenfestigkeit erzielt wird. Rings um die ganze Peripherie der Halle verläuft, nur an drei um je 120° voneinander abstehenden Lücken unterbrochen, ein um etwa 40 Zentimeter erhöhter Wall. Das sind die Sitze für die Thingmänner, denn diese Barasa ist in der Tat nichts anderes als das Parlamentsgebäude der dörflichen Gemeindevertretung. Der Thingammann thront in der Mitte des weiten Baues; rings um ihn in dichter Scharung kauern, sitzen und stehen die schwarzen Mitbürger. Eine solche Barasa hat jedes Negerdorf, aber von ihnen allen ist die von Chingulungulu am berühmtesten. Matola ist denn auch nicht wenig stolz, daß er seinen beiden Gästen gerade eine solch hervorragende Unterkunft gewähren kann.
Doch auch Matolas Wohnhaus ist ein gar stattlicher Bau. Rings um das Ganze natürlich, wie immer, die vom weitausladenden Dach beschattete Veranda, gegen Regen und Ungeziefer um eines Fußes Breite gegen die übrige Welt erhöht. Unter ihr hält Matola Tag für Tag und den ganzen Tag Hof. Das ist interessant für mich,[S. 172] aber nicht gerade angenehm, denn der Audienzplatz liegt nur 25 Meter von meinem Sitz ab, und Negerstimmen sind wenig gewohnt, sich Zwang anzutun. Und gar erst, wenn weibliche Wesen auftauchen, um an dem allgemeinen Konvent teilzunehmen oder sich im Schauri zu verteidigen. Dann wird’s furchtbar.
Den stattlichen Abmessungen des Matolaschen Hauses entspricht die Ausstattung seines Innern nicht. Die ganze Vorderfront entlang läuft zunächst, was Matola die Abendbarasa nennt, ein langer, schmaler Raum, in den die Hausbewohner und ihre Freunde sich an unfreundlichen Abenden vor den Unbilden der Witterung zurückziehen. Eine einzige Kitanda, ein Bettgestell im Küstenstil, bildet das Mobiliar. Der übrige Teil des Hauses wird von drei Zimmern von je 25 Ouadratmeter Grundfläche eingenommen. Die beiden seitlichen sind Schlafräume; ihr Zweck wird dokumentiert durch je ein paar Bettstellen und große Aschenhaufen, die Reste des kräftigen Feuers, das jeder Eingeborene allnächtlich zur Seite seines Ruhelagers unterhält. Beide Räume sind lediglich durch eine nach dem Mittelraum führende Tür zugängig, fensterlos und daher stockdunkel. Der Mittelraum dient als Küche; aber wie urwüchsig und primitiv nimmt sich Matolas Herd gegen den seines Kollegen Susa aus! Bei Susa ein nach Material und Technik stilgerechter Unterbau zu dem System der Herdsteine, Koch- und Vorratstöpfe und des sonstigen Küchengeräts; bei Matola nichts als ein wüstes Aschenchaos, auf dem irgendwo ein paar kopfgroße Klumpen von Termitenerde die ZubereitungsstelIe der königlichen Nahrung andeuten. Und dabei steht der Yaoherrscher im Ruf, für afrikanische Verhältnisse ein geradezu reicher Mann zu sein, der irgendwo in seinen Häusern versteckt große Mengen silberglänzender Rupien verborgen halte.
Um so interessanter ist dafür Matolas Hof. War Matola bei dem ersten Besuch, den ich ihm machte, angesichts der Dürftigkeit seines Hausinneren etwas befangen und verlegen, so führte er mich durch die hinteren Räumlichkeiten seines Anwesens mit sichtbarem[S. 173] Stolze. Er hat auch allen Anlaß dazu. Schon die ganze Hinterbarasa seines Hauses ist lückenlos besetzt mit Vorratsbehältern der verschiedensten Größen und Formen. Da gibt es mehr als mannshohe bienenkorbartige Behälter für Hirse und Mais: daneben stehen zylindrische, nur wenig niedrigere Gefäße für Erdnüsse, Bohnen und Erbsen; in den Zwischenräumen aber findet das Auge im Halbdunkel kleinere Behälter aus Baumrinde oder Ton zur Aufbewahrung der Nahrungspflanzen zweiten Grades. Alle diese Vorratsbehälter sind, wie wir es schon in Massassi kennen gelernt haben, gegen tierische Schädlinge und die schädlichen Einflüsse der Atmosphäre durch eine dicke, feste Lehmschicht geschützt. Wendet man sich dem hinteren Teile des großen, rechteckigen Hofes zu, der durch eine hohe Palisadenwand gegen den Einblick und das Eindringen Unberufener geschützt ist, so erblickt das Auge auch hier die Beweise einer zweifellos sehr weit- und vorsichtigen Wirtschaftsmethode, denn hier ist ebenfalls alles auf das Hinüberretten der diesjährigen Ernte bis zum nächsten Erntetermin eingerichtet. Kleine und große Vorratsbehälter ringsum, zwischen allem aber ein gewaltiger Speicher, in dessen unterem Raum einige Frauen am Herde hantieren, während der ganze große Dachraum mit Ähren und Kolben gefüllt ist. Und tritt man aus dem Hofraum nach Osten ins Freie, so zieht sich längs der ganzen Palisadenwand ein langes Gerüst hin, mehr als 2 Meter hoch, auf gegabelten Pfählen ruhend, dazu mehr als 2 Meter breit, auf dem auch jetzt noch, trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit, reichliche Mengen abgeernteter Ähren endgültig an der Sonne getrocknet werden. Wandert man schließlich um das ganze Anwesen herum bis zu seiner linken Giebelseite, so steht man plötzlich vor der Krone des ganzen Wirtschaftssystems, einem Speicher von wahrhaft gigantischer Größe und zweifellos sehr rationeller Konstruktion. Er ist am Anfang dieses Kapitels wiedergegeben.
Dieser Speicher ist ein Pfahlbau, wie alle übrigen Vorratsbehälter; während aber bei den gewöhnlichen Formen der Pfahlrost[S. 174] nur 50 bis 70 Zentimeter hoch ist und 1 bis 1½ Meter im Quadrat mißt, liegt er bei diesem Riesen in fast doppelter Manneshöhe und nimmt eine Fläche von mindestens 3-4 Meter im Quadrat ein. Auf der Plattform ruht der eigentliche Kornbehälter. Er ist von stattlicher Tiefe und großem Inhalt, am besten einem europäischen Maischbottich vergleichbar. Zur Stunde ist er erst zur Hälfte mit Hirserispen gefüllt, daher auch noch der mangelnde Verschluß. Über dem Ganzen breitet sich dann das gewohnte, weitausladende, schwere Dach aus. — Und der Zugang zu diesem Bau- und Wirtschaftswunder? Dieser wirkt allerdings wieder urafrikanisch urwüchsig, denn er besteht aus derselben vorsintflutlichen Leiter, die meine Lachlust bereits in Massassi erregt hat: ein paar derbe ästige Knüppel als Leiterbäume; daran in meterweitem Abstand, nur schwach befestigt, ein paar ebenso elende Sprossen.
Das Allerbeste und Höchste seiner ganzen Ökonomie hat Matola sich bis zuletzt aufgespart. Was quiekt und grunzt dort behaglich im Schatten jenes düstern Gebäudes, als dessen Endzweck mir der eines Gefängnisses genannt wird. Ein Gefängnis in Afrika? Jawohl, ein wirkliches und wahrhaftiges Gefängnis; auch der Neger ist kein Engel, und als „Kette“ muß er doch irgendwo hausen. Jetzt interessiert uns mehr der Ursprung jenes zweifellos tierischen Geräusches. Eine Muttersau ist es, mit zwölf lustigen Ferkeln um sich herum. Die fröhliche Gesellschaft ist überall; sie untersuchen das Gepäck der Askari, statten Nils Knudsen in seinem Zelt Besuche ab, mit Vorliebe aber finden sie sich nach dem Diner in unserer Küche ein, um dem Koch und seinem Jungen die Säuberung unserer Töpfe und Teller abzunehmen. Das ist ihnen gar bequem gemacht, denn erstens besteht unsere Küche aus weiter nichts als einer geschützten Ecke unter der Dachveranda des Gefängnisses, zweitens aber könnte man einen Neger, wenn er sich vollgegessen hat und wie ein geprellter Frosch schnarchend in seiner gewohnten Siesta daliegt, mit aller Seelenruhe in Stücke hacken, ohne daß er bei diesem doch immerhin tief eingreifenden Vorgang[S. 175] erwachte. So bietet sich denn allmittäglich das merkwürdige Schauspiel dar, daß ein khakibekleideter Europäer unter wütendem Geschelt auf die faulen, schwarzen Halunken und ihren ganzen Erdteil kibokoschwingend über den Festplatz von Chingulungulu eilt, um seine Kochtöpfe von dem Besuch der zärtlichen Schweinemama und ihrer Kleinen zu befreien. Ohne einen gelegentlichen Jagdhieb auf das nachlässige Küchenpersonal geht es selbstverständlich nicht ab, doch das kümmert meinen lieben Omari recht wenig. Den Ferkeln aber haben Knudsen und ich dahin Rache geschworen, daß wir sie eines schönen Tags wirklich in unseren Töpfen haben wollen, doch dann sehr wider ihren Willen.
Wie Matola zu diesem für den Dunstkreis des Islam — denn in diesem befinden wir uns hier zweifellos — seltenen Borstentier mit seinem Nachwuchs gekommen ist, habe ich bis jetzt noch nicht erfahren; ich nehme aber an, daß er sie ebenso durch die Vermittlung der englischen Mission bekommen hat wie seine allerdings viel zahlreichere Rinderherde. Diese ist in einem Pferch untergebracht, der sich unmittelbar neben Matolas Haus befindet. Er ist ein einfacher Palisadenverschlag, in den die Tiere abends kurz nach Sonnenuntergang hineingetrieben werden, um ihn vormittags nach dem Verdunsten des Nachttaus unter der Obhut einer Anzahl Knaben wieder zu verlassen. Die Herde umfaßt rund 20 Tiere, alles Buckelrinder, von denen die Mehrzahl sichtlich tsetsekrank ist; nur ein junger starker Bulle und ein paar Rinder bringen durch ihr stattliches, frisches Äußere und ihren Übermut einiges Leben in die ganze Trauergesellschaft. Erfreulicherweise sind auch einige Mutterkühe in der Schar; von ihnen stammt das Töpfchen Milch, das Matola mir täglich in unsere Barasa herübersendet.
Das ist Matolas Residenz im engeren Sinn. Will man seinen ganzen Machtbereich kennen lernen, so steigt man am besten in den Sattel, denn Chingulungulu ist eine außerordentlich weitgedehnte Siedelung. Schnurgerade, mit Kautschukbäumen bepflanzte breite Wege führen von dem Platz um die Barasa nach Norden, Osten und[S. 176] Westen; links und rechts von ihnen dehnen sich weite Felder, über denen hie und da das Graubraun eines mehr oder minder stattlichen Hüttendaches auftaucht. Ich bin die ganze Zeit, die ich hier bei Matola sitze, immer von neuem in die Einzelheiten dieser Negersiedelung untergetaucht, und ich muß gestehen, daß die Reize dieser Tätigkeit mich bis jetzt über einen Übelstand hinweggetröstet haben, der mir unter andern Verhältnissen den Aufenthalt in dieser Gegend längst verleidet hätte. Das ist nämlich die Schwierigkeit, mich über die interneren Sitten, Gebräuche und Anschauungen zu unterrichten und damit in das Geistesleben des Volkes selbst so tief einzudringen, wie ich es unbedingt will. In Massassi war die epidemische Bierfröhlichkeit der ganzen Männerwelt ein für diesen Endzweck gänzlich unvorhergesehenes Hindernis; hier in Chingulungulu scheint Matola entweder nicht den Einfluß zu besitzen, mir weise Männer zum Ausfragen stellen zu können, oder aber er hat gar kein Interesse daran, dem Fremden die Weistümer seines Volkes zu offenbaren. Vieles weiß er übrigens selbst; er hat auch schon manches Mal mit uns gesessen und aus der Geschichte seines Volkes erzählt; aber wenn man ihn haben will, ist er plötzlich verschwunden. Er jage am Rovuma, heißt es dann.
Anthropologisch ist die Bevölkerung hier, im politischen Zentrum der großen Ebene zwischen den Massassibergen und dem Rovuma, ebenso bunt zusammengesetzt wie in Massassi selbst, nur daß hier unten die Wayao zunächst an Zahl überwiegen und daß sie ferner ganz allein im Besitz der politischen Vorherrschaft sind. Neben ihnen gibt es auch hier Makua, Wangindo, Wamatambwe und Makonde, und genau wie im Norden wohnt alles regellos durcheinander.
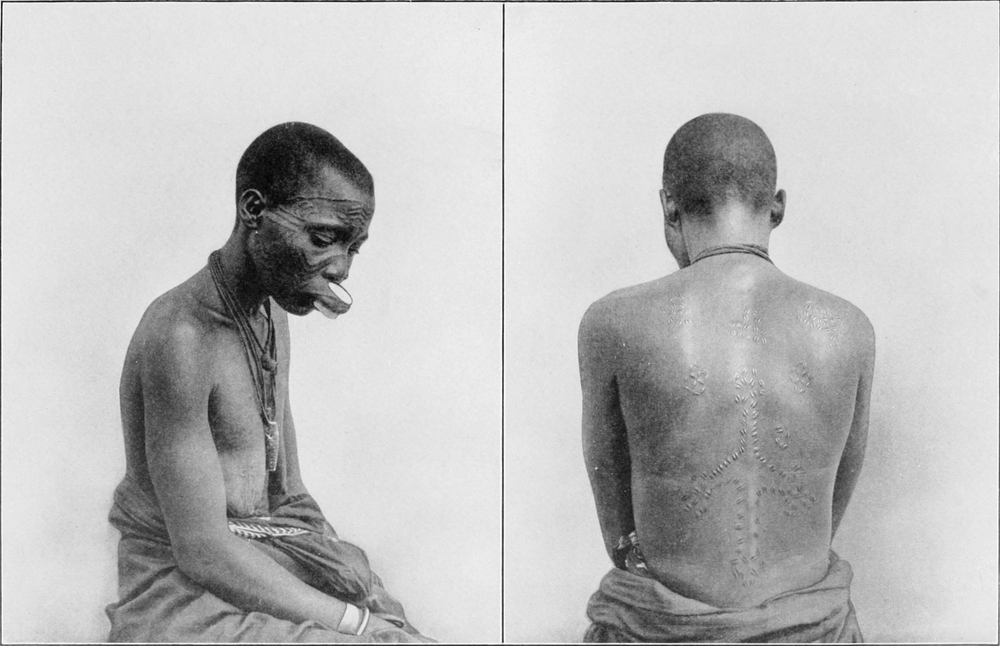
Die Geschichte der Yao bis zu ihrem gegenwärtigen Wohn- und Ruhepunkt in dieser Ebene ist bunt und wechselvoll genug. Lange Zeit, von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an bis fast in die Gegenwart, hat man sie anstandslos zu der Kaffernfamilie gerechnet. Da sie wie die Wangoni und fast gleichzeitig mit ihnen ebenfalls[S. 177] vom Süden nach dem Norden zogen, d. h. aus dem Gebiet östlich vom Schire und südlichen Nyassa zum Rovuma und Ludjende; da sie zudem körperlich ebenso frisch und frank erschienen wie jene reisigen Scharen aus dem fernen Südosten des Erdteils, und weil sie schließlich ebenso bewaffnet und gekleidet waren wie jene, so lag es nahe, sie gleichfalls als Einwanderer aus dem subtropischen Südafrika und als Kaffern zu betrachten. Heute ist man davon zurückgekommen; ihre Sprache gehört offenkundig in die Gruppe der östlichen Bantuidiome; heute weiß man auch, daß sie mit dem Süden des Erdteils nichts zu tun haben.
Läßt man sich die Geschichte dieses Volkes von den Männern erzählen, die entweder auf Grund ihres hohen Alters noch selbst einen großen Teil des jahrzehntelangen Wanderlebens mitgemacht haben, oder aber welche, wie Matola, Susa und Nakaam, durch ihre soziale Stellung die geborenen Träger der Stammestradition sind, so kehrt als Ausgangspunkt aller dieser meist unfreiwilligen Wanderungen stets das Gebiet am Ostrand des südlichen Nyassasees wieder.
„Einst saßen die Yao,“ so berichteten mir ein paar alte Angehörige dieses Stammes, die wir unabhängig von Matola durch ein paar handfeste Askari herbeizitiert hatten, „am Kuisale Kuchechepungu. Kuchechepungu ist der Name des Häuptlings, unter dem sie in dem Hügellande Kuisale friedlich lebten. Da kam ein Krieg, in dem die Yao geschlagen wurden. Und sie zogen in die Nähe des Makuahäuptlings Mtarika. Aber das ist schon sehr lange her; ich, Akundonde (so hieß der Sprecher dieser Geschichtskommission), weiß es auch nur von älteren Leuten. Auch bei Mtarika erging es den Yao schlecht, denn dieser starke Makuahäuptling überzog sie mit Krieg und verjagte sie. Und sie zogen nach Malambo; das aber liegt hinter Mkula. In Malambo saßen die Yao lange; schließlich aber wurden sie durch denselben Mtarika von neuem vertrieben. Jetzt ließen sie sich am Fluß Lumesule im Dondegebiet nieder; von dort sind sie später nach Massassi weitergezogen.“
[S. 178]
Das war, als Akundonde ein großer Junge war. Da dieser alte Herr jetzt zum mindesten 60 und einige Jahre zählt, so ist dieser Zug in die Massassi-Ebene an das Ende der 1850er Jahre zu setzen. Bei Massassi sind die Yao von den Wangoni überfallen worden, haben sie aber besiegt und in der Richtung aus Kilwa Kiwindje zurückgeschlagen. Dennoch seien die Yao auf das sichere Makondeplateau gezogen. Hier, bei Mahuta, seien sie später noch einmal von den Wangoni angegriffen worden, aber das sei schon unter der Herrschaft des ältern Matola gewesen. Dann kam Bakiri von Sansibar, und damit beginne eine ganz neue Zeit.
Dieser Bakiri von Sansibar und sein Auftreten am Rovuma offenbart uns in höchst unzweideutiger Weise, wie wenig wir im Grunde genommen vom Neger und seiner Geschichte wissen. Der kaiserliche Bezirksamtmann Ewerbeck sitzt seit dem Anfang der 1890er Jahre im Lande, er hat sich seit jeher auch für die früheren Schicksale seines Bezirks im höchsten Maße interessiert, doch auch ihm sind nur unklare Gerüchte über eine Gesandtschaft des Sultans von Sansibar zu Ohren gekommen. Um so lebhafter ist die Erinnerung an dieses Ereignis bei den Beteiligten im Lande selbst. Bei Akundonde und seinen Altersgenossen ist das nicht verwunderlich, denn sie müssen damals schon erwachsen gewesen sein; aber auch Matola und seine Generation, also Leute, die sich damals noch im Kindesalter befanden oder auch noch gar nicht einmal geboren waren, werden sofort lebhaft, wenn auf den sagenberühmten Bakiri und seinen denkwürdigen Zug die Rede kommt.
Dieser Zug, der nach Ewerbecks Erkundigungen die Kohlenlager am Ludjende, dem großen rechtsseitigen Nebenfluß des Rovuma, zum Ziel gehabt hat, ist im Bewußtsein der hiesigen Völkerschaften seines Charakters als Reise verloren gegangen; er hat dafür die Form des landesüblichen Schauri angenommen; aber dieses Schauri, diese Zusammenkunft aller Großen des Landes und ihrer Völker, haftet nunmehr um so fester im Gedächtnis. Es ist das berühmte Schauri von[S. 179] Nkunya, einem noch heute bestehenden Ort an der Südwestecke des Makondeplateaus. Über seine Vorgeschichte, seinen Verlauf und seine Folgen erzählt Matola der Jüngere folgendermaßen:
„Die Yao saßen vorzeiten viel weiter im Westen und Süden, aber dort erging es ihnen schlecht; der alte Makuahäuptling Mtarika von Metho machte Krieg mit ihnen, und wenn er abgezogen war, dann kamen die bösen Masitu von der andern Seite und machten auch Krieg. Dabei wurden die Männer der Wayao zu Sklaven gemacht oder getötet, die Frauen aber und die Kinder wurden von den Feinden hinweggeführt. Das ist geschehen, als der ältere Matola ein ganz junger Mann war. Jetzt würde er ein ganz alter Mann sein, aber er lebt nicht mehr; er ist vor zwölf Jahren gestorben, als er zwar auch schon sehr alt, doch noch immer sehr rüstig war.
„Matola mußte schließlich fliehen; er ging zunächst an den oberen Bangala und zog dann diesen abwärts bis drei Stunden vom Rovuma. Dort starb sein zweiter Bruder. Matola war hier nur ein sehr kleiner Häuptling, denn er hatte nur ganze fünf Hütten. Aber er war klug und tapfer; er war ein Räuber, und er war ein Jäger, der viel Wild erlegte und für das Fleisch Getreide kaufte. Vom unteren Bangala zog Matola an den Fluß Newala und baute dort seine Hütten unten im Tale am Fuße des Makondeplateaus. Dort lebte er lange. Das Land aber gehörte Mawa, einem Makua. Da kam ein Mann von Mikindani herauf, Bakiri mit Namen, nach Nkunya, um Schauri zu halten. Er rief alle Stämme zusammen: Wayao, Makua, Matambwe und Wangoni. Von allen Stämmen kamen sie in Haufen. Bakiri hielt Schauri. Die Wangoni und Matambwe wurden ängstlich und liefen weg; auch die Makua liefen weg. Es blieben nur Mawa, Matola und einige andere Makua. Das Schauri dauerte vom Morgen bis zum Abend und die Nacht hindurch bis zum andern Morgen. An diesem Morgen sagte Bakiri zu Matola: ‚Ich gebe dir das ganze Land; zwar habe ich von dir und deiner Herrschaft bisher nur wenig gehört, aber die andern sind alle weggelaufen,[S. 180] nur du bist geblieben; du bist also zuverlässig. Herrsche daher über das ganze Land.‘ Auch Mawa schloß sich dem an: ‚Ich bin alt‘, sagte er, ‚und werde bald sterben; herrsche also du über das ganze Land.‘ Und so geschah es. Und Matola I. herrschte weise und gerecht, wenn auch streng. Erst zog er nach Mikindani und pflanzte Palmen. Dann zog er in das Land zurück bis halbwegs nach Newala; von dort endlich nach Newala selbst. Erst wohnte er oben auf dem Plateau, dann unten im Tal, dann zog er wieder auf die Höhe. Den Grund hierfür bildeten die Masitu-Überfälle. Oben in Newala ist er dann gestorben, und dort liegt er auch begraben.“
Es ist in mehrfacher Beziehung hochinteressant, diese schwarzen Herren gerade bei ihren historischen Rückblicken zu beobachten. Im allgemeinen sprechen sie gut, eine Kunst, die vom Neger seit jeher bekannt ist; es ist die natürliche Beredsamkeit, die die gekünstelten Phrasen vermeidet, den einfachen, naheliegenden Ausdruck aber rasch findet und in das Satzgefüge eingliedert. Nur dem einen oder andern, vor Alter stumpfen Greise geht die Rede nicht so glatt aus dem zahnlosen Munde heraus. Um das Gebiß der alten Neger ist es nämlich keineswegs so glänzend bestellt, wie man nach dem blitzenden Zaun der Zähne, die das Jugendstadium der schwarzen Rasse auszeichnet, annehmen sollte. Ursache für die rasche Abnutzung der Zahnkronen ist die Beimischung reichlichen Schleifmehls, wie es bei der Zubereitung der täglichen Nahrung auf dem Reibstein entsteht. Schwer und hart gleitet der Läufer über die breite Unterlage dahin; er zermalmt und zerkleinert zwar vor allem das ihm zugeführte Getreide: Hirse, Mais und Reis, aber gleichzeitig schleifen beide Steine sich doch auch einander gegenseitig ab, wie die tiefe Aushöhlung der Unterlage und die rasche Abnutzung des Läufers lehren. Die feinen Steinsplitter aber gereichen den Kauwerkzeugen der Landeskinder nicht gerade zum Nutzen. Auch die Verunstaltung der Zähne durch Absplitterung der Seitenteile zum Zweck der Zuschärfung, die bei den Männern noch vielfach Sitte ist, trägt nicht wenig zum vorzeitigen Ruin des Gebisses bei.
[S. 181]
Sodann das Zusammenarbeiten der Geister. Von Hause aus soll der europäische Forscher dem Neger und seinen Angaben über irgendwelchen Gegenstand sehr kritisch gegenüberstehen, denn mit der Wahrheit nimmt es unser schwarzer Bruder notorisch nicht genau. Doch hier, auf dem historischen Gebiet, kontrollieren sich die Erzähler — bewußt oder unbewußt, das kann ich nicht entscheiden — gegenseitig. Einer hebt an; der Strom der Rede fließt eine kurze Weile ruhig dahin; „ă ă“ fährt ihm plötzlich unverhofft ein anderer dazwischen. Es ist ein unnachahmlicher, kurz ausgestoßener Doppellaut, begleitet von einer noch unnachahmlicheren Gebärde der Abwehr, als wollte sie sagen: Freundchen, halt, du schwindelst. Aber der Einwurf sitzt, der Erzähler stutzt, revidiert sein historisches Gewissen und bringt nun die Tatsache, um die es sich gerade handelt, in der Fassung wieder, die auf meine Frage hin auch die Billigung der andern findet.
Es liegt ganz in der Natur des hiesigen Völkerlebens, daß der einzelne Erzähler stets nur gerade die Geschichte seiner eigenen, engen Stammesgruppe wiederzugeben vermag; die Leute sind allesamt, ganz gleich, ob sie den Völkerschaften der Yao oder der Makua angehören, in numerisch kleinen Abteilungen, mag man sie Horde, Sippe oder Trupp nennen, im Lande umhergewirbelt worden. Ein ausgeprägtes, historisch begründetes Stammesbewußtsein hat sich dabei nicht bilden können, oder wenn es jemals bestanden hat, hat es die beste Gelegenheit gehabt, verloren zu gehen. So können sie auch nur von sich und ihrer nächsten Umgebung berichten. Es ist die Aufgabe der Volksforschung, möglichst viele dieser Einzelberichte zu sammeln, um aus ihnen schließlich das Gesamtgebäude einer Stammesgeschichte im großen zu errichten. Soweit es an mir liegt, soll es an Fleiß und Ausdauer in der Zusammentragung dieser Erzählungen nicht fehlen.
Nun aber der letzte und netteste Zug, ein urecht afrikanischer. Dem Neger fehlt bei dem Mangel einer Schrift jede Möglichkeit einer genauen Zeitrechnung. Schon das Erstaunen ist unbeschreiblich, wenn man jemanden nach seinem Alter fragt. „Aber wie kann ich[S. 182] denn wissen, wie alt ich bin?“ Das etwa mag der Blick bedeuten, mit dem man auf jede Frage nach dem Alter eines Eingeborenen verwundert angestaunt wird; auch die Eltern und Großeltern sind niemals in der Lage, über das Alter ihrer Kinder und Enkelkinder auch nur annähernd genaue Zahlen anzugeben. Das Leben eines Negers fließt zu ereignislos und eintönig dahin; zudem wird sein Dasein so voll und ganz durch seine kleinen Sorgen und seine kleinen Freuden ausgefüllt, daß er für besondere Gedächtnisübungen keine Zeit haben würde, selbst wenn die geringste Lust für eine derartig überflüssige Geistesbelastung vorhanden wäre. Schließlich aber, und das ist wohl das Wesentliche und Ausschlaggebende, fehlt jeder Zwang; es gibt keine Behörde, kein Amt, und so wächst der kleine schwarze Weltbürger heran, unbekümmert um Zeit und Raum; er nimmt sich ein Weib oder ein paar, vermehrt sich, und kein Hahn kräht jemals danach, ob er und sein Alter gebührend registriert und kontrolliert worden sind.
Dieses Fehlen und dieser gänzliche Mangel einer absoluten Chronologie tritt vor allem auch in der Stammesgeschichte zutage. Ich war zuerst ratlos, wie ich mich angesichts der geschilderten Erhabenheit über Zeit und Raum mit meiner Fragestellung einrichten sollte. Auf diese kommt aber im wissenschaftlichen Verkehr mit den Eingeborenen schließlich alles an; man hält es gar nicht für möglich, welch irreführende Ergebnisse eine Frage veranlassen kann, die falsch gestellt, d. h. dem Verständnis und der Denkweise des Naturmenschen nicht angepaßt ist. Ich bin zu meinem Glück bei all meinen bisherigen historischen Studien aller Schwierigkeiten durch die Erzähler selbst überhoben worden, und zwar durch eine ebenso naturwüchsige wie relativ zuverlässige Methode.
„Wann war das, als ihr am Lumesule saßet?“ frage ich den alten Akundonde. Ohne ein Wort zu erwidern, streckt er seinen rechten Arm seitlich aus, etwa in der Körperhöhe eines 12jährigen Jungen, und biegt die Hand graziös senkrecht nach oben, so daß sie[S. 183] mit dem Unterarm nahezu einen rechten Winkel bildet. Ich sehe mir die Manipulation mit stummem Erstaunen an, aber schon gibt mir Knudsen die erwünschte Erläuterung: in dieser geschilderten Weise gibt der Eingeborene die Höhenmaße des Menschen und damit gleichzeitig auch die Zeitlage eines in dessen Leben fallenden Ereignisses an; streckt er hingegen die Hand in der Verlängerung des Armes in der gleichen, wagerechten Richtung aus, so dient diese Manipulation zur Kennzeichnung der Körperhöhe eines Tieres. Ich muß gestehen, unter dem vielen Fremdartigen und Neuen, das in Afrika bisher auf mich eingestürmt ist, hat diese feine und doch so vielsagende Unterscheidung zwischen Mensch und Tier den allergrößten Eindruck auf mich gemacht.

Einer etwas anderen Mimik bediente sich Nakaam in Mwiti, als er mir die Geschichte der Yao erzählte. Nakaam unterscheidet reine Yao und unreine; zu jenen rechnet er die Chiwäula, die Katuli und die Kalanje. Das sind alles Begriffe, die bisher in der völkerkundlichen Literatur über die[S. 184] Wayao noch nicht existieren; es muß auch einer späteren Kritik vorbehalten bleiben, den intelligenten, aber doch vielleicht etwas windigen Gewährsmann von Chiwata auf die Zuverlässigkeit seiner Angabe hin nachzuprüfen. Die Heimat der reinen Yao ist nach Nakaam Likopólŏe, eine Hügellandschaft im Gebiet von Chissi, auf portugiesischem Gebiet zwischen Mataka und dem Unanguhügel. Von dort habe sie der Häuptling Mputa verjagt, als Nakaams Mutter ein kleines Kind war, das auf allen Vieren kroch. Nakaam ist nach seiner eigenen Aussage das vierte Kind seiner Mutter; heute kann er 40 bis 45 Jahre alt sein. Nach Mputa kamen andere Makua und zersplitterten die Yao noch weiter. Absolute Zahlenwerte waren auch selbst aus dieser Perle von Intelligenz, als die Nakaam unzweifelhaft zu gelten hat, nicht herauszuholen. Dafür entschädigte bis zu einem gewissen Grade die Drolligkeit seines Anblicks, als der wohlbeleibte Häuptling, der sonst die personifizierte Würde selbst war, fortgerissen durch die Lebhaftigkeit seiner Schilderung, plötzlich alle Rücksicht auf seine erhabene Stellung vergaß und uns das Krabbeln seiner Mutter im Babyalter mit verblüffender Naturwahrheit vorführte.
Matola ist so ziemlich in allem das Gegenstück zu Nakaam. Schon bei der Kleidung fängt es an; Nakaam kleidet sich nach Küstenart in das schneeweiße, lange Kansu, Matola hingegen ist oben Europäer, unten Yao; seinen Oberkörper umhüllt nämlich ein ganz normales europäisches Jackett, Lenden und Oberschenkel aber ein buntfarbiger Baumwollschurz, wie ihn seine Untertanen tragen. Der Charakter des Verschmitzten, der für Nakaam so bezeichnend ist, fällt hier ganz weg; Matola macht den Eindruck eines Biedermannes, der er auch nach den Schilderungen aller Europäer von Lindi, die jemals mit ihm in Berührung gekommen sind, in Wahrheit ist. Er ist stets geschäftig; entweder hält er unter seiner Barasa Hof, d. h. er erzählt sich etwas mit dem Dutzend oder den zwei Dutzend Männern, die von früh bis spät sich dort herumtreiben, oder aber er hat es mit uns und der Besorgung unserer Wünsche zu tun. In seinen Manieren weicht er wenig von[S. 185] seinen Untertanen ab. Rauchen ist hier fast unbekannt, dafür wird Tabak stark geschnupft und gekaut. Eine Folge dieser Gewohnheit ist, daß die Leute schrecklich spucken. Auch Matola macht keine Ausnahme; zudem hat er die andere Gewohnheit, sich unausgesetzt zu kratzen. Das tut auch die Mehrzahl der übrigen Leute hier. Hat man einen Haufen von ihnen um sich, so ist es tatsächlich schwer, inmitten des allgemeinen Gekratzes sich dieser lieblichen Gewohnheit selbst zu enthalten. Ich nehme an, daß sie eine Folge der Unreinlichkeit ist, die hier alle Welt beherrscht; das bißchen Wasser aus den paar Löchern im nächsten Bachbett langt eben für Atzung und Trunk; für die Reinigung des Gesichtes oder gar des ganzen Körpers ist von dem kostbaren Naß nichts übrig.

Ich bin ein Geruchsmensch; von allen meinen Sinnen ist der des Geruchs am besten ausgebildet. Das bringt mir viele Qual an jedem Tag; schon in ziemlicher Entfernung kann man es förmlich riechen, wenn eine Schar von Eingeborenen mir die Ehre ihres Besuches angedeihen zu lassen gedenkt. Unsere Sprache ist zu arm, als daß sie diese Mischung von Rassengeruch, Schweiß, ranzigem Öl, Rauch und hundert andern unbestimmbaren Ingredienzien spezifizieren könnte; die meiste Ähnlichkeit hat wohl die Ausströmung einer größeren Schafherde. Schön ist anders.
[S. 186]
Und dann die Fliegen! Mit dem gleichsam als Spitze voranmarschierenden Duft kommen auch sie in Scharen auf den unglücklichen Europäer zugestürzt. Ich habe geglaubt, wer weiß wie vorsichtig zu sein, indem ich mir von Leipzig zwei Brillen mit dunkelgrauen Gläsern mitgenommen habe. Eine von ihnen sitzt längst auf Moritzens Nase. Der Bursche kam eines schönen Tags mit einer akuten Bindehautentzündung an. Heute ist diese, dank meiner energischen Behandlung, längst behoben, aber es fällt dem eitlen Fant durchaus nicht ein, nun jene Brille, die ich ihm in einer Anwandlung von Überhumanität zur Verfügung gestellt hatte, wieder zurückzugeben. Daß er ihrer nicht mehr benötigt, wird aufs klarste dadurch bewiesen, daß er sie in der prallen Sonne meist absetzt; dafür trägt er sie aber im Dunkel des Hauses und stolpert dabei selbstverständlich über jeden Gegenstand. Das andere Exemplar tut mir im Freien ausgezeichnete Dienste, unter der dunkeln Barasa indessen verschluckt sie zu viel Licht; daher bin ich genötigt, mich den Fliegenschwärmen der Eingeborenen wehrlos auszusetzen. Gegen diese afrikanischen Insekten sind unsere europäischen Stubenfliegen die reinen Waisenkinder; wie ein Blitz ist das die Größe einer kleinen Biene erreichende Tier herangesaust, nicht senkrecht auf das Auge zu, sondern tangential; es fährt förmlich unter dem ganzen Augenlid hin, doch so fabelhaft schnell, daß eine Abwehr gänzlich ausgeschlossen ist. Und das wiederholt sich das eine um das andere Mal; man sieht mit Staunen und mit Grauen, wie sich diese kleinen Biester erst an den entzündeten Augenrändern der Eingeborenen auf die boshafte Attacke vorbereiten; man schlägt instinktiv wild um sich; es nützt alles nichts, der Streifzug des Gegners ist inzwischen längst erfolgreich verlaufen. Knudsen leidet weniger unter dieser Plage, anscheinend auch weniger unter der des Geruches, denn während mir nach mehrstündigem Schauri stets mehr oder minder übel wird, sitzt der blonde Norweger ungerührt ganze Tage zwischen den Leuten.
Wenig ist hier von den Frauen des Landes zu sehen; Matola hat immer und immer wieder den strengen Befehl ausgegeben, daß sie[S. 187] alle zum Photographieren kommen sollen; vier oder fünf sind erschienen, das ist alles. Mich sehen und so schnell ausreißen, wie es die angeborene Würde und die Eigenart der weiblichen Fortbewegungsmethode gestattet, ist eins. Um so ausdauernder werde ich von der männlichen Jugend des Ortes belagert; wie eine Mauer hocken Dutzende von kleinen Kerlen an der Peripherie unseres Wohnraums; alle Mann hoch die Mäuler weit offen, blöd und regungslos den fremden weißen Mann anstarrend. Dieser offene Mund ist bei der Jugend hier ganz allgemein, desgleichen auch der bekannte Hängebauch, über dessen Entstehung man sich nicht wundern kann, wenn man sieht, was so ein Negerbub an schwer verdaulichen Vegetabilien tagsüber in sich hineinstopft. Wodurch diese unbeabsichtigte Verunstaltung des Leibes später verloren geht, entzieht sich meiner Beurteilung; aber sie muß entschieden verschwinden, denn die Erwachsenen sind ausnahmslos sehr wohlgestaltete Erscheinungen.
Der schwarze Erdteil liebt mich nicht; schon auf dem Marsch hat er mich täglich mit seinen Wirbelwinden belästigt; hier in Chingulungulu sucht er mich ganz systematisch aus seinem Innern hinauszutreiben. Knudsen und ich nehmen unser Mittagessen zwischen 12 und 1 Uhr ein. Ursprünglich war es auf präzise 12 Uhr angesetzt. Gemessenen Schrittes nahen Moritz und Knudsens Ali von der Küche am Gefängnis herüber mit dem unvermeidlichen Teller Knorrscher Suppe. Diese Präserven sind etwas ganz Vorzügliches; sie allein wären, glaube ich, imstande, den Körper hier über Wasser zu halten. Mit einem fröhlichen „Gesegnete Mahlzeit“ machen wir uns über das Gericht her, jeder, wie es hier so Sitte ist, an seinem eigenen Expeditionstisch. Horch, was ist das? Ein gewaltiges Brausen. Es kommt näher und näher; Staub, Gras und Laub wirbeln auf; instinktiv hält man Hand oder Mütze über den Teller. Es ist zwecklos; ein wirbelndes Chaos von Asche, Staub, Strohbündeln und allen jenen Schmutzmassen, die man nur hier in Afrika studieren kann, rast von rückwärts heran; die Barasa ächzt in allen Balkenlagern; die Boys fliegen[S. 188] willenlos und widerstandslos auf den freien Platz hinaus; dann ist alles vorüber. Bringt man es fertig, die Augen unter der Schmutzkruste, die jetzt alles überzieht, zu öffnen, so erblickt man eben noch, wie weit vor uns das Dachstroh einer Eingeborenenhütte im fröhlichen Wirbel durch die Lüfte tanzt; dann verschwindet die Erscheinung auch schon im Pori. Den ersten Tag waren wir natürlich gegen das Phänomen wehrlos; den zweiten Tag dachten wir an nichts Böses, da war es auch schon da; den dritten Tag schlug ich vor, das Diner um eine Viertelstunde zu verlegen. Es hat alles nichts geholfen; auch die Windhose kam um diese Viertelstunde später. Wir haben dann im Lauf der Zeit einen förmlichen Krieg mit dieser Mittagshose geführt, aber die Besiegten sind auf der ganzen Linie wir. Stets kommt sie, wenn die Suppe aufgetragen ist; kaum können Moritz und Ali noch schnell den Blechdeckel einer Reisekiste über den Teller stülpen, so ist sie auch schon da. Teils zum Schutz gegen sie, zum andern aber gegen die immerhin lästige Neugier der Landeskinder, der großen und der kleinen, haben wir uns unter Matolas Architekturwunder eingebaut; wir haben eine bis ans Dach reichende Wand aus Hirsehalmen quer durch die Halle selbst gezogen und haben diese Wand rechts und links von uns in zwei konvergierenden Linien weitergeführt, so daß wir jetzt wie in einem Zimmer sitzen. Aber auch in diesen geschlossenen Raum kommt meine intime Feindin, die Mittagshose.
Ein besonderes Kapitel sind die Wasserverhältnisse dieser Gegend. Von allen Reizen Chingulungulus hatte Knudsen gerade sie am höchsten gepriesen; wenn man auch noch so krank und elend sei, von diesem herrlichen Labetrunk werde auch der siechste Körper gesund. Einer unserer ersten Gänge nach der Absolvierung unseres gemeinsamen Einzugsfiebers hat dem Besuche der Hauptquellen des Ortes gegolten. Sie liegen unmittelbar an der Barrabarra nach Susas Residenz zu und hätten von mir schon beim Einzuge gesichtet werden müssen, wäre ich an jenem Tage nicht mehr tot als lebendig gewesen. Erwartungsvoll wandle ich den sonnenheitern, nur ein paar[S. 189] hundert Meter langen Weg auf jene Stelle zu; ein großer Troß von Knaben und halbwüchsigen Burschen hinter uns drein. „So, hier sind wir“, heißt es plötzlich, als wir in drei mannstiefen, geräumigen Gruben eine Anzahl mit dem Pelele behafteter Weiber und mehrere jugendliche Töchter des Landes kauern sehen.

„Na, und der Brunnen?“ frage ich, mir vor meinem geistigen Auge immer noch die glühenden Schilderungen des Norwegers ausmalend.
„Nun, da unten, dort die Löcher, das sind die Quellen; sehen Sie doch, wie die Weiber schöpfen.“ Das sah ich nun allerdings, und im Nu waren alle meine Illusionen verflogen. Doch ebenso rasch war auch schon das wissenschaftliche Interesse erwacht, und nach einem Rundgang um diese Löcher und einem Abstieg in jedes von ihnen war ich sehr bald über die Hydrographie dieses Landes im allgemeinen und Chingulungulus im besondern im Bilde.
[S. 190]
Die Flüsse und Bäche hier im Regenschatten des Makondeplateaus sind Wadi, wie man sie in Nordafrika heißt, oder Omuramben, wie man es im fernen Deutsch-Südwestafrika nennt; sie sind zwar das ganze Jahr wasserführend, doch nur im Grundwasserspiegel; oberflächlich fließt ihr Wasser nur in und unmittelbar nach der niederschlagsreichen Jahreszeit. Diese ist schon seit Monaten zu Ende, und darum ist es kein Wunder, wenn die Leute gegenwärtig immer tiefer in die Bachbetten hineingraben müssen, um zum lebenspendenden Naß zu gelangen. Hier sind sie stellenweise schon durch die gesamte Auflagerungsschicht hindurchgedrungen, und Moritz weiß nicht genug dieses Wasser zu rühmen, das aus reinem Fels entspringe. Es mag in der Tat bakterienarm und auch für Europäer unschädlich sein, aber mich haben die nähern Umstände seiner Gewinnung doch vom ersten Moment meiner hiesigen Anwesenheit veranlaßt, mein seit Lindi geübtes Verfahren des Alaunisierens, Filtrierens und Kochens alles meines Trinkwassers beizubehalten und streng durchzuführen.
Das ist ein Fest, diese ständige Sorge um sein bißchen Flüssigkeitszufuhr. Auf keinem Gebiete des täglichen Lebens kommt dem Kulturmenschen und besonders dem verwöhnten Großstädter der Unterschied zwischen dem alten Kulturlande Europa und dem jungfräulichen Afrika so schneidend zum Bewußtsein wie gerade in der Sorge um den gewohnten Trunk. Im vornehmen Uleia ein leichter Griff an den Wasserhahn, und kristallklares, kühles, wohlschmeckendes und gesundes Wasser rinnt ins peinlich saubere Glas; im plebejischen Afrika brütet am schlammigen Erdloch ein nicht viel weniger schlamm- und schmutzüberzogenes Weib. Hinter ihr auf hohem Grubenrande thront das rundbauchige Tongefäß. Stumpf stiert sie in die schmale Vertiefung hinein; in der Rechten das gewohnte Schöpfgefäß, die quer halbierte Hohlfrucht mit durchgestecktem Holzstiel. Endlich lohnt es, das Schöpfgefäß in die trübe Flut zu versenken; nicht ohne Grazie, mit jenem unnachahmlichen Wiegen der Beckenpartie, wie es nur der Negerin eigen ist, steigt sie nach oben, und in milchweißem Strahl ergießt sich[S. 191] die Ausbeute in das Sammelgefäß. Dies wiederholt sich, bis der große, schwere Krug gefüllt ist. Ein kurzer Gang zum nächsten Busch; mit einer Handvoll frischgrüner Zweige kehrt sie zurück und versenkt den Strauß mit liebevoller Sorgfalt in den weiten Hals des großen Wassertopfes. „Also ein Bukett à l’Afrique,“ denke ich, „etwas barbarisch zwar, aber doch wohl der Beweis eines beginnenden Gefühls für die Schönheiten der Natur.“ Weit gefehlt, so weit ist der Neger und auch die Negerin noch lange nicht; wir eingebildeten Europäer haben es zu diesem heute so viel gerühmten Naturgefühl ja auch erst vor noch nicht zu langer Zeit gebracht; der Neger ist vor allen Dingen praktisch, ja er ist überhaupt nichts als praktisch. Würden die bis fast an den Rand gefüllten Gefäße dieses Straußes ermangeln, ein Meer von Wasser würde sich bei jedem Schritt über Kopf und Körper des Trägers oder der Trägerin ergießen. So wird kein Tropfen verschüttet; die Zweige und Blätter verhindern jede Wellenbewegung in dem engen Becken. Probatum est.
Auch eine Kaffeemaschine ist zu recht vielen Dingen nützlich. Mein Koch Omari hat auf die Benutzung eines solchen Instruments von vornherein verzichtet; daher kam mir der Blechtrichter mit den beiden feinen Sieben ausgezeichnet zur Konstruktion eines Wasserfilters zustatten. Holzkohle gibt es überall; sie ist bald zu feinen Stücken zerschlagen und in starker Schicht in den Trichter gebettet. Dieser ist damit zu einem feinen Filter geworden, der Einfachheit mit leichter Beweglichkeit verbindet und stets reparierbar ist. Mit ihm müssen sich Moritz und Kibwana weit mehr beschäftigen, als diesen faulen Schlingeln lieb ist. Aus meiner frühern Zeit als Ozeanograph, wo ich mich lange mit dem Problem des Sedimentabsatzes in den verschiedenen Wasserarten befaßt habe, weiß ich noch, daß Salze den Niederschlag alles Festen sehr stark beschleunigen. Für die Expedition ist Alaun das gegebene Klärungsmittel. Eine mäßig große Blechbüchse voll ist beim Inder bald erstanden; in langer Reihe haben die Träger die von den Eingeborenen rasch hergeliehenen Tontöpfe und[S. 192] Kalabassen in den Schatten der Barasa gesetzt. „Daua ya uleia“, rufe ich Kibwana zu. Daua ist das Wort für alles, was in den Augen des Negers irgendeine unerklärliche Wirkung hervorbringt; uleia ist ihm gleicherweise alles, was nicht zu seinem geliebten heimischen Erdteil gehört: Europa, auch Deutschland im besondern; selbst das amerikanische Petroleum kommt ihm aus uleia. Hier ist damit die Alaunbüchse gemeint. Eine Prise von dem Salz fliegt in jedes der Gefäße; das gleichzeitige Umrühren ihres Inhalts zeigt dessen erschreckliches Ausmaß von Trübung und Unreinheit. Für Moritz ist diese Brühe gleichwohl ein maji msuri, ein köstliches Wasser. In meinen Augen ist es das erst nach Verlauf mehrerer Stunden. Dann ist die Flüssigkeit in der Tat kristallklar; man gießt sie vorsichtig ab; die Boys jagen sie zwei-, drei-, auch viermal durch den Kohlenfilter. Omari kocht unter Androhung der schwersten Strafen das Wasser 10 Minuten lang; die Nacht über kühlt es ab; morgens ist es dann ein Göttertrank; freilich auch nur erst durch meine Reiseflasche, sodann durch die Fruchtkonserven der guten, alten Hansestadt Lübeck. Selbstverständlich hat man mich in Berlin auch mit der üblichen, großen Aluminiumflasche für Expeditionen ausgerüstet; ich denke gar nicht daran, sie zum Gebrauch heranzuziehen. Wie anders ist da der Hauptmann Seyfried zu preisen! Der hat mich nolens volens in Lindi zum Inder geschleppt. „So, da sehen Sie die große Pulle; die erstehen Sie sich mal für 1 Rupie.“ Gesagt, getan. „Und nun nehmen Sie Ihren schlauesten Träger her, der mag sie Ihnen mit Kokosstricken so umgürten, daß ihr nichts passieren kann. Und jetzt ziehen Sie los in Gottes Namen.“ Die Flasche hat griechische Form, aber indischen Ursprung; sie ist unglasiert, sehr porös und transpiriert ausgiebiger als selbst der schwerstbelastete meiner Träger. Das ist aber auch gerade bei beiden beabsichtigt, beide sollen sich durch diese Transpiration abkühlen. Bei meinen Trägern interessiert mich der Prozeß nicht weiter, um so erquicklicher ist dafür die auch im tollsten Sonnenbrand stets gleich kühle Temperatur meines Trinkwasservorrats, den der[S. 193] lange Kofia tule mit mehr Würde als Grazie auf seinem wolligen Haupte trägt. Höchst spaßhaft ist es übrigens, daß Knudsen durchaus nichts von einer Alaunbehandlung seines Trinkwassers wissen will; er hält dieses weiße Pulver ganz wie seine schwarzen Freunde für eine „Daua ya uleia“, für etwas Unheimliches, dem man nicht trauen darf, und trinkt lieber die trübe, schmutzige Brühe als mein kristallklares frisches Getränk. Habeat sibi.

Nur in unserer Begeisterung für selbstfabriziertes Selterwasser mit Konserven stimmen wir beide vollkommen überein. Jenes stellt sich der Reisende mittels des Sodorapparats her, einer starken Flasche, die oben einen besondern Verschluß trägt. Dieser ist eingerichtet zur Aufnahme einer kleinen Kohlensäurepatrone, die man an jedem Küstenplatze das Hundert zu etwa 10 Mark kauft. Man füllt die Flasche zu fünf Sechstel mit Wasser, legt die Patrone ein und dreht an einer Schraube. Mit lautem Gezisch fährt das Gas in die Flüssigkeit; man schüttelt die Flasche eine Minute, dann ist der „Sauerbrunnen“ fertig. Für sich allein und ohne Zusatz getrunken, schmeckt er nicht gerade berühmt, doch immer noch besser als gemeines Wasser schlechthin; opfern wir aber eine meiner vielen Lübecker Blechdosen mit ihrem verlockenden Inhalt an Kronsbeeren, Birnen, sauren Pflaumen u. dgl. und nehmen deren Saft als „Schuß“, so ist das Ergebnis ein wirklich hervorragendes Getränk. Es schmeckt selbst besser als die schönste Pombe von Chingulungulu, dem bierberühmten.
[S. 194]
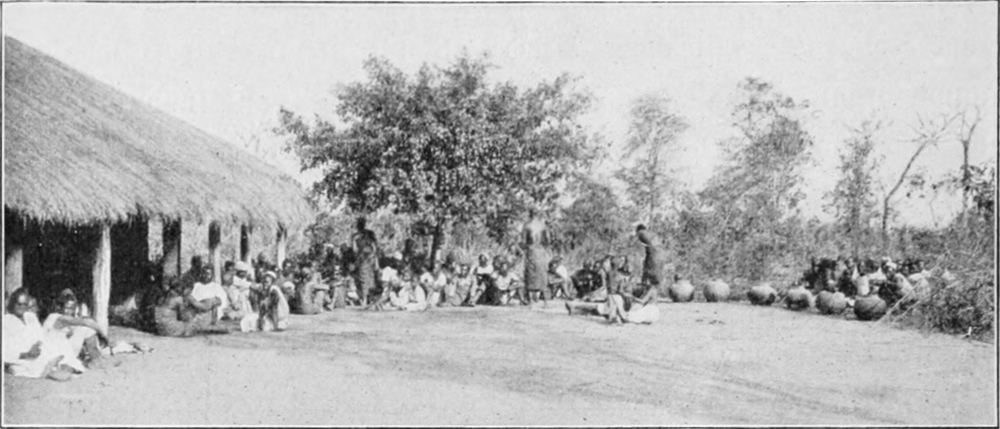
Chingulungulu, 20. August 1906.
Matolas größtes Verdienst ist bisher die Veranstaltung von ein paar Soireen mit den Frauen des Ortes, die er schließlich doch so weit gezähmt hat, daß sie sich in die Höhle des Löwen wagten. Es ist Abend. Knudsen und ich haben unser nicht gerade üppiges Mahl soeben hinter uns; Knudsen unterhält sich wie gewöhnlich mit seinem Freunde, dem schwarzen Prediger Daudi (David); ich sitze an meinem Arbeitstisch und verarbeite in meinen Notiz- und Tagebüchern die wissenschaftliche Ausbeute des wie immer höchst arbeitsreichen Tages. Daudi gehört der englischen Universities Mission an; er hat seine Ausbildung zum großen Teil in Sansibar erhalten und spricht mit mir mit Vorliebe englisch. Für volkskundliche Aufnahmen ist er leider nicht sehr geeignet, da seine Anschauungen viel zu sehr christianisiert worden sind. Der Ostwind, jener Gruß vom Indischen Ozean, der uns sonst allabendlich trotz aller Schutzmaßregeln die Lampe auszublasen droht, ist heute seltsamerweise ausgeblieben; ruhig brennt der „Tippelskirch“ inmitten unserer fremdartigen Umgebung; die Zigarre schmeckt heute ebenfalls ganz ausgezeichnet, alles atmet Behagen und[S. 195] Befriedigung mit dieser Art des Daseins. Da nahen Schritte, leise und fast unhörbar. Das ist hier immer so; der lockere Sandboden dämpft selbst den Schall unserer derben Europäerstiefel bis fast zur Lautlosigkeit. In seiner raschen Weise ist Matola unter uns und unsere hundert Kisten und Kasten getreten. Schon sitzt er auf seiner gewohnten Kiste. Doch nun quillt es herein, braun, schwarz und weiß; braun und schwarz die Leiber mit den glänzenden Gesichtern, hier und da auch Lippenscheibe, Nasenpflock und Ohrschmuck, weiß bei ganz Vereinzelten das Pelele, das in dieser Variation seinen ersten Gruß vom Makondeplateau herunterschickt. Wohl an 30 Frauen und Mädchen sind es, die Mehrzahl von ihnen mit einem Baby behaftet, das ruhig und friedlich, oder auch schnaufend und ächzend im Tragtuch auf dem Rücken der Mutter der Zukunft entgegenschlummert. Stumm hat sich die ganze Gesellschaft, dicht aneinandergedrängt, zwischen uns niedergekauert. Ich lasse ihnen durch Knudsen, der das Kiyao zwar ungrammatisch, aber sonst fließend spricht, auseinandersetzen, was ich von ihnen will: Erzählungen und Lieder, und harre der Dinge, die da kommen sollen. Lange Zeit kommt aber nichts;[S. 196] nur ein halbwüchsiger Junge, der sich mit eingeschlichen hat, fängt an, eine lange Tierfabel zu erzählen; doch spricht er so rasch, daß ich unmöglich folgen kann. Seine Geschichte mir langsam in die Feder zu diktieren, ist er natürlich nicht fähig. Das ist eine Erfahrung, die ich bereits häufig gemacht habe; die Leute singen und sprechen mit beneidenswerter Virtuosität in den Phonographentrichter hinein; sollen sie dann ihren Text langsam zum Niederschreiben wiederholen, so stehen sie rat- und hilflos da. So etwas ist auch eine zu ungewohnte Arbeit.

Wir haben uns den Jungen für eine spätere Gelegenheit aufgespart; alles schweigt. Da erhebt sich, schüchtern zuerst, aber bald stärker und kühner, eine helle weibliche Stimme. Schon fällt auch der Chor ein; Solo und Vorgesang wechseln nun in regelmäßigem Turnus für längere Zeit:
„Chakalakāle, mwāna ya Kundúngu, mwắnya kwa tāti. ‚Anányile litálla kwa tati Kunampūye.‘ Nikwā́ola ku litīmbe, kuwalimāgắ Chenampūye. Newáidje ku mūssi kwa atati wao. Nigómbaga uti nekugawíraga mussi nekutamăgá.“
Zu deutsch heißt das:
„Chakalakale, ein Kind Gottes, reiste zu (seinem) Vater. ‚Zeigen Sie (mir) den Weg zum Vater Kunampuye.‘ Er ging zum Flußbett, wo den Acker bestellte Chenampuye. Er kam zu (seiner) Heimat und zu seinem Vater. Dann wurde geschossen und (ihm) ein Dorf zugeteilt. Und er bleibt zu Haus.“
Soweit ist alles ganz schön und gut gegangen. Das Lied ist verklungen; mit nicht geringer Mühe haben Matola, Daudi, Knudsen und ich schließlich den authentischen Text festgestellt; auch die Übersetzung ist zur Zufriedenheit vor sich gegangen. Leider aber muß ich es mir nunmehr versagen, die nicht üble Melodie des Liedes auf die Walze zu bannen. Nach den letzten Mißerfolgen in Lindi, hervorgerufen durch die infolge der Hitze eingetretene Weichheit der Aufnahmewalzen, habe ich mein Heil später in Massassi versucht; doch[S. 197] auch dort ist bis auf geringe Ausnahmen nicht viel Brauchbares herausgekommen. Für die Aufnahme allein schadet die Weichheit der Walzenmasse nichts, im Gegenteil, sie ermöglicht sogar ein kräftigeres Eindringen des Stiftes; doch wie will man nachher beim Diktat des Textes dessen Fassung kontrollieren, wenn nicht an der Hand einer Wiedergabe der Aufnahme selbst!
Zu dem vorstehenden Liede ist nicht viel zu bemerken; ich zweifelte zunächst den Begriff Mwana ya Kundungu an, aber Matola und Daudi bestanden auf ihrer Erklärung, nach der es wirklich „ein Kind Gottes“ heiße. Welchen Sinn das Wort hier hat, kann ich nicht sagen; vielleicht ist gar ein Aufständischer damit gemeint; weiter im Norden, in Usagara, Ukami und am Rufidyi belegen sich die Majimaji-Führer in der Tat mit einem Titel von derselben Bedeutung. Das Präfix „ku“ in dem Namen Kunampuye ist gleichbedeutend mit dem Präfix „che“; beide bedeuten Herr oder Frau. —
Endlich sind wir mit Textniederschrift und Übersetzung fertig. Vollkommen stumm haben die Mütter unserem Beginnen zugeschaut; um so lebhafter sind dafür die Geräusche gewesen, die von den Kleinen ausgehen. Man hat in der Afrikaliteratur so unendlich viel von der Glückseligkeit der frühen Kindheit des Negers gesprochen; die Angabe hält jedoch der Probe nicht stand. Kaum ist das kurze Wochenbett vorüber, so wandert das Neugeborene in den Rucksack auf den Rücken der Mutter. Dort hockt es den ganzen Tag; ob die Mutter sich von ihrer Nachbarin die kurzen, krausen Haare zu kunstvoller Frisur aufarbeiten läßt; ob sie am Brunnen ein Schwätzchen macht; ob sie im glühenden Sonnenbrand auf dem Felde hackt, jätet oder erntet; ob sie schließlich in stundenlangem Rhythmus an Reibstein und Mörser das harte Korn zu schneeigem Mehl verarbeitet, oder am abendlichen Herdfeuer kauert, niemals verläßt das junge, rosige Menschenkind diese enge, warme, doch hygienisch durchaus nicht einwandfreie Behausung. Mit der Rosigkeit ist es denn auch bald zu Ende. Die Schärfe des Urins und der Schmutz der Fäkalien, für deren Aufsaugung keine[S. 198] Windel sorgt, beizen tiefe und lange Risse in die Epidermis der Gelenkbeugen; die schrecklichen afrikanischen Fliegen legen wahre Brutherde an den Augenrändern der unglücklichen Kleinen an, ohne daß Vater oder Mutter auch nur eine Hand zum Verjagen der Quälgeister erhöbe — sie sind ja für sich selbst schon, ach! so tolerant gegen jene kleinen Bestien. Triefend und trüb schaut denn auch das Kinderauge, das wir bei unseren europäischen Kleinen mit Recht als das Wunderbarste und Schönste im organischen Leben der Erde bezeichnen dürfen, in die Welt hinaus; Schwämme und Pilze wuchern in dichter, weiß-bläulich schimmernder Masse aus Mund und Nase heraus. Dazu die ewigen Katarrhe. Sie sind die Folge des starken Temperaturwechsels zwischen Tag und Nacht. Vater und Mutter können sich durch ihr nächtliches Feuer und ihre Matten schützen; das Kind benäßt sich, bleibt unberührt und unbeachtet liegen, verliert eine große Menge Wärme und erkältet sich. Daher das allgemeine Gekeuche und Geschnaufe in unserer Barasa.

Die Frauen haben gemerkt, daß wir mit der Programmnummer 1 zu Ende sind; leise, aber wiederum nicht unmelodisch, hebt dieselbe Solostimme wie vorhin an:
[S. 199]
Auch dieses Lied ist ein Wechselgesang zwischen Solo und Chor wie der vorige. Ich verstehe schon so viel vom Kiyao, um die beiden Wörter: „ssongo katole“ übersetzen zu können; ihre Bedeutung: „bringe sie her, die Schlange Ssongo“, macht mich neugierig auf die Bedeutung des übrigen. Und mit Recht, denn wie man jemand auffordern kann, dieses giftigste Reptil des ganzen Ostens, dessen Biß auf der Stelle tötet, zu sich heranzubringen, ist mir einstweilen noch schleierhaft. Dennoch bin ich liberal genug, erst noch das folgende Lied anzuhören. Man könnte es auch bloß als eine weitere Strophe des Ssongogesanges bezeichnen, denn es besitzt dieselbe Melodie und behandelt lediglich ein anderes Tier, nämlich den Löwen. Hier der Text:
Ich habe ein gutes Gehör, bin aber sonst musikalisch leider gänzlich unkultiviert. Niemals habe ich diesen Mangel meiner allgemeinen Bildung so aufrichtig bedauert wie hier im Innern Afrikas und besonders im Hinblick auf meinen kranken Phonographen. Wie nett wäre es gewesen, hätte ich die einfache Tonfolge gleich im Notizbuch festhalten können; so muß ich wohl oder übel auf eine Wiedergabe der Melodie verzichten.
Die Vortragsweise ist auch bei diesen beiden Liedern so, daß jeder von der Solostimme vorgetragenen Strophe die Wiederholung desselben Textes durch den gesamten Chor folgt; dies wiederholt sich unendlich viele Mal, bis zur Ermüdung.
Die Übersetzung ergibt in beiden Fällen einen sehr einfachen Wortlaut:
Das ist alles. Ich kann mir den Ausdruck der Bewunderung, der in beiden Fällen ein den Einwohnern höchst gefährliches Lebewesen betrifft, weniger als einen Ausfluß des Naturgefühls oder der ästhetischen Freude an der schillernden Farbe der Schlange und der kraftvollen Gestalt des Löwen erklären, als ihn vielmehr als eine Art captatio benevolentiae auffassen. Die Ssongo beschäftigt groß und klein mehr als jedes andere Tier; sie soll in klippigem Gelände leben, einen Kamm wie ein Hahn haben und auch über bestimmte Locktöne verfügen. Auf ihre Opfer stürzt sie sich schnell wie der Blitz von den Bäumen herunter, die hart am Negerpfade stehen; sie schlägt den Unglücklichen ins Genick; dieser sinkt um und ist tot. Dutzende von Malen haben mir das die Schwarzen vorgemacht. Erklärlicherweise wird diese Schlange über alles gefürchtet; im Hinblick auf so manchen anderen gleichartigen Vorgang in den übrigen Teilen der menschlichen Kulturentwicklung liegt es auch hier nahe, diesen fürchterlichen Gegner dadurch milde stimmen zu wollen, daß man ihn ansingt und als zum Spielen geeignet preist. Genau so ist es beim Löwen.
Doch nun wird’s lustiger; „Chindāwi“, zu deutsch etwa: „Ich will dir mal was sagen“, ertönt es von der einen Seite, „Ajīse, nur zu (komm)“, von der anderen.
„Adju adji“ macht jetzt die erste Sprecherin und fährt mit der wagerecht ausgestreckten Rechten in raschen, kühnen Kurven durch die Luft. Ich weiß nicht, was ich aus dem ganzen Vorgang machen soll, auch nicht, was die Antwort „Kyuwilīri“ von der Gegenseite bedeutet. Die anfängliche stumme Scheu der Frauen hat längst einer gelinden Heiterkeit Platz gemacht, die durch mein ratloses Gesicht nicht gerade abgeschwächt wird. Endlich kommt die Lösung und damit auch die Erlösung. „Adju adji“ heißt lediglich „dies und das“; das Hin- und Herfahren der Hand über dem Erdboden ist eigentlich als im Schein der senkrecht stehenden Sonne ausgeführt gedacht. Dann[S. 201] huscht auch der Schatten dieser Hand ebenso rasch und geisterhaft über den Boden Afrikas hin, und „Kyuwiliri, Schatten“, ist denn auch die Lösung dieses urafrikanischen Rätsels.
„Chindawi — Ajise“ geht das Spiel auch schon weiter. „Gojo gojo kakuungwa?“ lautet diesmal die Frage. Hier heimelt mich die Lösung viel mehr an als bei der Einleitung. „Was klappert in seinem Haus?“ bedeuten jene Worte; „Belemende, die Basi-Erbse“, ist die Lösung. Die Erbse ist natürlich noch in der Schale gedacht, an dem unserm Liguster ähnlichen Strauch, auf dem ihre reifen Früchte im frischen Morgenwind tatsächlich ein klapperndes Geräusch hervorbringen.
Aber weiter: „Chindawi — Ajise“ ertönt es zum drittenmal; „Achiwanắngu kulinganá“ lautet diesmal die Aufgabe. Ich bin wieder vollständig hilflos; da springt Matola in seiner gewohnten Lebhaftigkeit mitten in den Kreis, bückt sich rasch und deutet mit beiden ausgestreckten Händen auf seine Knie. Murmelnder Beifall lohnt sein Beginnen: „Meine Kinder sind gleich groß“, ist die Aufgabe gewesen, „Malongo — die Knie“, das ist die unerwartete Lösung. Uns Europäern mit unserm erschrecklich kühl denkenden Verstande ist die beneidenswerte Fähigkeit unserer frühen Kindheit, auch Teile eines Ganzen für dieses Ganze selbst ansehen zu können, längst abhanden gekommen; dem Neger hat ein gütiges Geschick diese Fähigkeit bis ins höchste Alter bewahrt.
Ich wundere mich nun über gar nichts mehr. „Chindawi — Ajise“ ertönt es zum viertenmal. „Ambudje adyigele utandi“ schmettert eine neue frische Frauenstimme in den Kreis. Dieser blickt geschlossen auf den Europäer hin, der sich wiederum nur durch ein der Verlegenheit entsprungenes: „Si jui, ich weiß es nicht“ aus der Affäre ziehen kann. Hier liegt aber auch die Lösung gar zu weit von unserer ganzen Denkweise ab. „Mein Herr bringt Mehl“ hat die Aufgabe geheißen. „Uli, weiße Haare“, wird mir triumphierend als die Lösung zugerufen. Das Rätsel versetzt uns gleichsam in die Rokokozeit; ein[S. 202] bejahrter Neger mit weißem Haar erweckt in der Tat den Eindruck, als wenn sein Haupt mit Mehl gepudert sei. Dies mag zur Entstehung der Rätselfrage den Anlaß gebildet haben.
Aber nun die letzte Nummer des selbst für einen verwöhnten Forscher überreichen Programms:
„Chindawi — Ajise“ erschallt es zum letztenmal. „Pitaku pite akuno tusimāne apá.“ Die allgemeine Gespanntheit, mit der diesmal wieder alles auf mich hinschaut, ist womöglich noch größer als bisher; alles hat das sichtliche Gefühl der geistigen Überlegenheit über den weißen Mann, der von alledem nichts versteht. Aber diesmal hat sie alle ihr Übereifer verraten; ihr Gebärdenspiel hat mir dargetan, was ihre Sprache mir verschloß: mit beiden Händen hat alles die Bewegung des Gürtelschließens ausgeführt. Lupundu, das Gürtelband, ist denn auch die Lösung dieses Rätsels, das selbst in dem Tonfall der Übersetzung: „Geht links herum, geht rechts herum und trifft sich in der Mitte“ an den Tonfall deutscher Kinderrätsel gemahnt, wie es z. B. das allbekannte: „Oben spitz und unten breit, durch und durch voll Süßigkeit“ ist.
Nunmehr zum Schluß noch die obligate Zugabe. Es ist kein Geringerer als Matola selbst, dessen Munde das ernste Wort entströmt:
„Chikalakasa goje kunganda, kunganda yekwete umbo“; zu deutsch:
„Schädel spielen nicht; es spielt nur, wer Haare (auf dem Kopfe) hat.“
Mit dem schwierigen Werk des Übersetzens geht hierzulande auch stets das des Kommentierens Hand in Hand, und so weiß auch ich denn schon nach kurzer Zeit, daß der Sinn dieser Sentenz etwa der ist: „Freut euch des Lebens“, oder aber: „Nur der Lebende hat recht.“ „Chikalakasa goje kunganda, kunganda yekwete umbo“, spreche jetzt auch ich feierlich, zu Matola und Daudi gewandt, Moritz aber rufe ich mit starker Stimme zu: „Bilauri nne ya pombe, einen Becher Bier für jeden von uns vieren; nur der Lebende hat recht.“[S. 203] Schon schlägt der graugelbe Trank in unseren Trinkbehältern, zwei Gläsern und zwei Blechtöpfen, Blasen — von perlender Pombe kann man beim afrikanischen Rassentrank mit dem besten Willen nicht reden —, ein „Skål, Herr Knudsen!“, „Prosit, Herr Professor!“, ein stummes Neigen des Hauptes bei den beiden Negern. Mit innigem Behagen lassen wir das kühle Naß in unsere durstigen Kehlen rinnen — „kunganda yekwete umbo“, es spielt nur, wer Haare aus dem Kopfe hat. Still, stumm und fast unmerklich sind die schwarzen Doppelgestalten von Mutter und Kind davongeschlichen; „Kwa heri, Bwana“, tönt es von Matolas Lippen und von denen des schwarzen Pastors. Ein rasches Davonhuschen, und der Norweger und ich sind allein.
Grauslich nimmt sich das Schicksal der Frau bei den Naturvölkern in unseren Büchern über Völkerkunde aus; Lasttier, Sklavin, das sind die Ausdrücke, denen der Leser auf Schritt und Tritt begegnet. Zum Glück für die Betroffenen ist die Sache nur halb so schlimm, ja, wollte man z. B. die Küstenkultur Äquatorial-Ostafrikas als Maßstab für die ganze große Welt der Naturvölker im allgemeinen annehmen, so würde sich das Bild zwar nicht gerade umkehren, wohl aber außerordentlich stark verwischen. Es reißt sich keine ein Bein aus, wie unsere derbe, aber treffende deutsche Redensart lautet; kein Weißer hat jemals eine schwarze Maid eiligen Schrittes laufen sehen; und selbst die unvermeidliche Hausarbeit geht ihnen allen so behaglich und behäbig von der Hand, daß manch eine unserer deutschen Hausfrauen über dieses Ausmaß von Muße schier neidisch werden könnte. Bei den Binnenstämmen ist das Los der Frau freilich etwas härter; der Luxus der Küstenfrau fällt hier mehr oder minder weg, auch der Kinderreichtum ist wohl im allgemeinen größer und schafft mehr Sorge; vor allen Dingen aber fehlen den Negerdörfern die Markthallen und die zahlreichen Inderläden, wo man alles in ganz gleicher Weise kaufen kann wie im weitentfernten Europa. Daher geht es denn wohl nicht gut anders: Frau und Tochter müssen schon früh beim ersten Sonnenstrahl heran an den Mörser, an die Wanne, an den Reibstein.
[S. 204]
Es ist 6 Uhr morgens. Unruhig wälzt sich der Europäer im Zelt auf seinem harten Bett; wälzen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck; in dem engen Trog ist eine derartig freie Bewegung nur bei vollem Bewußtsein und auch dann nur bei dem Besitz turnerischer Gewandtheit möglich; die Nacht ist nur wenig erquicklich gewesen. Zunächst hat es am Abend vorher beim Zubettgehen noch eine kleine Feuersbrunst gegeben. Kibwana, der ungeschickte, dumme Kerl aus Pangani, hat meinen letzten Zylinder beim Putzen um die Hälfte seiner ursprünglichen Länge gekürzt. Jetzt ermöglicht der messingene Windschützer zwar das Weiterbrennen der Lampe, aber sie strahlt eine wahnsinnige Hitze aus. Nur so ist es zu erklären, daß ich in dem Moment, wo ich blitzschnell unter dem eben gelüfteten Moskitonetz hindurch auf mein Ruhelager schlüpfe — blitzschnell, um den stets auf der Lauer liegenden Moskitos ein Schnippchen zu schlagen — über und hinter mir einen auffallend hellen Schein bemerke. Umdrehen und mit beiden Händen zuschlagen ist eins. Der Schlag hat Gott sei Dank gesessen; gleichwohl haben die drei Sekunden zwischen dem Aufflammen des leichten Netzstoffes über der wohl etwas zu dicht am Bett stehenden Lampe und meinem instinktiven Zuschlagen genügt, um ein quadratfußgroßes Loch in die vordere Netzwand zu brennen. Kibwana wird es am nächsten Vormittag mit einem Stück Sanda zunähen müssen; es wird nicht schön aussehen, aber vollkommen zweckentsprechend sein; einstweilen tut es auch das Zustecken des großen Loches mit ein paar Nadeln.
Müde und abgespannt bin ich endlich auf mein Lager gesunken und in einen unruhigen Schlaf verfallen. Es mag 2 Uhr nachts sein; verwirrt und dumpf im Kopfe fahre ich empor. Was dringt laut, mit immer gewaltigerem Brausen an mein Ohr? Was rüttelt an meinem Zelt, daß die derben Eschenstangen schier brechen möchten? Ist der Indische Ozean aus seinem Bett getreten, um sein altes Eigentumsrecht an dieser weiten Ebene von neuem geltend zu machen? Ist es ein Taifun, der mit seiner unwiderstehlichen Gewalt alles niederlegen will, Bäume, Häuser und Zelt? Ein ungeheurer Aufruhr[S. 205] durchtobt die Natur; in das Brausen des Sturmes aber mischen sich jetzt neue Töne; ein vielstimmiges Brüllen von der Rückwand des Zeltes her, Rufen, Schreien und Schelten vom Gefängnis herüber, wo meine Soldaten munter geworden sind und nun direktionslos im schwarzen Dunkel der Nacht auf dem Platz um die Barasa hin und her stolpern. Da, ein furchtbares Gebrüll dicht an der Zeltwand. Ist die Löwenplage, die bei Hatia und um Massassi so viele Menschenleben gefordert hat, auch hierher gedrungen? Rasch wie der Gedanke habe ich mich unter dem Netz hindurch in den freien Zeltraum genestelt; ein Griff nach dem gewohnten Platz der Streichholzschachtel; sie ist nicht da. Auch nirgendwo anders ist sie zu finden. Ich gebe die Suche auf und fahre in meine Khakigewandung hinein, indem ich gleichzeitig aus vollem Halse nach dem Posten unterm Gewehr rufe und den Lärm dadurch noch mehr vergrößere. Doch kein Posten naht. Jetzt trete ich hinaus und sehe die Bescherung, soweit die von den Kriegern geschwungenen Feuerbrände den Schauplatz übersehen lassen. Sie kämpfen gegen eine enggeschlossene Schar schwarzer, großer Tiere, doch keine Löwen sind es, sondern Matolas friedliche Rinder. Man hat einer jungen Mutter unter ihnen vorgestern das Kalb genommen; die ganze vorige Nacht und den ganzen Tag hat sie nicht aufgehört, mit kläglichem „Muh“ nach ihrem Kinde zu rufen; jetzt im Aufruhr der Elemente ist sie aus dem leichten Corral ausgebrochen, und alle anderen Tiere hinter ihr drein. Mit wildrollenden Augen glotzen die beiden Bullen in die zur Abwehr geschwungenen Feuerbrände der Soldaten; ängstlich brüllt das Jungvieh dazwischen. Schließlich gelingt es, die Herde zurückzutreiben und mit unsäglicher Mühe wieder in den Pferch zu sperren.
Der weiße Mann im Zelte träumt; ihm hat sich das Nachtgefecht mit Feuerbränden gegen den vierfüßigen Gegner in ein anderes mit Pulver und Blei gegen die bösen Wangoni von Ssongea gewandelt. In merkwürdig regelmäßigen Zwischenräumen krachen die Schüsse von einem Gegner zum andern. Plötzlich hört das[S. 206] Feuergefecht auf. Was kann das bedeuten? Plant der kampfgewohnte Gegner eine Umgehung meiner schwachen Truppe, oder schleicht er unhörbar im Busch, im dichten hohen Grase heran? „Sprung auf marsch marsch!“ kommandiere ich und fahre mit einem gewaltigen Satz aus der Schützenlinie nach vorn. Im gleichen Augenblick stoße ich mit der Nase auf Blechkoffer Nr. 3, der gleichzeitig meine Kriegskasse ist und deshalb dem Tippelskirchbett gegenüber im Zelt Aufnahme gefunden hat. Mein Sprung hat mich unbewußt von allen Traumgefahren befreit und in Raum und Wirklichkeit zurückversetzt. Schon hebt auch das Pelotonfeuer von neuem an: bum, bum, bum, bum, bum, bum. Nach der ereignisreichen Nacht ist mir wirr und dumpf im Kopfe; dennoch muß ich laut auflachen. Dieses so regelmäßige Schützenfeuer ist das rhythmische Stampfen zweier Wayaofrauen in Matolas Gehöft gewesen, die für ihren königlichen Herrn und seinen Hof das tägliche Quantum an Hirse- und Maismehl herzustellen im Begriff waren.

Ich habe die Frauen und Mädchen bei dieser Arbeit oft gesehen, aber heute ist mir’s, als müsse ich gerade diesen Grazien, weil sie mit mir nun doch schon in geistigen Konnex getreten sind, meine besondere Aufmerksamkeit schenken. Rasch ist Toilette gemacht, ebenso rasch das Riesenquantum Houtenschen Kakaos getrunken und der übliche Bananeneierkuchen vertilgt, dann bin ich auch schon mit meiner engeren Leibgarde: Pesa mbili, Yuma, Mambo sasa, Kasi uleia II. und wie sie alle heißen die Braven, Treuen, von denen auf mein Kommando jeder wie ein Windhund nach seinem Apparat oder dessen Einzelheiten greift, mit Kamera und Kinematograph hinter jener Frauengruppe aufmarschiert.
Vier weibliche Wesen sind es; zwei von ihnen schwingen noch immer und unentwegt ihre schwere, lange Mörserkeule weiter. Diese[S. 207] tönt jetzt nicht mehr dumpf wie Kanonenschlag oder der Schuß aus dem Vorderlader, sondern es ist ein mehr klatschendes Geräusch geworden. Matola erklärt mir, jetzt hätten die Frauen Mais in ihrem Mörser, während sie am frühen Morgen Hirse verarbeitet hätten; bei dieser donnere der Mörser so; die Behandlung der verschiedenen Körner sei nämlich die folgende. Die Hirse werde trocken enthülst und geworfelt, sodann gewaschen und eine halbe bis zu einer Stunde in einem flachen Korbe zum Trocknen in die Sonne gestellt; dann erst könne sie auf dem Steine zu Mehl verrieben werden. Der Mais dagegen werde in einem etwas nassen Mörser enthülst; dann quelle er drei Tage in kaltem Wasser. Erst nach Ablauf dieser Frist werde er gewaschen und dann erst gestampft. Das Mehl könne durch Trocknen konserviert werden.
Nach kurzer Weile hört das Stampfen auf; aufatmend wischen sich die Frauen den Schweiß von Stirn und Brust. Es ist eine harte Arbeit gewesen, und wenn an der sonst so grazilen Gestalt der Negerin nichts mehr auffällt als eine unproportioniert starke Ausbildung der oberen Armmuskulatur, so ist vor allem dieses tägliche Mörserstampfen die Ursache davon.
Mit raschem Griff hat die dritte Frau dem Mörser die Masse entnommen. Diese ruht jetzt in einem weiten, flachen Korbe von wohl 60-70 Zentimeter Durchmesser. Doch nur einen Augenblick, dann beginnt es Schlag um Schlag; 10 Sekunden, 20 Sekunden; Hand und Korb beschreiben einen nach unten offenen Halbkreis, aber nicht gleichmäßig, sondern ruckweise. Jetzt sondert sich die leichte Spreu vom schweren Korn; der Endzweck des Mörsers wird sichtbar. Auch ich bekomme jetzt endlich den richtigen Begriff von seiner Rolle: er hat gar nichts mit dem Zerkleinern des Korns zu tun, sondern dient lediglich zum Enthülsen.
Das Worfeln in dem flachen Korb, der Wanne oder wie wir ihn sonst nennen wollen, ist rasch vonstatten gegangen; mit einem besonders kräftigen Ruck sind die blanken Körner in einen andern[S. 208] Korb geflogen. Nach diesem greift jetzt das vierte Wesen, ein junges Ding mit vollen Formen. Es hat bis dahin untätig an der Universalmühle der Urmenschheit gekauert, dem flachen Reibstein. Jetzt kommt Leben in die Maid: knirschend fährt der harte, flache Läufer über die erste Hand voll Körner dahin; Schub auf Schub; feiner und weißer wird die Masse; der Arbeiterin aber wird sichtlich warm. Schließlich ist das erste Quantum fertig; mit langer, eleganter Bewegung gleitet es, vom Läufer nach vorn geschoben, in die dort hart unter den Stein geschobene, flache Schale. Ein Aufatmen, dann ein rascher Griff nach neuem Korn; die Arbeit hebt von neuem an.
Diese Mehlbereitung ist, genau wie bei den Völkern der frühen Antike oder wie auch bei den Indianern des maisverzehrenden Amerika, die Hauptarbeit des weiblichen Geschlechts. Es ist, wie das in der primitiven Natur des Handwerksgeräts begründet ist, wahrlich keine leichte Arbeit, doch trifft sie das hiesige weibliche Geschlecht noch lange nicht so hart wie bei uns zulande die Feldarbeit die Frau jedes Tagelöhners, jedes ländliche Dienstmädchen oder Frau und Tochter des kleinen Landwirts. Die Negerin möchte ich sehen, die auch nur eine einzige deutsche Ernte durchkosten würde, ohne mit Protest davonzulaufen.

Auch die Besorgung des Haushalts drückt nicht überschwer. Die Frau des kleinen Mannes bei uns verfügt gewißlich nicht über eine allzu reichliche Abwechselung in ihrem Speisezettel, doch ist ihre Küche noch immerhin großzügig gegen das ewige Einerlei des schwarzen Küchenrepertoires: Ugali aus Hirse heute, Ugali aus Mais morgen, Ugali aus Maniok übermorgen; dann hebt der Turnus von vorne an. Nun mag die Herstellung dieses afrikanischen Nationalgerichts an und für sich nicht einmal einfach sein — mir ist immer der Vergleich mit dem Thüringer Kloß aufgestiegen, den ja auch nur ganz gottbegnadete Hausfrauen in vollkommen einwandfreier Weise herzurichten vermögen —, aber schließlich muß doch auch das stumpfste Negerweib einmal hinter das Ugaligeheimnis kommen. Knudsen mit seiner Begeisterung für[S. 209] alles echt Afrikanische verspeist das Zeug mit innigem Behagen; mir schmeckt es immer wie ein Stück Wäsche, das eben der Lauge entnommen ist. Im Prinzip ist die Herstellung einfach: man bringt das Wasser in dem großen Topf zum Kochen; dann schüttet man nach und nach und unter stetem Umrühren ganz gleichmäßig das nötige Mehl hinzu. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn der ganze Topfinhalt zu einer glasigen, durchscheinenden Masse eingedickt ist. Um ein europäisches Gericht zum Vergleich heranzuziehen, braucht man nur auf die norditalienische Polenta zu verweisen, die in ganz ähnlicher Weise hergestellt wird und auch ganz ähnlich schmeckt.

Erfreulicherweise gehen die Leistungen meines eigenen Kochs doch weit über die der hiesigen Hausfrauen hinaus, wenngleich auch sein Können, und leider vor allem auch sein Wollen, viel zu wünschen übrigläßt. Omari ist schon äußerlich ein Unikum; auf ein paar winzig kurzen Beinen mit einer Art von Entenfüßen sitzt ein[S. 210] unverhältnismäßig langer Oberkörper; auf dem Oberkörper aber ein Haupt, das nach oben überhaupt nicht zu Ende gehen will; der ganze Mensch besteht, hyperbolisch gesprochen, eigentlich nur aus Hinterkopf. Er ist Bondei-Mann aus dem Norden der Kolonie, gibt sich aber natürlich als Suaheli aus. Doch das tun sie ja alle, die Schensi aus dem Hinterland, wenn sie einmal mit der in ihren Augen glänzenden Küstenkultur in Berührung gekommen sind. Omari ist der einzige Verheiratete von meinen drei Dienern; er behauptet, vier Kinder zu haben, und spricht von seiner Frau mit sichtlichem Respekt. Sie hat ihn auch erst losgelassen, nachdem er ausgiebig für sie gesorgt, d. h. mich veranlaßt hat, für sie bei meinem Daressalamer Geschäftshaus ein Konto von monatlich 7 Rupien zu eröffnen. Ich habe meine drei Mohren alle in ganz gleichartige Khakianzüge gesteckt; alle drei haben sich daraufhin kraft eigener Machtvollkommenheit sofort zu Gefreiten der Schutztruppe ernannt, indem sie den Schneider bewogen haben, ihnen je einen schwarz-weiß-roten Winkel auf den linken Ärmel zu nähen. Nun sind sie unsagbar stolz; leider haben aber ihre Tugenden mit diesem Avancement nicht Schritt gehalten. Omaris Tatkraft habe ich zum erstenmal in Massassi durch ein paar furchtbare Ohrfeigen wecken müssen; bei den beiden andern reichen diese nicht aus, da ist nur der Kiboko wirksam. Will man die drei Männer durch je einen Zug charakterisieren, so ist Omari der personifizierte Aberglaube, Moritz die auskristallisierte Verschmitztheit, Kibwana ein Ausbund von Dummheit; allen dreien gemeinsam ist die noch immer nicht ganz geschwundene Manie, in jedem freien Augenblick bei ihrem Herrn um einen Vorschuß einzukommen. Alle drei fliegen natürlich in gleicher Weise hinaus.
Wäre ich bei der Anlage meiner ethnographischen Sammlung auf lauter Leute von der Art meines Kochs angewiesen, ich würde nicht ein Stück bekommen. Kokett trägt der Bursche an seinem linken Oberarm ein Amulett: eine dünne Schnur mit anscheinend eingenähtem Koranspruch. Leichthin sage ich zu dem Besitzer: „Verkaufe mir das“.[S. 211] Aber welch ein Geschrei hat der Brave daraufhin erhoben: das könne er nicht und das wolle er nicht, denn mit dem Augenblick, wo das Ding von seinem Arm käme, da wäre er auch schon tot. Seitdem mache ich mir von Zeit zu Zeit den Spaß, ihn stets von neuem zum Verkauf seines Talismans aufzufordern; jedesmal erhebt er dann dasselbe Geschrei. Und zeichnen kann er erst! Er hat mir in Lindi einmal die Karte seines Heimatlandes gebracht, von ihm selbst entworfen und auf ein Stück fettigen Butterbrotpapiers gezeichnet. Aus ihr kann höchstens der Teufel klug werden, den er am nächsten Tage, auf die andere Hälfte jenes fettigen Papiers gezeichnet, ebenfalls heranbrachte. Omaris Höllenfürst hat nicht weniger als vier Köpfe, dafür aber nur zwei Arme und gar nur ein Bein; d. h. so schildert er nur den Scheitani mit Worten; seine Zeichnung ist, wie die Karte, ein unentwirrbares Chaos von allerlei krausen Linien. Da sind meine Träger doch ganz andere Künstler; welch lebendige Auffassung herrscht z. B. in jener Zeichnung meines sonst so phlegmatischen Yuma, die den Angriff einer Affenherde auf eine Pflanzung — seine eigene Pflanzung ist es — wiedergibt! Doch mit der Zeichenkunst unserer Schwarzen werden wir uns später noch einmal des näheren befassen müssen.
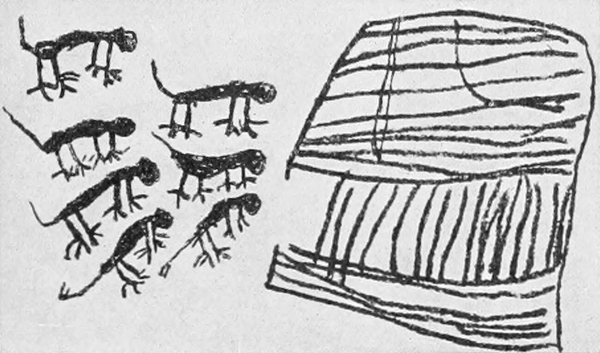
Einen üblen Streich hat mir der Bursche mit meinem Kaffeevorrat gespielt. Ich habe von Daressalam aus zwei große Büchsen besten Usambarakaffees mitgenommen, die eine mit sechs bis acht Pfund gerösteten Bohnen, die andere mit ebensoviel Rohkaffee. Nach menschlichem Ermessen hätte schon die erste Büchse selbst bei stärkstem Einbrauen meines mittäglichen Mokkas auf Monate reichen müssen; um so verblüffter war ich, als mir mein Küchenchef bereits nach[S. 212] 3½wöchiger Reisedauer lakonisch meldete: „Kahawa a me kwisha, der Kaffee ist zu Ende“. Strenge Untersuchung natürlich; Omari behauptet, pro Tag zwei Löffel für mich verbraucht zu haben; ich lasse durch Moritz die zweite Büchse öffnen und messe ihm mit dem bewußten Löffel das Quantum vor, welches er auf Grund seiner Aussage im schlimmsten Fall verbraucht haben kann. In dem Riesenbehälter zeigt sich danach kaum ein Manko. Jetzt sage ich dem Burschen auf den Kopf zu: zu einem Teil hast du ihn selbst gefressen, zum andern an deine Freunde, die Herren Soldaten, verkauft. „Hapana“ ist die ganze Antwort. Retten kann man sich gegen dieses Ausbeutungssystem nur dadurch, daß man dem Mann die benötigte Dosis täglich höchst eigenhändig zumißt; die kostbare Forschungszeit wird dadurch jedoch noch mehr eingeschränkt.
Diese Notwendigkeit der unausgesetzten Kontrolle hat mir auch ein anderer Vorfall klar erwiesen. Kibwana und Moritz sind entweder abwechselnd oder zuweilen auch gleichzeitig krank; beide leiden in der Tat sehr oft an Fieber. Moritz wollte vor einigen Tagen gar sterben, aber nicht hier in Chingulungulu, sondern in Lindi; da stürbe es sich besser. Nils Knudsen mit seinem weichen Wikingergemüt bemitleidete den armen Mohrenknaben so herzerweichend, daß ich mich endlich bewogen fühlte, mein Fieberthermometer — meine Musterapotheke enthält nur eins dieser nützlichen Instrumente — auch einmal außerhalb der gewohnten Ordinationszeit einzulegen. 36,8° hatte der „Sterbende“! Moritz ist diesmal sehr schnell gesund geworden. Doch ein anderes Mal war er wirklich krank. Da habe ich ihm gestattet, sich am Morgen einen großen Topf von meinem Kakao zuzubereiten. Ahnungsvoll gehe ich um Moritzens Frühstückszeit zur Küche hinüber. Was sehe ich? Freilich, zunächst den behaglich schlemmenden Moritz, aber außer dem Patienten auch noch ungefähr meine ganze Mannschaft, die von dem Koch in freigebigster Weise mit dem gesamten Inhalt einer meiner acht Büchsen regaliert wurde. Und da soll man nicht zornig zur Nilpferdpeitsche greifen?
[S. 213]
Erfreulicher für mich sind, schon weil ich dabei nicht der leidende Teil bin, die Vergnügungen der eingesessenen Männerwelt. Im Gegensatz zu Massassi mit seinen solennen Frühschoppen herrscht hier in Chingulungulu die Dauersitzung in den Nachmittagsstunden vor. Moritz muß eine feine Nase für derartige Festsitzungen haben, denn jedesmal, wenn er die Führung bei meinem alltäglichen Nachmittags-Studienbummel übernommen hat, sind wir auf eine gewaltige Schar bechernder Männer, Frauen und Kinder gestoßen. Die Lust am Trunk scheint also auch hier ziemlich entwickelt zu sein, trotzdem hier bei Matola in diesem Jahre eigentlich keine rechte Veranlassung dazu vorliegt. Die gegebene causa bibendi ist und bleibt für den Süden denn doch das Unyago, das Mannbarkeitsfest, von dem ich immer und immer wieder hören muß, von dem die Männer erzählen und auch die Jünglinge, ohne daß ich bisher von dieser Einrichtung auch nur das Geringste zu Gesicht bekommen hätte. Einstweilen sehe ich sogar nicht einmal die Möglichkeit vor mir, die allem Gehörten nach recht komplizierten Vorgänge mit eigenen Augen zu schauen. Aber ich will und muß es erzwingen.
Daß in diesem Jahr des Heils 1906 hier in Chingulungulu kein Unyago stattfindet, beruht auf der Einrichtung, daß dieses Fest im Turnus wandert; es geht reihum von einem Dorfhäuptling zum andern; wie ich wohl mit Recht annehmen darf, der nicht geringen Kosten wegen. Zu den ungeheuren Mengen von Pombe, die anläßlich der vielen Tanzfeste getrunken werden, treten auch noch große Mengen von Speisevorräten, deren Vertilgung die von weit und breit herzugeströmte Festgesellschaft sich mit gutem Appetit und bedeutender Ausdauer hingibt. Dazu kommen schließlich auch noch erhebliche Mengen neuer bunter Kattunstoffe von der Küste, mit denen die für mannbar Erklärten neu eingekleidet, ihre Lehrer und Lehrerinnen aber zum Entgelt für treugeleistete Erzieherdienste honoriert werden sollen. Ich wünsche nichts sehnlicher, als gerade in diese Vorgänge einen guten Einblick zu gewinnen, denn soweit ich die Afrikaliteratur[S. 214] übersehe, ist gerade dieser Teil des ethnologischen Forschungsfeldes hier im Osten bisher nur wenig oder gar nicht beackert worden.
Einstweilen vergnügen die Männer sich und mich in anderer Weise. Schon in Massassi war eines Tags ein Auflauf entstanden. „Sulila a me kuja, Sulila ist gekommen“, hat es von allen Seiten gerufen und geschrien, und ein großer Haufen Volks hat sich um einen fremden Mann zusammengeballt. Dieser war schon dadurch recht merkwürdig, daß er, obwohl stockblind, den weiten Süden Ostafrikas gewohnheitsmäßig mit vollkommener Sicherheit durchzog. Zwar hatte er einen Begleiter, aber dieser führte Sulila nicht, sondern ging hinter ihm her, dem Barden die berufliche Ausrüstung nachtragend. Sulila, dem Stamm der Yao angehörig, ist in der Tat Berufssänger; er erbot sich ganz von selbst, mir seine Leistungen vorzuführen, und war im Handumdrehen mit seinen Vorbereitungen fertig. Sein Handwerkszeug ist einfach genug. Er hat seine Leibkapelle, die er aber von Fall zu Fall rasch zusammenstellt: sechs, acht Männer treten heran, kauern sich im Viereck nieder, legen vor sich eine ihrer Rinde beraubte, armdicke Holzstange, nehmen in jede Hand einen ebensolchen Schlegel und harren des Zeichens zum Beginn der Vorstellung durch ihren Meister. Dieser hat sich inzwischen herrlich ausstaffiert; um Fußknöchel und Knie hat er ganze Rasselsysteme gebunden, Dutzende von Hohlfrüchten von der Größe mittelstarker Äpfel, die mittels Lederriemen unter sich und mit dem betreffenden Körperteil verbunden sind. Um die Hüften trägt der Sänger ganze Felle und Fellstreifen von wilden Tieren, Wildkatzen, Affen, Leoparden; einer barbarischen Krone gleich prangt schließlich auf seinem Haupte, das Gesicht weit überschattend, ein breiter Haarreif aus der Mähne des Zebras oder einer großen Antilopenart.

Sulila ist in das Ouadrat seiner Kapelle getreten; in der Linken trägt er sein Saiteninstrument, in der Rechten den Bogen. Das Instrument ist ein Monochord; der Resonanzboden ein aus dem Vollen geschnitzter Holzzylinder, der Saitenträger ein rundgeschnitzter Stab;[S. 215] die Saite ein Büschel Haare aus dem Schweif irgendeines der großen Säuger des Landes. In Ermangelung von Kolophonium fährt der Barde mit seiner feuchten Zunge über die Strichseite des Bogens. Den hebt er jetzt und setzt ihn auf die Saite; ein klagender Ton; im selben Moment ein furchtbares Gebrüll aus Sulilas Munde und ein ohrenbetäubender Spektakel von der „Kapelle“ auf ihrem „Xylophon“. Im Grunde genommen sollte man es bedauern, als Forscher hinausgezogen zu sein; es gewährt einen unendlichen Reiz, diesen seltsamen Künstler arbeiten zu sehen, und jede Ablenkung durch die Bedienung der Apparate bedeutet einen Genußverlust. Und Sulila arbeitet wirklich; unausgesetzt entlockt er seinem primitiven Instrument die wenigen Töne, über die es verfügt; sie sind tief und ganz ansprechend. Ebenso unausgesetzt ertönt dazu sein Gesang. Dieser ist weniger ansprechend, wenigstens für den Europäer; dem schwarzen Auditorium scheint er als die Musik schlechthin zu gelten, denn es ist einfach „weg“ vor Begeisterung. Sulilas Organ ist rauh, aber stark; diese Stärke mag zu[S. 216] einem Teil auf seiner Blindheit beruhen; genau wie ein Tauber kann auch er nicht den Umfang seiner Schallwellen abschätzen. Zudem ist sein Tempo förmlich rasend; mein Ohr ist an das Kiyao schon etwas gewöhnt, aber trotzdem vermag es kaum Einzelworte zu unterscheiden.
Doch das Reizvollste ist die dritte seiner Betätigungen: Sulila spielt und singt nicht nur, er tanzt auch. Und wie tanzt er! Mit rhythmischem Wippen der Knie, bedingt durch das Streichen der Geige, hebt es an; mit der typischen Unsicherheit des Blinden zittert dabei das Gesicht von einer Seite zur andern. Nach und nach wird das Wippen tiefer, auch schneller; der Tänzer beginnt sich zu drehen; erst langsam, dann schneller; schließlich rast er um seine Längsachse. Auch sein Bogen rast, seine Stimme läßt das nahe Pori erzittern, die Kapelle hämmert mit wahnsinniger Hast auf ihre Holzstangen. Es ist ein Höllenspektakel. Das Publikum ist hingerissen.
Ich habe es, wie gesagt, heimlich immer von neuem bedauert, mich nicht rückhaltlos dem Eindruck dieser Vorführungen hingeben zu können, aber die Forscherpflicht waltet schließlich doch vor; so verlebt man am Kinematographen, am Phonographen und an der Kamera eigentlich mehr anstrengende als unterhaltende Stunden. Daran ist nichts zu ändern; hat man schließlich wie ich das Glück, seine Bemühungen von einigem Erfolge gekrönt zu sehen, so ist dieser Umstand sehr wohl geeignet, alle jene Mühseligkeiten vergessen zu machen; um so mehr, als vor allem der Kinematograph die Szene mit verblüffender Lebenswahrheit wiederzugeben aufs beste geeignet ist.
Phonographische Aufnahmen sind schon bei sehenden Negern nicht leicht. Man hat den Sänger vor den aufgebauten Apparat gestellt, hat ihm klargemacht, wie er den Kopf halten muß, und daß er stets genau in die Trichterachse hineinzusingen hat. „Hast du es begriffen?“ fragt man nach diesem Privatissimum den Barden. „Ndio, jawohl“, ertönt es ganz selbstverständlich zurück. Vorsichtig, wie man einmal in Afrika sein muß, läßt man erst Probe singen, ohne den Apparat anzustellen. Der Mann ist noch zu schüchtern und singt zu leise.[S. 217] „Quimba sana, sing doch lauter“, ermuntert man ihn. Eine zweite Wiederholung; unter Umständen sogar eine dritte und vierte. Jetzt geht es; der Sänger ist im Bilde. Ich stelle den Apparat an, gebe das verabredete Zeichen, Sänger und Maschine arbeiten zusammen. Eine Zeitlang geht das gut; wie eine Säule steht der Sänger. Dann muß ihn irgend etwas in seinem Gleichgewicht stören; unruhig wendet er den Kopf hin und her; man kann gerade noch den Apparat abstellen und die Belehrung von vorn anfangen. Dies ist das normale Bild; in vielen Fällen war es ganz zweifellos die liebe Eitelkeit, die den Sänger veranlaßte, sich während seines Auftretens kokett nach links und rechts zu wenden. Seht, welch ein Kerl ich bin! hieß das auf deutsch.
Viel schlimmer ist es mit Sulila; seine verflixte Gewohnheit des ständigen Kopfdrehens kann er auch vor dem Trichter nicht lassen; die ersten Aufnahmen von seinen Leistungen wimmeln denn auch von den fürchterlichsten Blechtönen. Mit der raschen Impulsivität, die mich vor so vielen Menschen auszeichnet und die ich an mir schon sooft zu bedauern Veranlassung gefunden habe, die mir aber hier über alle Schwierigkeiten glatt hinweghilft, fasse ich neuerdings den blinden Sänger einfach am Kragen, sobald er seine Löwenstimme erschallen läßt. Dann halte ich das wollige Haupt wie in einem Schraubstock fest, bis der Barde sein Heldenlied zu Ende gebrüllt hat. Ob er zuckt und zerrt und den Kopf noch so energisch zu wenden versucht — ich halte ihn.
Und Heldenlieder sind es zumeist, was die Yaosänger mir bisher aufgetischt haben. Hier eine solche Rhapsodie Sulilas, die er mir am 24. Juli in Massassi in den Trichter gesungen hat:
„Tulīmbe, achakalungwa! Wausiyaga ngondo, nichichi? Watigi: Kunsulila kanapogwe. Yaiche ya Massito; uti toakuquimi. Ya yaoide. Nambo yandachi payaiche, kogoya kuona: msitu watiniche; bamba siatiniche; busi siatiniche; nguku siatiniche; kumala wantu putepute; nokodi papopu; kupeleka mbia[S. 218] siakalume. Gakuūnda. Mtimma wassupŭiche: Ngauile pessipo Luja. Kunsulila ngomba sim yaule kwa Bwana kubwa: Nam(u)no anduwedye atayeye mapesa gao. Sambano yo nonembesile.“
Zu deutsch heißt das:
„Laßt uns aushalten, uns Alten! Was ist ein Krieg, was? Sie sagten: Herr Sulila ist noch nicht geboren. Dann kommt (der Krieg) der Masitu; Gewehre werden geschossen (sehr mächtig). Dann sind sie weggelaufen. Aber die Deutschen sind gekommen, gefährlich sah es aus. (Alles) Holz ist abgebrannt; Ameisen wurden aufgebrannt; Ziegen wurden aufgebrannt; Hühner wurden aufgebrannt; alle Leute wurden getötet; Steuer kam herauf; sie mußten bringen Rupien zu Hunderten. War noch nicht zufrieden. Herz wurde ängstlich: Wir wollen lieber sterben auf der andern Seite des Luja. Herr Sulila telegraphierte an den Herrn Bezirksamtmann: er kann mir das Fell über die Ohren ziehen und einen Sack für seine Pesa daraus machen lassen. Jetzt bin ich müde.“
Musikalisch stehen die Völker des Südostens von Deutsch-Ostafrika auf keiner hohen Stufe; sie haben keine eigentliche Melodie, und auch ihre Vortragskunst geht nicht über ein rasendes Parlando hinaus. In beiden Richtungen stehen sie alle, die Yao, Makua und Wanyassa, weit hinter meinen Wanyamwesi zurück, die in beidem Meister sind. Nur einen Vorzug wird man den Südvölkern nicht absprechen können: der Text ihrer Lieder hat Sinn und Verstand, ist folgerichtig aufgebaut und entbehrt hier und da selbst nicht einer dramatischen Steigerung. Diese tritt in Sulilas Liede ja in geradezu großartiger Form zutage.
Die Masitu haben einen ihrer gewohnten Überfälle auf die ahnungslosen Bewohner des mittleren Rovumagebietes gemacht. Welcher der vielen blutigen Raubzüge es ist, läßt sich aus Sulilas Worten nicht entnehmen; es kann ebensogut einer aus den 1880er oder 90er Jahren sein, oder auch der letzte Aufstand. Wahrscheinlich ist es sogar[S. 219] der letztere, denn soweit ich die Geschichte des Südens beurteilen kann, ist bei früheren Aufständen niemals von einer Steuer die Rede gewesen. Es handelt sich auch in diesem Fall weniger um eine Kriegssteuer, als um die Erlegung der seit einer Reihe von Jahren eingeführten Hüttensteuer, die gerade in den letztverflossenen Monaten als eine direkte Folge des von uns siegreich niedergeschlagenen Aufstandes von den Unzuverlässigen und aufständisch Gewesenen in überraschender Höhe an die Bezirkskasse in Lindi abgeliefert worden ist.
Einen Wendepunkt in dem üblichen Geschieße der Neger unter sich bedeutet das Eingreifen der Deutschen; die Eingeborenen haben das Gefühl: Donnerwetter, jetzt wird’s ernst. Dies spiegelt sich in ihrem Ideenkreise wider durch eine Vernichtung der verschiedensten Kulturgüter. Zuerst brennt das Pori nieder; dabei gehen alle Ameisen zugrunde. Dann kommen die Ziegen heran; sie sind hier im Süden nicht zahlreich, wohl aber die Hühner, denen es jetzt an den Kragen geht. Schließlich werden auch viele Menschen getötet; Sulila spricht in seiner Ekstase gleich von allen. Nun kommen die Friedensbedingungen der siegreichen Deutschen: eine schwere Steuer in glänzenden Rupien, die wohl oder übel aufgebracht werden muß. In den Augen der Betroffenen wächst die Summe ins Riesengroße; sie werden ängstlich und planen den Schritt, der hier im Süden stets in der Luft liegt: sie wollen sich durch eine Massenauswanderung den Folgen des Krieges entziehen. Da aber naht der Retter und Held. Es ist Sulila selbst. Im Vollbewußtsein seines hohen Wertes nennt er, der bedauernswerte arme Blinde, sich stolz kun, Herr. Er sieht sein Land schon überzogen mit einem der höchsten Kulturmittel der weißen Fremdlinge, mit dem Telegraphendraht. Eiligst telegraphiert er an den Bwana kubwa, daß seine Landsleute sich in alles ergeben; sie denken nicht mehr an Widerstand, aber sie haben auch kein Geld mehr. Und sie sind so verzagt, daß der Große Herr ihnen selbst das Fell über die Ohren ziehen und einen Beutel für alle die schweren Rupien daraus machen lassen könnte, ohne daß sie noch an[S. 220] weiteren Widerstand dächten. Damit ist das eigentliche Lied zu Ende; der Schlußsatz: Jetzt bin ich müde, bezieht sich auf den Sänger selbst, den die ungewohnte geistige Arbeit des Diktierens stark mitgenommen hat.
Hier in Chingulungulu gibt es von diesen Barden mehrere; der berühmteste von ihnen ist Chelikṓsŏe, zu deutsch Herr Ratte, der bei jedem Auftreten mit allgemeinem Beifallsgemurmel begrüßt wird. Stimmgewaltiger noch als er ist Salanga; dafür ist dieser so dumm, daß es ihm bisher noch nicht gelungen ist, mir einen seiner Liedertexte authentisch in die Feder zu diktieren. Wenn ich es wagen dürfte, die Aufnahmen zu reproduzieren, so hätte ich ohne weiteres ein Mittel, mit Hilfe der Intelligenteren aus der Zuhörerschar den Text genau festzulegen, doch darf ich das bei den 31° Normaltemperatur, die wir jetzt haben, gar nicht wagen. Ich will wenigstens zwei Liedertexte des Likosoe bringen; der eine ist kurz und erbaulich und bewegt sich ganz im Gedankenkreise der Negerrasse im allgemeinen, d. h. der Text enthält nur einen einzigen Gedanken, den Likosoe in regelmäßigem Wechsel zwischen Solo und Chor unendlich oft wiederholt. Das Lied heißt:
Solo: Olendo u che Kandangu imasile. Imanga kukaránga.
Die Reise des Herrn Kandangu ist zu Ende. Der Mais ist geröstet.
Chor: :::Olendo u che Kandangu:::
Anzug und Vortragsart sind bei Likosoe fast genau wie bei Sulila, nur daß Likosoe, seinem Namen entsprechend, noch viel lebhafter geigt, singt und tanzt wie sein blinder älterer Kollege. Er ist überhaupt ein Allerweltskünstler; er mimt zu ebener Erde, und es macht ihm nichts aus, seine Künste auch auf hohen Stelzen zu zeigen, ein Anblick, der mich zum erstenmal nicht wenig in Erstaunen setzte. Das Lied selbst bezieht sich natürlich auf ein Ereignis, auf eine Reise, an der er selbst beteiligt gewesen ist. Das wichtigste Ergebnis im Sinne des Negers ist dabei, daß aller Mais geröstet, d. h. draufgegangen ist.
[S. 221]
Weit interessanter ist das andere Lied des Herrn Ratte; es hat eine unleugbare Verwandtschaft mit Sulilas Heldenlied, gewinnt aber gerade für mich ein aktuelles Interesse dadurch, daß es sich um die Person des Herrn Linder rankt, des trefflichen Wirtschaftsinspektors der Kommune Lindi, dem ich so manchen Ratschlag verdanke und der wegen seiner guten Kenntnis gerade dieses Teiles vom Hinterland ursprünglich zu meinem Begleiter ausersehen war. Linder hat sich um die Niederschlagung des Aufstandes die größten Verdienste erworben; während an das Eingreifen der Schutztruppe noch gar nicht zu denken war, hatte er mit einer schwachen Polizeiabteilung schon zahlreiche Angriffe der Aufständischen abgeschlagen und manchen Sieg davongetragen; schließlich ist er sogar noch ziemlich schwer verwundet worden. Während aber auf Marine und Schutztruppe die Auszeichnungen nur so herniedergeregnet sind, wandelt „Bwana Linda“ noch heute, lange nach dem letzten Gefecht, gänzlich undekoriert unter den Sterblichen. Doch er ist nicht nur ein Held, sondern zugleich auch Philosoph.
Hier das Lied:
„Olendo wa Linda (er); pa kwenda ku Massassi na gumiri chikuo: mkasā́lĭle mbwana kubwa ngondo djiidje na autŭidje lunga yangadye. Mkasā́lile akida Matora: ngondo djiidje na gombel(r)e lilōmbe. nukuidjir(l)a Massassi; Mwera kupita mchikasa mpaka pe Lindi. Ne wapere rukhsa. Yendeye ku mangu enu; mkapānde mapemba.“
Ins Deutsche übertragen heißt das:
„Reise Linders; ging nach Massassi und (ich) schrie aus allen Kräften: Teilen Sie mit dem Bwana kubwa: Krieg ist gekommen, und ich bin weggelaufen, ohne mich umzuschauen. Teilen Sie mit dem Akiden Matora: Krieg ist gekommen, und ich habe geschlagen die Lilombe (die Kriegstrommel). Dann gingen wir nach Massassi; die Mwera (aber) gehen ge(zer)schlagen bis Lindi (zurück). Dann bekommen sie Rukhsa (Erlaubnis): Gehen Sie nach Ihrer Heimat; pflanzen Sie Hirse.“
[S. 222]
Tempo: rasend; Vortragsart: parlando; Inhalt: in wenigen Worten die Geschichte des ganzen Feldzuges, selbstverständlich mit der Person des Sängers als seinem eigentlichen Mittelpunkt. Herr Linder kommt auf einer seiner vielen Inspektionsreisen — eine seiner vornehmsten Pflichten ist die Kontrolle der einzelnen Jumbenschaften, ob sie auch die vorgeschriebenen verschiedenartigen Nutzpflanzen kultiviert haben oder nicht — nach Massassi. Dort ist es selbstverständlich Freund Likosoe, der in deutschtreuer Gesinnung zu ihm eilt und ihn vor den bösen Wamuera warnt. Linder benachrichtigt seinerseits das Bezirksamt in Lindi, schickt aber gleichzeitig auch Likosoe als Eilboten zum Yaohäuptling Matola. Dort schlägt Likosoe die Lilombe, die Kriegstrommel. Matolas Krieger eilen auf das bekannte Alarmzeichen zusammen, 600 Mann mit Vorderladern, viele andere aber mit Speer, Bogen und Pfeilen; dann marschiert der Häuptling mit seinem Heer auf Massassi, um von hier aus den Wamuera in den Rücken zu fallen. Nun wird als Tatsache erzählt, daß Seliman Mamba und seine Unterführer zu Beginn des Aufstandes, als ihre Siegesaussichten besonders groß waren, die Deutschen schon in den Ozean geworfen sahen; in Lindi war für jeden der Führer bereits ein besonderes Haus mit allem Inhalt als Beute bestimmt. Auf diese allerdings nicht verwirklichten Pläne mag sich die Stelle vom Zurückgehen des Feindes bis nach Lindi beziehen. Matola hat zwar, wenn ich nicht irre, in den Gefechten mit den Aufständischen gegen 40 Mann verloren, aber bis nach Lindi zurückgetrieben hat er den Feind doch keineswegs. Der Schlußsatz behandelt dann den Friedensschluß; die Besiegten erhalten Verzeihung und zugleich die Anweisung, sich jetzt ruhig und friedlich in ihre Heimat zurückzubegeben, um dort neue Pflanzungen anzulegen.
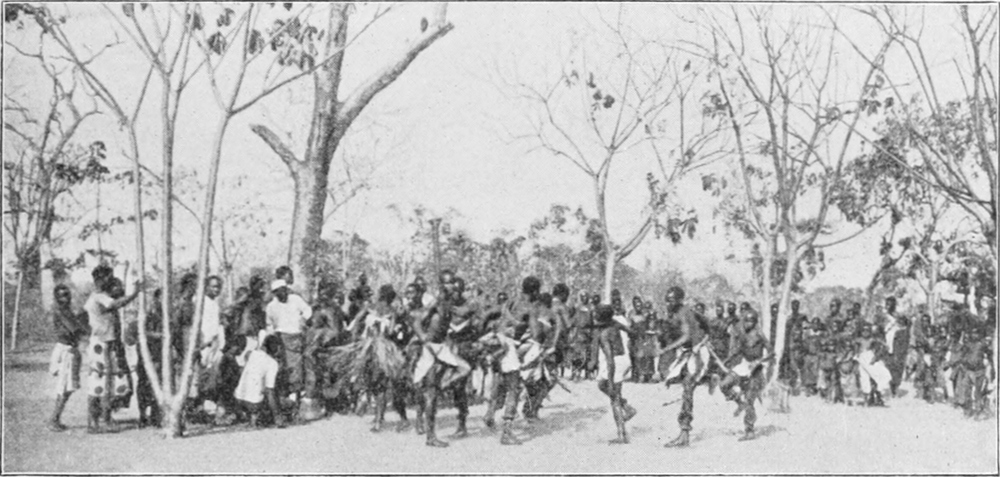
Auch mein Kinematograph hat in den Wochen meines Aufenthalts in Chingulungulu mehrfach zu tun gehabt; ich habe eine ganze Reihe von Yaotänzen und auch solche der Makua aufnehmen können. Dieser Stamm ist bekanntlich das Jägervolk par excellence[S. 223] des Ostens; man bezeichnet sogar jeden Berufsjäger ganz allgemein als Makua, ganz gleich, welches Stammes er auch sei; auch in bezug auf alle Jägersitten und Jagdmethoden, über die ich mich sehr bald werde auslassen können, sind die Makua für alle anderen Völkerschaften vorbildlich. Was Wunder also, wenn die Truppe, die auf Anordnung Matolas eines schönen Tags in Chingulungulu erschien, mir einen Tanz vorführte, der in seiner ganzen Ausdehnung ihrem Jägerleben entnommen war; sie wollten die Makwaru aufführen, wie sie sagten. Rasch wie immer hatte ich meinen Kino zur Hand und an geeigneter Stelle aufgebaut. Das ist hier bei dem lockeren Aufschüttungsboden keine Kleinigkeit; drückt man die spitzen Füße des Stativs zu derb in den Sand, so kann es passieren, daß das ganze Stativbein plötzlich verschwindet; ich bin also vorsichtig geworden und treibe vor jeder Aufnahme schräg von oben unter jedes Bein einen Holzkeil. Schwieriger noch ist die Remedur einer falsch angebrachten Sparsamkeit; um dem Afrikafonds des Deutschen Reiches ganze 12 Mark und einen viertel Träger zu ersparen, habe ich für den Ernemann-Kino nicht das zu diesem gehörige schwere Stativ mitgenommen, sondern begnüge mich mit meinem Photographenstativ. Das ist, wie alles, was mir Gebrüder Grundmann in Leipzig geliefert haben, für[S. 224] seinen eigentlichen Zweck vorzüglich geeignet, für die Erschütterungen des ruckweise arbeitenden Kinematographen aber ist es reichlich leicht. Deswegen hänge ich entweder einen derben, schweren Stein unter ihm auf, oder aber eine gefüllte Reisekiste; und wenn es ganz schlimm wird, muß sich sogar einer der Träger als Schwergewicht opfern.
Der Makwaru gewärtig stehe ich da; mir gegenüber hat sich inzwischen genau die gleiche Kapelle etabliert, wie ich sie von Sulilas und Likosoes Auftreten gewohnt bin: sechs oder sieben Männer und Jünglinge, die, des Beginns der Vorstellung gewärtig, mit je zwei Holzschlegeln über langen, weißen Holzstangen kauern. Da huscht ein phantastisch aufgeputztes schwarzes Etwas in den Kreis. Es bewegt sich mit so raschen Zitterbewegungen, daß zunächst nicht zu erkennen ist, ob ich Mann oder Frau vor mir habe. Erst eine kurze Atempause zeigt uns einen Mann in mittleren Jahren, die Mitte des Körpers eingehüllt in einen ganz in der Art unserer Ballettröckchen aus langen, grünen Blättern gefertigten Schurz. Und wie fliegt dieses Röckchen im Winde! Der Mann bewegt sich zunächst kaum von der Stelle. Er arbeitet in einem schnellen, gleichmäßigen Tempo mit den Füßen; doch auch die Unterarme sind in einer Bewegung, die schwer zu schildern ist, da wir in unserer europäischen Tanzweise nicht das geringste Vergleichsmoment besitzen; alle vier Extremitäten sind in einer durch die Kapelle bestimmten rhythmischen Bewegung. Ob sich die Mittelpartie des Körpers mit dem unausgesetzt fortgeführten Hin und Her diesem Takt anschließt, ist wieder sehr schwer zu entscheiden, da diese Zitterbewegung so schnell erfolgt, daß Einzelheiten überhaupt nicht zu sehen sind. Dieses Stadium dauert eine ganze Weile, so daß es mir fast um meinen kostbaren Kinofilm leid tut.

Endlich wechselt der Jäger die Taktik. Der Tänzer ist nämlich wirklich ein Jäger, und ein sehr erfolgreicher Elefantenjäger noch dazu; er hat soeben, in effigie natürlich, einen starken Elefanten erlegt und muß diese Ruhmestat feiern. Das tut er in der hier geschilderten[S. 225] Weise nach seiner Rückkehr ins Heimatdorf vor dessen gesamter Bevölkerung. Auch hier in Chingulungulu ist alles herbeigeströmt, um den berühmten Mann zu sehen und auch, um seine Tanzkunst zu bewundern. Diese wird jetzt immer lebhafter; der Mann beharrt nicht mehr auf einem Fleck; er trippelt weiter, bald geradeaus, bald im Zickzack; endlich wird aus der Linie ein Kreis, in dem er immer rascher in kurzen, vorsichtigen Sprüngen einherrast. Dabei werden Arm- und Beckenbewegungen in der alten Weise, ohne eine Sekunde auszusetzen, fortgeführt. Noch ein unsinnig schnelles Trippeln im Kreise, ein geradezu wahnsinnig rasches Erzittern des ganzen Körpers; dann steht der Tänzer hochaufatmend still.
Uns Europäern will eine solche Art der Tanzbewegung zu absonderlich und fernliegend erscheinen, als daß wir sie kritisch zu beurteilen vermöchten. Ich hatte von Haus aus eine mimische Wiedergabe der Elefantenjagd selbst erwartet, oder doch wenigstens die mimische Darstellung des Anschleichens und Erlegens jenes Wildes; ich muß gestehen, ich habe in dieser Tanzleistung nichts darauf Hinzielendes finden können. Lediglich die fabelhafte körperliche Gewandtheit dieses Zitterakrobaten habe ich bewundern müssen.
Kaum bin ich mit einem neuen Film wieder aufnahmebereit, da ist auch schon ein neuer Jäger auf der Bildfläche erschienen. Dieser benimmt sich noch kurioser und befremdlicher. Zunächst sieht man weiter nichts als eine wirre, grüne Blättermasse, die sich in konvulsivischen Zuckungen auf der Erde wälzt und krümmt. Nach einiger Zeit entpuppt sich die Masse als ein Mann von der Art des vorigen, nur daß sein Tanzkostüm den Mittelkörper viel ausgiebiger umhüllt als bei jenem. Er versteht zwar auch meisterhaft zu zittern und besorgt es mit derselben Ausdauer wie sein Vorgänger, aber seine Hauptstärke liegt doch in seinen Beinen. O, wie schön kann er die setzen! Wie wandelt er jetzt so stakig dahin; wie schlängelt er jetzt das eine um das andere! Schließlich aber ist doch auch sein Spielplan erschöpft, und er macht einem Dritten Platz.
[S. 226]
Mit diesem kommt endlich die erwartete Pantomime. Wie zum Sprunge geduckt, schleicht der Jäger herbei, unhörbar, jedes Geräusch vermeidend. Geschickt benutzt er jede Deckung, um an den Elefanten, dessen Witterungsvermögen unendlich fein ist, immer näher heranzukommen. Schließlich ist das Ziel erreicht; rasch, aber ebenso unhörbar, ist das Jagdobjekt in Gestalt eines zweiten Mannes auf den Tanzplatz geschlüpft und hat sich dort lautlos niedergekauert. Ihn umkreist jetzt der Jäger in immer enger werdenden Spiralen. Man erwartet den tödlichen Schuß; doch der erfolgt nicht, sondern ganz unbekümmert um den „Elefanten“ fängt nun auch der dritte Tänzer an, genau in derselben Weise zu triumphieren wie die beiden anderen: er übt sich in kunstvollen kurzen Schritten, wackelt mit dem Becken und schlägt mit den Armen. „Bassi, Schluß“, sage ich, da schnurrt auch gerade das letzte Ende meines dritten Films ab.
Ganz entgegengesetzt ist das Auftreten der Wayao in ihren typischen Unyagotänzen. Sie müssen von diesen Tänzen eine ganze Auswahl besitzen; mir haben sie hier in Chingulungulu deren einstweilen nur zwei vorgeführt, eine Masewe, so benannt nach dem früher bereits geschilderten Rasselsystem an den unteren Extremitäten, und eine Luwanja. Beide Tänze sind sich im Charakter übrigens ganz gleich; bei ihnen reicht das Urxylophon der einfachen Holzstangen nicht mehr aus, hier tritt vielmehr eine ganze Kapelle mit Trommeln der verschiedensten Gestalt und Größe in Tätigkeit. Es spricht immerhin für eine gewisse musikalische Rassenbegabung des Negers, daß die Musikanten ihre Instrumente vor dem Beginn der Ngoma erst zueinander abstimmen. Jeder klopft horchend auf das Schlagfell seiner Trommel; hört er, daß sie mit den anderen nicht harmoniert, so geschieht für den Neuling etwas recht Merkwürdiges: mit langen Sätzen ist der Musiker davongeeilt; schon im nächsten Augenblick springt er mit noch längeren Sätzen wieder heran, in der Linken jetzt ein derbes Bündel trocknen Strohes, in der Rechten einen Feuerbrand aus der nächsten Hütte schwingend. Schon liegt das Stroh zu einem[S. 227] Haufen getürmt auf dem Boden, flammt lichterloh auf, und schon haben auch alle Kapellenmitglieder ihre Instrumente mit dem unteren, offenen Ende in den Bannkreis der hoch auflodernden Flamme gebracht. Dort verbleiben die Trommeln verschieden lang, die eine nur Sekunden, die andere große Bruchteile von Minuten. Hin und wieder wird mittels Anschlagens geprüft, ob durch das Austrocknen des Trommelfelles die richtige Tonhöhe erreicht worden ist. Endlich ist die richtige Stimmung da, das Trommeln beginnt.

Im selben Augenblick rast es auch schon heran; in eine dichte Staubwolke gehüllt, nahen sie, Männer, Jünglinge, Knaben in nicht endenwollender Schar. Sie sind alle in derselben Weise aufgeputzt: an Fußknöcheln und Unterschenkeln dichte Bündel von Masewerasseln, um die Hüfte einen dichten Schurz von Fellstreifen und Baumblättern. Vor der Musikkapelle auf dem Festplatz angelangt, ordnet sich der Haufen ganz von selbst; im Gänsemarsch trotten sie einher, einer hinter dem andern; die Reihe schließt sich zum Kreis. Dieser wogt hin und her, links herum, rechts herum; es ist erstaunlich, wie gleichmäßig und exakt die Bewegungen von jedem einzelnen, selbst von dem jüngsten Knaben ausgeführt werden.
[S. 228]
Negertänze scheinen nirgends am Überfluß großer Überraschungen zu leiden; dies muß am Erdteil liegen. Dieser ist, wenige begnadete Stellen ausgenommen, langweilig, und auch die Tänze seiner Bewohner sind monoton. „Ganz recht,“ könnte einer dieser Neger einwenden, „aber ist denn euere Polka und euer Walzer, ihr Weißen, vielleicht abwechselungsreicher als unsere Ngoma? Drehen sich eure Paare nicht etwa auch ganz gleichmäßig dahin?“ So ganz unrecht dürfte unser schwarzer Kritiker wohl nicht haben. Während mir derartige ketzerhafte Gedanken durch den Sinn fahren, hat sich das Bild wenigstens etwas zu seinem Vorteil verändert: der Kreis hat sich in Gruppen aufgelöst, die sich durch die merkwürdigsten Beinbewegungen zu übertreffen suchen; hier sind ja alle Tänzer überhaupt Beinvirtuosen. Die eine Gruppe schwebt auf den Zehen dahin, die andere ahmt den würdevollen Gang irgendeines Watvogels nach; wieder eine andere wippt fröhlich zwischen den übrigen Gruppen hindurch; eine vierte marschiert mit vollkommen steifen Beinen dahin. Längst ist mein letzter Film zu Ende gegangen, aber noch immer tummelt sich der Haufen in der einmal angebrochenen Lust weiter. Schließlich geht auch diese „Nummer“ zu Ende; die Kapelle liefert nur noch scheußliche Mißtöne; ich selbst bin vom langen Stehen ermüdet, Knudsen klagt über die ersten Fiebersymptome; das Fest ist zu Ende.
Die Vorführung solcher Beschneidungstänze bringt es naturgemäß mit sich, daß mein Interesse für diese Stammesfeste immer größer und meine Sehnsucht, sie möglichst genau sehen und studieren zu können, immer stärker wird. Wie sollte es auch anders sein, wenn zu allen diesen fremdartigen Vorführungen der Männer und Knaben selbst noch Faktoren hinzutreten wie die beiden folgenden.
Wie üblich unternehme ich eines Nachmittags meinen Studienbummel durch die nähere und weitere Umgebung von Chingulungulu. Wir haben bereits einige ganz interessante Grabaufnahmen gemacht, das Äußere und Innere einiger entlegener Gehöfte studiert und wollen uns[S. 229] nun damit vergnügen, den Vegetationscharakter des Pori auf die Platte zu bannen. Einer hinter dem andern kämpfen wir uns durch das hohe Gras und das hier ausnahmsweise dichte Unterholz. Da stehe ich plötzlich vor einer kleinen Lichtung; sie mißt vielleicht nur 15 bis 20 Meter im Durchmesser, ist kreisrund und nur von vereinzelten Sträuchern besetzt. Aber was ihr den Stempel des vollkommen Einzigartigen aufdrückt, das sind zwei Kreise von Baumstümpfen, die sich konzentrisch um einen weiteren Baumstumpf als Mittelpunkt gruppieren. Die Dinger sind nur 25 bis 30 Zentimeter hoch, oben ganz glatt horizontal abgeschnitten und laden damit förmlich zum Sitzen ein. Einstweilen habe ich natürlich nichts Eiligeres zu tun, als dieses seltene Objekt auf meine Platte zu bringen, zu Hause aber müssen Matola und die übrigen „Gelehrten“ Auskunft erteilen. Diese ist kurz; die Baumstümpfe seien Stühle für die Wari, die Knaben während der Beschneidungsperiode von einem bestimmten Momente ab; der Mittelschemel aber sei der Sitz für den Lehrer, dem der Unterricht der Knaben während ihres mehrmonatigen Aufenthaltes in einer besonderen Waldhütte nach der Beschneidung übertragen ist. „Also eine Waldschule im besten Sinne des Wortes“, denke ich; die anderen aber setzen hinzu, die Hütte habe dicht dabei gelegen; sie bestehe aber nicht mehr, denn das Unyago, bei dem sie den Knaben als Wohnhaus gedient habe, habe schon vor einiger Zeit stattgefunden.
Es ist ein anderer Frühnachmittag; Knudsen und ich sitzen unter unserer Barasa und pressen uns mit beiden Händen die Schläfen; der Kopf will uns auseinanderplatzen. Das ist jeden Mittag so, so daß wir uns im Grunde genommen weiter gar nichts mehr dabei denken. Es ist aber auch in den letzten Wochen mit jedem Tage heißer geworden; unter 31° C zeigt das Thermometer an keinem Mittag; heute aber sind es schier 34°. Da ist der fürchterliche Kopfschmerz kein Wunder. Fluchend haben wir beide unserem gerechten Zorn auf den schwarzen Erdteil Luft gemacht; gerade bin ich dabei, uns beiden die Beruhigungszigarre in den Mund zu stecken,[S. 230] da nahen zwei schwarze Gestalten. Akundonde ist es, der Weise unter den Yao, und sein Minister Akumapanje. An Akundonde haben wir in unserer Not um Gewährsleute geschickt; jetzt ist er gekommen, trotzdem es ihm schlecht geht; er hat die übliche vernachlässigte Wunde am Bein und kann nur mühselig am Stabe humpeln. Um so anerkennenswerter ist seine Marschleistung von über vier Stunden und sein so opferfreudig betätigter guter Wille.
Akundonde bekommt Knudsens Liegestuhl; der andere setzt sich auf eine Reisekiste. Viel zu lang für mich ungeduldigen Neuling ist das Hin und Her über belanglose Nichtigkeiten; ich bringe denn auch mit einigem Geschick und vielem Glück bald die Unterhaltung auf volkskundliche Fragen. Wie es so geht, sind wir dabei sehr bald bei den allerentlegensten Dingen, bei dem Verhalten der Eingeborenen bei Mondfinsternissen, dem Niederfallen von Meteoren, auch beim Monde. Meteore gelten den Yao als eine böse Vorbedeutung; wenn man sie platzen hört, dann sagen die Leute: „In diesem Jahre wird entweder ein großer Häuptling sterben, oder aber es werden sonst viele Leute zugrunde gehen.“ Verfinstert sich aber der Mond, dann gilt ein solches Phänomen hier, ganz in der Denkweise aller einfachen Völker, als eine persönliche Begegnung zwischen ein paar Feinden. Des Mondes Feind ist natürlich die Sonne; beide fassen einander grimmig an und ringen miteinander. Da beide gleich stark sind, bleibt der Kampf unentschieden. Dies zwingt den Menschen zum Eingreifen; eilends laufen die Yao davon, holen Hacken und Beile herbei und schlagen damit gegeneinander. Dabei rufen sie, zu dem Kampfplatz aufschauend:
„Mlekắngăne, mlekắngăne, mwēsi na lyūwa, mkamulene. Mlekangane, mlekangane sambáno.“
Das heißt zu deutsch:
„Geht auseinander, geht auseinander, Mond und Sonne. Ihr habt einander gefaßt. Geht auseinander, geht auseinander, jetzt gleich.“
[S. 231]
Es ist nur logisch gedacht, wenn auch Sonnenfinsternisse als eine derartig persönliche Begegnung zwischen Tages- und Nachtgestirn aufgefaßt werden. Sie werden in derselben Weise behandelt.
Der Vollmond mit seinem bleichen Licht übt auf die Negerseele denselben magischen Einfluß aus wie auf das Gemüt eines jeden andern Sterblichen, nur daß unser schwarzer Bruder nicht nach unserer Weise gefühlvoll schwärmt, sondern ganz im Rahmen seiner sonstigen Denkweise die günstige Gelegenheit benutzt, seinen Medizinen und Zaubermitteln eine erhöhte Wirkungskraft zu verschaffen. Wenn die Scheibe des Mondes ihre vollständige Kreisform erreicht hat, wandelt der Neger, mit einer ausreichenden Menge eines bestimmten Harzes, Ubani genannt, versehen, an den nächsten Kreuzweg oder an eine Weggabelung. Unter vollständigem Schweigen macht er mit Hilfe des Urfeuerzeuges der Menschheit, dem später noch zu schildernden Bohrstab und Bohrbrett, ein frisches Feuer an. Erst glimmt das Bohrpulver nur schwach, selbst dem scharfen Auge des Wilden kaum bemerkbar. Vorsichtig bläst er das feine Fünkchen weiter und weiter an. Es wird zum Funken, greift auf das Strohbündel über und ergreift auch die Handvoll trocknen Holzes; hellauf schlägt die Flamme. Auf sie streut er jetzt sein Pulver; die reine Flamme des Feuers trübt sich; dichter, schwelender Rauch steigt auf. Da greift der Mann nach seinen Zaubermitteln, den Amuletten, die er an Hals, Armen und Leib zu tragen pflegt; er hält sie in den dichten Rauch und spricht: „Du Mond, vor kurzem warst du noch nicht da, da war der Himmel dunkel; jetzt aber bist du da und scheinst voll hernieder. Alle Tiere und Pflanzen freuen sich und haben durch dich neue Kraft; so möge auch meine Daua neue Kraft bekommen.“ Und dann betet er: „Möge die Medizin meinen Körper schützen vor Löwen und vor Schlangen, vor Zaubermitteln und vor allem, was mir schaden könnte. Auch neue Kraft möge ich in meinen Leib bekommen.“ Noch einmal schwingt der Mann seine Talismane durch den Rauch; dieser wird jetzt dünner und durchsichtiger, auch das Feuer sinkt in sich[S. 232] zusammen. Unhörbar wie er gekommen, schleicht der Mann seiner Hütte zu.
Da wir einmal bei der Zauberei angelangt sind, bleiben die drei Volkskundigen, Knudsen und die beiden Neger, auch gleich bei diesem Kapitel; sie sprechen vom Knotenknüpfen, und Akundonde erzählt, wie ein Mann hierzulande, wenn er Absichten auf ein bestimmtes Mädchen hat, einen Rindenstreifen hernimmt, ihn zu einer Knotenschleife schürzt und zu ihr folgendermaßen spricht: „Du Baum, du heißt Sangalasi (Freude), du sollst mir jenes Mädchen holen; zum Zeichen aber, daß dem so sein soll, schließe ich meine Worte in dich hinein.“ Damit nimmt er die Öffnung der Knotenschleife vor den Mund, steckt die Zunge durch sie hindurch und zieht die Schleife zu. Die Rinde mit dem Knoten trägt er dann als Unterarmband.
Der von Akundonde geschilderte Vorgang ist an sich einfach und harmlos, aber er eröffnet den Ausblick auf ein ganzes, großes Kapitel der Völkerpsychologie. Die Knüpfung eines Knotens bedeutet in der Tat in vielen Schichten der Menschheit etwas Magisches; die bindende Kraft des Knotens wird leicht auf bestimmte Personen übertragen, und wie der Knoten in sich unauflöslich ist, so ist auch jene andere Person, sofern ich den Knoten nach bestimmten Regeln und unter Befolgung bestimmter Zeremonien geknüpft habe, unauflöslich an mich gefesselt.
So sehr mich diese Sachen interessieren und so gern ich noch mehr von ihnen gerade aus dem Munde des Dreigestirns: Knudsen, Akundonde und Akumapanje gehört hätte, so sehr drängt es mich doch, einstweilen mehr von dem vielbesprochenen Unyago zu vernehmen. Ich bringe die Rede darauf, aber die beiden Neger weichen geschickt aus. Da fange ich einen Blick des alten, kranken Häuptlings auf, wie er suchend unseren Arbeitsraum durchmustert. Der Mann hat Durst, denke ich halblaut, und schon fährt mir die Erinnerung an die letzte Dedikation des schwarzen Pastors Daudi durch den Sinn. Dieser hat uns vor einigen Tagen einen der üblichen riesigen Töpfe mit Pombe[S. 233] geschickt, aber diese Pombe ist nichts für unsere verwöhnten Zungen; sie schmeckt gar zu muffig. „Für die beiden alten Sünder wird sie wohl noch gut genug sein“, sage ich zu Knudsen. Den Norweger müssen wohl ähnliche Gedanken bewegt haben, denn er faßt meine Idee sofort auf, holt aus seinem Zelt ein gewaltiges Blechgefäß, taucht es tief in die gelbe, gärende Flüssigkeit und kredenzt es Akundonde. Dieser nimmt den Becher, trinkt aber nicht, sondern reicht ihn seinem Begleiter. „Ist das ein höflicher König!“ denke ich bei diesem Anblick; als ich aber im gleichen Augenblick sehen muß, wie vorsichtig Akumapanje seine Lippen in die Pombe taucht, da wird mir’s klar: es ist eine altüberkommene Sitte, hervorgegangen aus dem angeborenen Mißtrauen des Negers, der zwar nicht überall Gift, wohl aber überall Zauberei wittert und fürchtet. Jetzt soll sich der mögliche Zauber auf das Haupt des Dieners entladen.
Akumapanje hat, nachdem er ein weniges gekostet, den Becher an Akundonde zurückgereicht; mit einem Zuge hat dieser das umfangreiche Gefäß geleert. Wenige Sekunden später befindet es sich bereits wieder am Munde des „Ministers“. Ein riesenlanger Zug; auch er hat es seinem Meister nachgetan; das Gefäß ist leer. In diesem Tempo gehen Trunk und Gegentrunk eine Weile weiter; mit einem aus Neid und Bewunderung gemischten Gefühl verfolgen wir beiden Europäer diese Leistungsfähigkeit. Doch mir fällt wieder unser ethnologisches Endziel ein; und siehe da, was vorher unmöglich schien, jetzt geht es spielend. Mit geläufiger Zunge berichten die beiden, einander gegenseitig ergänzend, über die allgemeinen Züge des Knaben-Unyago, über die Einrichtung, daß das Fest wechsele, was mir durchaus nichts Neues mehr ist; sodann über das Einleitungsfest, bei dem für die zu beschneidenden Knaben eigens Hütten um den Festplatz herum errichtet werden, und wie die Knaben nach diesen Vorbereitungen schließlich in eine im tiefen Walde gelegene besondere Hütte geführt werden, um dort der Operation unterzogen zu werden. Über dies alles bin ich schon durch Knudsen einigermaßen unterrichtet, der sich im Laufe seines[S. 234] vieljährigen Aufenthaltes unter den Wayao eine bewunderungswerte Kenntnis ihres Volkstums angeeignet hat und den ich in jeder freien Minute mit einer Beharrlichkeit auspresse, daß der gute Nils schon oftmals mich oder sich ganz wo anders hingewünscht hat, als wo wir beide uns augenblicklich befinden.
Jetzt endlich kommen die beiden immer redseliger gewordenen Männer, die bei ihrem Eilzugtempo des Ganzentrinkens schon tief in das Pombefaß hinuntertauchen müssen, auf ein Gebiet, über das Knudsen sehr wenig unterrichtet ist, das aber mich am allermeisten fesselt. Es ist der mehrmonatige Unterricht der Knaben in jener Waldhütte durch ihre Anamungwi, die Mentoren, von denen jeder Knabe des Landes von seiner Mannbarkeitsperiode an einen besitzt. Diese Mentoren sind unstreitig eine der sympathischsten Einrichtungen des ganzen hiesigen Volkstums; sie halten ihre Hand über ihren Schützling in jeder Lebenslage, geleiten ihn durch die Schmerzenswochen des Unyago hindurch, unterrichten ihn dort über Schickliches und Unschickliches, und sie bleiben für das Wohlverhalten ihres jungen Freundes auch weit über dessen Jugendstadium hinaus verantwortlich. Mir kam es an jenem denkwürdigen Nachmittage vor allem darauf an, den wesentlichen Inhalt des Moralunterrichts in jenem Waldhause zu erfahren. Ganz ist das große Werk nicht gelungen; doch daß ich wenigstens das Fragment aus der Rede eines solchen Mentors wortgetreu habe niederlegen können, erfüllt mich schon mit großer Freude und Genugtuung.
Einige besonders wohlgefüllte Becher haben die letzten Bedenken der beiden trinkfreudigen Gewährsmänner behoben; ein letztes Anspornen durch Nils Knudsen, dann hebt Akundonde mit lehrhaftem Tone an:
„Mwe mari, sambano mumbēle. Atati na achikuluwēno mnyōgopĕ. Nyumba kasamyinyira tinyisimana chimtumbánăgá. Wakoongwe mkasa yogopa; mkagononau, mesi akayasináu. Imālagắ akamtī́kĭté; imālagắ akamila muchisiĕ́: masakam. Munyitikisie:[S. 235] marhaba. Mkuona mwesi sumyṓgopé, ngakawa kuulala. Kusimana timchiŭá. Miasi jere kogoya. Jerueli winyi.“
In deutscher Übersetzung:
„Du, mein Lehrling (Schüler), jetzt bist du beschnitten. Deinen Vater und deine Mutter, ehre sie. Ins Haus gehe nicht unangemeldet; du möchtest sie sonst treffen in zärtlicher Umarmung. Vor Mädchen mußt du keine Angst haben; schlaft zusammen; badet zusammen. Wenn du fertig bist, soll sie dich kneten; wenn du fertig bist, soll sie dich grüßen: masakam. Dann antwortest du: marhaba. Bei Neumond nimm dich in acht; dann würdest du leicht krank werden. Vor Kohabitation während der Regel hüte dich (du würdest sonst sterben); die Regel ist gefährlich; (sie bringt) Krankheiten viele.“
So schön und vollständig wie hier auf dem Papier sah nun meine Niederschrift im ersten Augenblick keineswegs aus; dem Neger ist es schon in nüchternem Zustande nicht gegeben, seine Sätze sozusagen auseinander zu pflücken und stückweise zu diktieren, hier bei den fidelen beiden alten Sündern aber war es ein Problem. Dennoch haben wir es gelöst bis zur unabwendbaren Katastrophe.
Zwischen je zwei Sätzen haben die beiden sich unentwegt gestärkt; sie sind dabei gerade bis zu den Wirkungen der weiblichen Menses auf das andere Geschlecht gekommen. Etwas unsicher taucht Akumapanje den Becher der Lust wieder tief in den Bauch des Riesentopfes hinunter. Was muß er hören? Ein kratzendes Geräusch. Seine Hand fährt in anderer Richtung durch den Raum des Fasses dahin; dieselbe Wirkung. Mit unsäglich dummem Gesicht hebt Seine Exzellenz den Becher zum Licht; er ist fast leer; er kann auch nicht mehr gefüllt sein, denn die beiden Jubelgreise haben in ihrer Begeisterung das ganze riesige Quantum von wohl über 20 Liter auf einen Sitz ausgetrunken. Mit der wunderbaren Logik des Bezechten halten sie sich aber zu weiteren Ansprüchen berechtigt; sie sind daher über den Mangel weiteren Stoffes sehr entrüstet. Unter keinen Umständen sind sie zur Fortsetzung ihres Unyagokollegs zu bewegen,[S. 236] sondern ziehen beleidigt ab. Das hat man also von seiner übergroßen Gastfreundschaft.
Die hier wiedergegebene Ansprache, die ich unter Mithilfe von Knudsen, Daudi, Matola und einigen anderen Intelligenzen ins Deutsche übertragen habe, soll für alle Unyagofeierlichkeiten nach Inhalt und Form feststehen. Dies wird schon richtig sein, denn ich wüßte nicht, was mehr aus dem Herzen des Negers herausgesprochen sein könnte als gerade diese Vorschriften. Sie sind eine seltsame Mischung von hygienischen Regeln und moralischen Unterweisungen; zugleich steckt in ihnen ein gut Stück uralten, aber noch immer geübten Volkstums. Damit meine ich das Verbot für den Jüngling, nach der Aufnahme in die Schar der Erwachsenen noch das mütterliche Haus unangemeldet zu betreten. Wir leben hier in Ostafrika ganz im Gebiet des Mutterrechts; da gilt der Vater nichts; er ist sozusagen nur angeheiratet. Er ist zwar der Vater seiner Kinder, doch kaum ihr Verwandter; er gehört eben einer anderen Sippe an. Diese Sippe ist, wie dies innerhalb der Welt der Naturvölker so außerordentlich oft wiederkehrt, exogamisch, d. h. ein Jüngling kann ohne weitere Schwierigkeiten ein Mädchen aus jeder andern Sippe seines Stammes heiraten, nur nicht aus seiner eigenen. Dieses Eheverbot geht sogar so weit, daß der junge Yao die Nähe seiner nächsten Sippengenossinnen möglichst zu meiden hat; es sind dies eben seine nächsten Verwandten in Gestalt seiner Mutter und seiner Schwestern. Daher die Vorschrift, sich bei der Annäherung an das mütterliche Haus zum mindesten erst zu melden.
Außerordentlich sympathisch muß uns wohlerzogene Europäer die auch hier wiederkehrende Betonung des Respekts vor Vater und Mutter berühren. Diese Achtung vor den Eltern und vor allen Erwachsenen überhaupt ist, wie man mir immer wieder erzählt hat, der Haupt- und eigentliche Grundzug der hiesigen Volkspädagogik; ihre allgemeine Durchführung seitens der Jugend soll nach Knudsen auch der hervorstechendste Zug im Verkehr der Jungen mit den Alten sein.[S. 237] Wir Europäer könnten in dieser Beziehung sehr wohl von den Negern lernen, meint Nils, der zu einem Urteil zweifellos berechtigt ist.
Aber um meine Unyagorede bin ich trotz aller guten Eindrücke von den Erziehungsmaximen der Neger nun doch gekommen, und daran ist der allzu große Pombetopf des guten Daudi schuld. Es wird schon nicht anders gehen: wenn der Berg nicht zu Mohammed kommt, muß Mohammed zum Berge gehen. Akundonde hat erklärt, er müsse heim, um neue Daua auf seinen Fuß zu legen, er könne unmöglich wiederkommen; so werden wir wohl oder übel den alten Herrn in seiner eigenen Residenz aufsuchen müssen.

[S. 238]
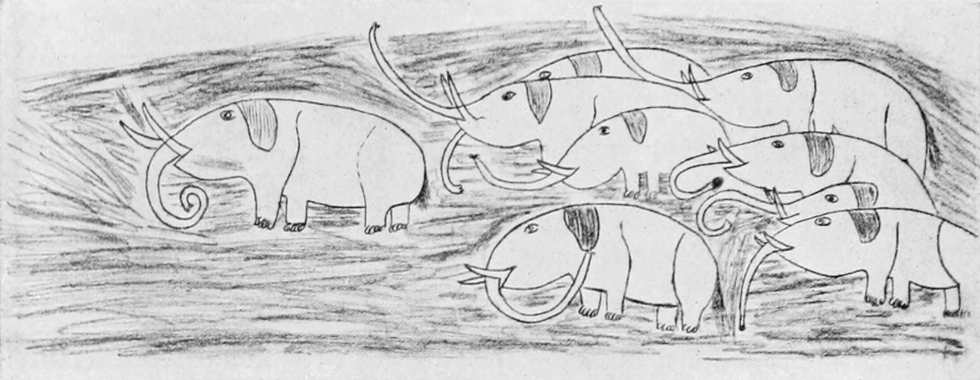
Chingulungulu, Ende August 1906.
Noch immer sitze ich in Chingulungulu; ich fluche mehr denn je auf diesen Sammelpunkt infernalischer Hitze, gräßlichen Staubes und schmutziger Eingeborener, aber ich komme nicht weg! Ursache: die anfängliche Unfruchtbarkeit meines Aufenthalts in wissenschaftlicher Beziehung ist allmählich in das gerade Gegenteil umgeschlagen, so daß ich Mühe habe, unter der Wucht der vielen neuen Eindrücke den Kopf oben zu behalten. Ich kann unmöglich alle diese Beobachtungen und Studien mit dem persönlichen Einschlag wiedergeben, den sie im Interesse der Sache verdienten, d. h. ich kann nicht breit und ausführlich erzählen, wie und in welcher Weise ich meine Einblicke in die Kultur und die Denkweise der hiesigen Eingeborenen gewonnen habe; es würde dies ganze Bände füllen, und zu solchen habe ich jetzt keine Zeit. Daher nur einiges wenige Persönliche und eine kleine Blütenlese aus den verschiedensten Gebieten der materiellen und der geistigen Kultur der Völker dieser weiten Ebene.
[S. 239]
Das wichtigste Ereignis im Leben meiner Expedition ist die endgültige Angliederung der Persönlichkeit Nils Knudsens an mein Unternehmen; unter Vorbehalt der Zustimmung der Landeskundlichen Kommission habe ich ihn am 25. August mit einem ziemlich hohen Gehalt als Reisebegleiter in meine Dienste genommen. Ich habe dabei das Gefühl, daß damit beide Parteien gut gefahren sind. Der Anlaß zu diesem Schritt ist einfach genug. Wie ich bereits früher bemerkt habe, stand Knudsen als Leiter der Handwerkerschule im Dienst der Kommune Lindi; diese hatte ihn auf Ersuchen des kaiserlichen Bezirksamtes bis auf weiteres beurlaubt, damit er in der Ebene westlich vom Makondeplateau eine Art Kontrolle über die Akiden ausüben solle. Aus Gründen, die zu beurteilen ich keine Veranlassung habe, ist der Plan, derartige weiße Kontrollbeamte einzustellen, wieder aufgegeben worden; damit lag für die Kommune Lindi natürlich auch keine Veranlassung mehr vor, ihren Handwerkslehrer zu seinem Vergnügen im Lande spazieren gehen zu sehen; sie heischte ihn also zurück. Ich muß ehrlich gestehen, daß Knudsen mir längst unentbehrlich geworden war. Als daher vor einigen Tagen der kaiserliche Bezirksamtmann uns auf einer seiner Rundreisen vorübergehend besuchte, habe ich den oben vermeldeten Schritt getan und Knudsen bei mir angestellt. Seitdem fühlt er sich anscheinend wichtiger als vorher; es ist aber auch ein ganz ander Ding, einen deutschen Gelehrten in die tiefsten Geheimnisse eines fremden Volkstums einzuweihen, als faule Negerknaben in die Künste des Hobelns, Sägens, Schmiedens und Nietens.
Das zweite Hauptgeschehnis ist ein gräßliches Fieber gewesen, an dem ich gerade in den letzten Tagen schwer darniedergelegen habe. Auch dieser Anfall hat seine kleine Vorgeschichte. Ewerbeck reist nie ohne einen alten Sudanesentschausch, einen Unteroffizier von sehr schwindsüchtigem Äußern, der seine Begleitmannschaft von Polizeisoldaten kommandiert. Dieser Tschausch figuriert in meiner Nomenklatur der Eingeborenen längst als der „Oberhuster“. Der Name ist, was nicht schwer zu erraten, der wundervollen Pfahldorfgeschichte[S. 240] in Friedrich Theodor Vischers köstlichem Roman „Auch Einer“ entnommen, den ich als eine Art Brevier aller Lebensweisheit verehre. Schon in allen Lagern auf unserem gemeinsamen Marsch von Lindi bis Massassi hatte von allen den zahlreichen Expeditionsaskari keiner so virtuos gehustet wie dieser alte Tschausch: ganze Melodien, aber keine ansprechenden, hatte er in seine furchtbaren Anfälle gelegt. Dieser Oberhuster erscheint selbstverständlich auch diesmal mit seinem hohen Chef wieder auf der Bildfläche; eine ganze Nacht lang hat er mir durch seine Künste wieder den Schlaf geraubt; denn wenngleich er und seine Garde diesmal weiter von unseren Zelten abliegen als sonst in der Wildnis, so überwinden diese schrecklichen Töne doch jede Entfernung. Ich bin demgemäß denn auch ganz Rachegefühl. Am halben Nachmittag sehe ich, wie der alte Herr seine Leute zum Appell antreten läßt. Die Pose von ihm kenne ich; bei Tage hustet er nicht, dafür aber kratzt er sich unausgesetzt und beharrlich an der untersten Partie seiner Rückseite. Mit einem Satz bin ich an meinem 9 × 12-Apparat, der beschaulich an seinem Nagel an einem der Barasapfeiler hängt. Ein Griff an den Riemen, „krach“ geht es; ein rascher Blick nach unten, die Tasche ist leer, die Kamera liegt im Staube. Macht nichts, denke ich, und will den Apparat montieren. Es geht nicht; der Schlitten ist verbogen. Dem Schaden ist durch einen energischen Druck abgeholfen. Doch nun der Momentverschluß, dieses Schmerzenskind jedes Tropenapparates! Richtig hat auch er einen Knacks; er schließt nicht.

Es gibt im Menschenleben Augenblicke, über deren Tun und Lassen man sich später vergebens Rechenschaft abzulegen versucht. So begreife ich auch heute noch nicht, wie mich der Verlust dieses Apparates so fürchterlich hat aufregen können, wie es tatsächlich der Fall gewesen ist; an den Besitz meines geradezu ideal guten 13 × 18-Apparates muß ich in jenen Stunden gar nicht gedacht haben. Daß dies später nicht mehr geschehen ist, kann man eher verstehen, denn noch ehe die Sonne versank, erfreute ich mich schon einer schnell steigenden[S. 241] Fieberkurve. Nach meinem bereits früher bewährten Verfahren habe ich das Fieber durch gewaltige Mengen mit Zitronensäure versetzten Tees zu bändigen versucht, aber vergebens. Nach einer schrecklichen Nacht mit durchschnittlich mehr als 40° Temperatur war das Fieber am nächsten Morgen zwar so weit herunter, daß ich mich ermannen konnte, für den indischen Fundi in Lindi die Zeichnungen zu Einsatzrahmen in meinen 13 × 18-Apparat anzufertigen. Bis zu diesem Augenblick hatte ich meine photographische Ausrüstung für mustergültig gehalten, doch an die Möglichkeit eines solchen Unglücks, wie er meinem kleinen Apparat zugestoßen ist, und an seinen Ersatz durch einfache Holzrahmen haben weder ich noch meine Lieferanten gedacht. Mit eiserner Energie habe ich noch gerade jene Zeichnungen fertigstellen und durch einen Eilboten nach Lindi absenden können, da war mein Fieber schon wieder auf weit über 38°, und ich mußte wohl oder übel von neuem ins Bett. Dort ist der Anfall schließlich zu Ende gegangen, wie jedes Fieber zu Ende geht; fast möchte ich heute schon wieder rauchen, wenn wir beiden Europäer auch nur noch das Geringste zu rauchen hätten. Doch die Lust am Aufenthalt in Chingulungulu ist mir seitdem gründlich vergangen; nur eine Tagereise weit von uns winkt der Rovuma mit seinen grünen Ufern, seinem klaren, kühlen Wasser, seinen Sandbänken und Inseln. Dorthin wollen wir in den nächsten Tagen, um für kurze Zeit Erholung zu suchen von all dem kleinen und großen Ungemach, das uns hier in Chingulungulu betroffen hat.
Vorher halte ich es noch für meine Pflicht, wenigstens einiges aus meinen Forschungen und Ergebnissen hier niederzulegen.
Außer den vielen anderen Krankheiten, wie Malaria, Schwarzwasserfieber, Schlaf- und Wurmkrankheit, Rückfallfieber, Beriberi, und wie sie alle heißen mögen, die kleinen und großen Leiden der Menschheit in diesen klimatisch sonst außerordentlich begünstigten Gebieten, ist in unserer Kolonie am Indischen Ozean leider auch der Aussatz endemisch. An der Küste des Südbezirks sucht die Kolonialregierung der weiteren Ausdehnung des schrecklichen Leidens dadurch[S. 242] Herr zu werden, daß sie die Unglücklichen, zurzeit gegen 40 an der Zahl, auf einer Insel im Ästuar des Lukuledi unterbringt, verpflegt und durch das medizinische Personal von Lindi behandeln läßt. Hier im Innern müssen sich die Leprakranken einstweilen noch auf die Fürsorge ihrer Stammesgenossen verlassen. Bei den Yao ist diese Fürsorge ein Gemisch echt menschlichen Mitgefühls und roher Barbarei; der Kranke wird im tiefen Pori in einer eigens für ihn erbauten Hütte untergebracht. Dorthin oder in deren Nähe bringen ihm dann die Verwandten, Freunde und Stammesgenossen die Nahrung, bis es zu Ende zu gehen scheint. Haben die Stammesweisen diese Prognose gestellt, dann bringt man dem Todeskandidaten die letzte Mahlzeit; sie ist reichlich, überreichlich, aber ihre Darreichung geht Hand in Hand mit einer festen Verbarrikadierung der Hütte von außen; selbst wenn der Kranke noch die Kräfte und den Willen hätte, sich befreien zu wollen, es würde nicht gehen; rettungslos ist er nach dem letzten Bissen und nach dem letzten Trunk dem Verhungern preisgegeben.

Ein ander Bild; auch das handelt von Tod und Scheiden. Wie ein Wahrzeichen alter Negerherrlichkeit ragt der Hungurueberg mit[S. 243] Hatias baum- und sagenumrauschtem Grab in die weite Ebene hinaus. Bei anderen Sterblichen ist die Sprache ihrer Gräber nüchtern, sie selbst sind anspruchslos. Hier im weitgedehnten Chingulungulu habe ich Gräber an den verschiedensten Stellen des Pori gefunden, frische und alte; keines von ihnen unterscheidet sich äußerlich von den unseren; ein runder oder ovaler Hügel über dem Leichnam des Kindes, ein länglicher über dem des Erwachsenen, das ist alles; von der mir mehrfach berichteten Sitte, daß über dem Hügel eine leichte Hütte gebaut und diese mit Stoffen verziert werde, habe ich bis jetzt nichts gesehen. Nur ein Grab in Massassi zeigte eine solche Hütte, doch es hieß, es sei ein Arabergrab, und die Stoffe fehlten. In Mwiti aber, wo Nakaams Vorgänger Maluchiro begraben liegt, hat dieses Fürstengrab leider ganz den Charakter des Altüberkommenen verloren; dort stößt der Reisende auf eine gewaltige Hütte von ovalem Grundriß und wuchtigem, weit herniederhängendem Dach; tritt er aber näher, neigt Haupt und Körper und betritt den in seinem Halbdunkel unleugbar stimmungsvollen Raum unter diesem Dach, dann steht ein barbarisch prunkvoller Kunstbau vor ihm: starke, massive, aus Lehm gebaute Pfeiler zu Häupten und zu Füßen des Verstorbenen, etwas niedrigere Mauern zu beiden Seiten. Solche Monumente sind der Stolz des Eingeborenen dem durchreisenden Weißen gegenüber, doch sind sie leider auch der Beweis, wie weit schon islamisches Wesen in die alte Negerkultur eingedrungen ist.
Auch wir Europäer mit unserem übermächtigen Einfluß sind nicht weniger schuld an dem Verwischen des alten Kulturbildes. Zwar so schlimm, wie ich es bisher immer geglaubt hatte, ist es z. B. auf dem Gebiet der Technik des Feuermachens noch nicht; ich hatte mir daheim eingebildet, jeder schwarze Hausvater trüge seine Schachtel „Schweden“ ständig mit sich herum, und bei jeder Hausfrau lägen die Jönköpings wie bei uns an einer bestimmten Stelle des Herdes. Weit gefehlt, nichts davon ist zu finden. Aber auch kein anderes Feuerzeug ist zu sehen. Also sind die Leute feuerlos? Auch[S. 244] nicht; im Gegenteil, sie haben ewiges Feuer. Das ist in der Tat die verblüffende Lösung einer Frage, die in der Völkerkunde schon so viele Geister seit langer Zeit beschäftigt hat. Noch vor wenigen Jahrzehnten glaubten so ernsthafte Forscher wie die Engländer Tylor und Lubbock allen Ernstes an feuerlose Völker; selbst unsere braunen Brüder auf den Marianen sollten zu diesen Ärmsten gehören. Heute ist das Gegenteil einwandfrei nachgewiesen worden; man weiß, daß alle Teile der Menschheit nicht nur Feuer zu ihrem Nutzen zu verwerten, sondern auch auf künstlichem Wege hervorzubringen verstehen. Das Problem hat sich daraufhin zu der anderen Fragestellung zugespitzt: hat die Menschheit das Feuer erst benutzt und dann erst hervorzubringen gelernt, d. h. hat sie die natürlichen Feuerquellen der Vulkane und Laven, brennender Naphthalager, vom Blitz getroffener, trockner Bäume, durch Eigenwärme in Brand geratener, dicht aufgeschütteter Pflanzenmassen zum Ausgangspunkt ihrer Feuerbenutzung genommen und ist später erst zu dessen künstlicher Herstellung fortgeschritten, oder hat sie zuerst den göttlichen Funken durch Bohren, Reiben und Schlagen hervorzubringen gelernt und ist sie erst daraufhin dazu übergegangen, das freundliche Element in seinen Haushalt einzuspannen? Möglich wäre a priori beides, wenngleich natürlich der erste Entwicklungsweg viel wahrscheinlicher ist als der andere. Heute muß man sagen, daß er allein in Frage kommt. Diese Erkenntnis haben wir lediglich der Völkerkunde zu verdanken.
In einer Zeit, wo jahrein jahraus Hunderte und Aberhunderte von Forschern sich abmühen, die letzten und verlorensten der Naturvölker der Gegenwart systematisch zu beobachten und zu studieren, wo die bestehenden ethnographischen Museen sich unter dem Andrang neuer Sammlungen bis zum Übermaß füllen, und wo fast alljährlich neue derartige Museen entstehen, will es uns seltsam anmuten, zu sehen, wie die ältere, weniger glücklich gestellte Zeit sich mit bloßen Schreibtischtheorien begnügen mußte. Im Sturm reiben sich zwei Äste eines Baumes aneinander; immer heftiger und immer stärker wird der[S. 245] Wind, immer rascher die Gleitbewegungen beider Astflächen. Da, ein leises Glühen; ein Fünkchen zeigt sich; rasch wird es zum Funken und zur lodernden Flamme, die mit verzehrender Glut den ganzen Baum ergreift. Unten am Baum hat das primitive Menschenkind gestanden und mit erstaunter Verwunderung dem seltsamen Vorgang zugeschaut. „Ei,“ denkt es, „so also wird das gemacht!“ Und schon nimmt es ein paar Holzscheite und macht es ebenso.
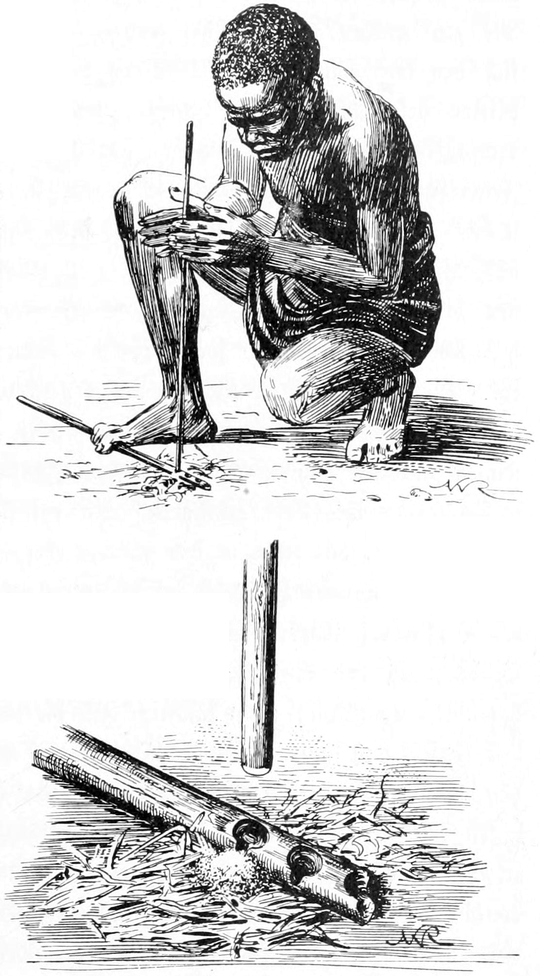
In dieser Schilderung haben wir das Prototyp dieser alten, grauen Theorien ohne konkrete Unterlage; es ist die des alten Sprachforschers Kuhn, den vor einem halben Jahrhundert seine „Herabkunft des Feuers“ zum mindesten ebenso berühmt gemacht hat wie seine sprachvergleichenden Schriften. Uns schlechten Kerlen einer pietätlosen Gegenwart dient der alte Herr jetzt zum Gespött; aber das ist so der Welten Lauf.
[S. 246]
Es ist immer gut, einer weitverbreiteten Kulturerrungenschaft gegenüber, wie es die künstliche Hervorbringung des Feuers ist, an einen mehrfachen Entwicklungsweg zu denken. Wenn wir heute sehen, wie ein großer, ja der bei weitem größte Teil der Urmenschheit sich des Bohrprinzips, ein kleinerer des Prinzips des Reibens, ein dritter dessen der Säge bedient, während der Rest bereits zum Schlagfeuerzeug, zum Hohlspiegel und zum Prinzip des pneumatischen Feuerzeugs übergegangen ist, so ergibt sich jene Notwendigkeit von selbst. Gleichzeitig zeigt uns diese Mannigfaltigkeit der Methoden, daß die Feuererzeugung durchweg erst etwas Sekundäres ist, auf das die Menschheit zufällig und bei Verfolgung ganz anderer Ziele gestoßen ist. Dies trifft sogar für die Feuerpumpe von Südostasien zu. Diese Feuerpumpe ist eine unten geschlossene Röhre, in die der Malaie mit Wucht einen gut schließenden Stöpsel treibt, der in seinem unteren, hohlen Ende eine feine Zundermasse beherbergt. Die zusammengepreßte Luft erhitzt sich und entzündet diesen Zunder. In dem Blasrohr, das etwa in den gleichen Gegenden verbreitet ist, haben wir den zwanglosen Hinweis auf die Erfindung dieses Feuerzeugs; bei der Herstellung jener Schießwaffe, dem Treiben des Loches, liegt die Beobachtung der Lufterhitzung ganz nahe; sie absichtlich zu wiederholen, ist dann nicht mehr schwer. Für die sämtlichen übrigen Formen des Feuerzeugs gibt schon der Kulturbesitz der allerältesten Menschheit Hinweise; bereits der Ururmensch hat schaben, bohren, reiben, sägen müssen, um seine primitiven Werkzeuge, Waffen und Geräte zweckentsprechend zu gestalten. Dabei entstand Schab-, Bohr- und Reibpulver, es entstand zugleich bei kräftiger Betätigung eine mehr oder minder große Hitze, die unter besonders günstigen Umständen jenes Pulver zum Glimmen bringen konnte oder mußte.
So und nicht anders sieht die heutige Völkerkunde die Erfindung der Feuererzeugung an. Diese Erfindung ist sicherlich vielerorts und zu den verschiedensten Zeiten gemacht worden, stets aber doch wohl erst, nachdem das Feuer als Naturerscheinung schon etwas Vertrautes[S. 247] war. Zu dieser Forderung zwingt uns die Beobachtung, die aufmerksame Reisende bei allen Naturvölkern gemacht haben; das Feuer ist ein Haustier, das man hegt und pflegt, das aller Wahrscheinlichkeit nach in seiner Empfindlichkeit gegen jeden Niederschlag sogar eine Veranlassung zur Erfindung des Hauses gewesen ist und das man vor dem Verlöschen zu bewahren sucht, soweit es irgend möglich ist. Auch hier in meinem Forschungsgebiet ist nichts so rührend wie gerade diese große Fürsorge um das „ewige“ Feuer. Hätte ich nicht die Gewohnheit, überall, wohin ich komme, mir von Jung und Alt die Technik des Feuerbohrens vorführen zu lassen, ich glaube, ich könnte zehn Jahre im Lande sitzen, ohne eine Ahnung von dem Vorgang selbst zu bekommen. Selbst über weite Entfernungen hin schleppt man das glimmende Scheit, und erst wenn alle Stricke gerissen sind, wie wir zu sagen pflegen, d. h. wenn auch dieses Scheit erloschen und kein anderes Feuer zu entleihen ist, dann greift der Mann zu ein paar Stäben, um durch eine kurze, aber intensive Bohrarbeit ein neues Feuer erstehen zu lassen.
An den krampfhaften, instinktiven Versuch, durch feines Bohrmehl das im feuchten Urwald verlöschende Scheit zu neuem Glühen zu erwecken, knüpft übrigens die hübsche Theorie Karl von den Steinens an. Zwei Indianer ziehen durch den Wald; sie tragen das glimmende Scheit unter großer Sorge mit sich, denn ein feiner Regen rieselt herab. Der Regen wird stärker; „das Feuer geht aus!“ ruft der eine. Seines Tuns selbst kaum bewußt, bricht der andere einen trocknen Holzstab entzwei, setzt das Ende des einen Teils auf die Peripherie des anderen und quirlt wie toll drauf los. Was er will, ist lediglich Pulver, feines trocknes Pulver, von dem er weiß, wie gut es zum Wiederbeleben erlöschender Flammen ist. Er bohrt und bohrt, immer wilder, immer schneller: schon liegt ein ganzes Häufchen des gewünschten Materials neben der Unterlage. Doch siehe da, ein feiner Rauchfaden steigt aus dem kleinen Kegel empor; er wird stärker und stärker; ein helles Fünkchen blinkt aus der gelben Masse heraus;[S. 248] instinktiv fängt der Wilde an, sanft zu blasen — die Feuererzeugung ist erfunden.
So kann und wird es wahrscheinlich im fernen Südamerika gewesen sein, so könnte es auch alltäglich hier in Afrika vor meinen Augen geschehen, wenn der Neger die gleiche Beobachtung nicht schon vor Jahrzehntausenden gemacht hätte. Nicht jeder kann es; ich habe Virtuosen vor mir gehabt, die vom Beginn des Quirlens bis zum Emporzüngeln der hellen Flamme noch nicht einer halben Minute benötigten; andere haben sich lange gequält und schafften es doch nicht. Wesentlich für das Gelingen ist die Kerbe zur Seite des Bohrloches, damit das allererste Fünkchen auf dem kürzesten Wege zum herabrieselnden Pulverkegel gelangen kann; wesentlich ist ferner auch ein ruhiges, gleichmäßiges Quirlen ohne Überhastung, und ein sanftes, stetiges Blasen wie am Lötrohr. Wie oft habe ich mich in Leipzig mit dem Feuermachen nach allen möglichen Bohrmethoden versucht, und wie haben meine Studenten und ich uns gequält und abgerackert! Auf die drei Punkte haben wir nicht achtgehabt, aus dem einfachen Grunde, weil wir sie nicht kannten. Daher unsere bisherigen Mißerfolge. Aber von nun an soll es anders werden!
Der Gegensatz zwischen Virtuosen- und Stümpertum waltet zu meinem Erstaunen hier auch im Waffenhandwerk vor. Wie die Leute mit ihren Vorderladern umzugehen verstehen, kann ich nicht beurteilen, da diese Waffe jetzt brachliegt; aus Anlaß des Aufstandes ist die Pulvereinfuhr gesperrt, der Einfachheit halber sogar auch für unsere Bundesgenossen in jenem Kriege. Schon dieser Umstand bringt es mit sich, daß die alten Waffen gegenwärtig mehr zum Vorschein kommen, als dies sonst wohl der Fall sein mag; außerdem weiß alle Welt, daß der fremde Mann aus Uleia sich für solche Dinge interessiert, was selbstverständlich ebenfalls nicht wenig dazu beiträgt, meine nähere und weitere Umgebung zeitweise etwas zu enteuropäisieren. Für den Hauptgebrauch aller Waffen, für die Jagd auf Groß- und Kleinwild, hat übrigens der Vorderlader nur geringe oder gar keine taktischen[S. 249] Änderungen mit sich gebracht. Die Schwierigkeit bei der afrikanischen Jagd, an das Wild in wirksame Schußnähe heranzukommen, besteht bei diesen vorsintflutlichen Donnerbüchsen nach wie vor, und ihrer Überwindung gilt denn auch die Unsumme von Vorbeugungsmaßregeln, deren sich die Jäger vor und während der Jagd befleißigen.
Die hiesigen Jäger, unter denen in allererster Reihe Nils Knudsen zu nennen ist, haben mir im Lauf meines einmonatigen Aufenthaltes in Chingulungulu die längsten Geschichten über die einheimischen Jagdmethoden mit all ihrem Drum und Dran erzählt. Wenn gar nichts anderes mehr zog, wenn ich von der unausgesetzten Arbeit des Photographierens, Phono- und Kinematographierens, des Zeichnens, Ausfragens und Niederschreibens müde war, und wenn meine unglücklichen Gewährsleute sich mit ihrem natürlichen Takt nur noch aus Rücksicht auf ihren vornehmen weißen Gast aufrecht erhielten, dann brauchte ich nur das Thema Jagd anzuschneiden, und sofort war alles wieder frisch; auch ich, denn tatsächlich kann man sich kein interessanteres Bild aus der Völkerkunde denken als gerade diese Verhältnisse.
In einer der täglichen Dauersitzungen, zu denen die Männer des Dorfes während eines großen Teiles des Jahres eigentlich immer versammelt sind, hat das „Plenum“ für die nächste Zeit einen großen Jagdzug beschlossen; mit einem Eifer, der den sehnigen, aber sonst doch ganz behäbigen Männern im allgemeinen fremd ist, eilt heute jeder seiner Hütte zu. Aufmerksam prüft jeder Hausherr sein Gewaffen. Es ist eine altbekannte Tatsache, daß der Neger sein Gewehr stets in tadellosem Zustande erhält; darauf kommt es aber heute nicht an, heute gilt es, die Beute selbst zu bannen und den Beistand der höheren Mächte für das Unternehmen zu sichern. Dazu ist Medizin nötig, viele und starke Medizin. Von allen irdischen Dingen die stärksten sind Körperteile von totgeborenen Kindern: diese haben auf dieser Erde nichts Übles tun können, ihr Schuldkonto ist demgemäß ganz unbelastet, und jeder Teil von ihnen ist daher, nach der Denkweise des Negers, mehr als alles andere geeignet, auf[S. 250] andere Geschöpfe einzuwirken. Ähnliche Gedanken scheinen auch bei der um jeden Preis erstrebten Benutzung des menschlichen Mutterkuchens vorzuwalten; Skeletteile von längstgestorbenen Menschen, besonders von berühmten Jägern, hat unser Weidmann hingegen deshalb zu erlangen versucht, weil diese Teile nach seinem Glauben die Fähigkeiten des Verstorbenen ohne weiteres auf ihn übertragen. Alle diese Dinge, außerdem auch Stücke von den Wurzeln ganz bestimmter Pflanzen, werden zu Amuletten verarbeitet, mit denen der Jäger teils sich selbst, teils sein Gewehr ziert. Erst wenn er sich für alle Fährlichkeiten gewappnet erachtet, ist er beruhigt und kann nun des Aufbruchs zur Jagd selbst harren.
Bei den zahlreichen Antilopenarten des Landes verläuft diese Jagd natürlich stets harmlos und ungefährlich. Die Jagdteilnehmer haben sich zur festgesetzten Frühstunde am bestimmten Ort versammelt; doch brechen sie noch nicht auf, sondern zunächst erfolgt ein allgemeines Abreiben mit Abkochungen gewisser Wurzeln. Das ist nötig, um die geschilderte, fabelhaft starke Ausdünstung dieser Leute samt ihrem Hausgeruch durch einen dem Wilde weniger auffälligen anderen Geruch zu übertäuben. Schon die gewöhnlichen Antilopen wollen in dieser Hinsicht sehr vorsichtig behandelt sein; ungleich mehr Vorsicht beansprucht die Elandantilope, und am meisten selbstverständlich der Elefant. Erst dann beginnt die Jagd.
Unermüdlich, ohne Rast und Ruh folgen die Männer der einmal gefundenen Spur; sie erklettern die Termitenhaufen, steigen auf die Bäume und halten von Hügeln Ausschau; schließlich haben sie sich auf 40 bis 30 Meter oder noch weniger an die Herde oder den Einzelgänger herangepirscht, eine Salve von Schüssen schleudert ganze Eisenmengen auf das Ziel zu, das entweder im Feuer stürzt oder aber erst nach langwieriger Verfolgung der Schweißspur im Pori verendet gefunden wird. Einhellig drängen sich jetzt alle Jäger heran; es gilt, die Amulette mit dem Blute des erlegten Tieres zu tränken, um sie auch für späterhin wirksam zu machen; der glückliche[S. 251] Schütze aber eignet sich das abgeschnittene Schwanzende des Tieres als heißersehnten Schmuck an. Er wie seine Gefährten nehmen sodann je ein Stückchen von der Nase des Tieres als Medizin, um ihren Spürsinn zu stärken und zu verfeinern; von der Herzspitze, um sich selbst Ausdauer in der Verfolgung zu sichern; von den Augen, um ihr Gesicht zu schärfen, und vom Gehirn, um ihre Intelligenz zu vergrößern. Die Teile von Herz, Augen und Gehirn werden gegessen, desgleichen ein Stückchen Fleisch vom Kugeleinschlag, dieses, um den gleichen Erfolg für später zu verbürgen; auch von der Leber wird etwas genossen. Ich habe nicht erfahren können, aus welchen Beweggründen gerade dies geschieht, doch gilt dieses Organ vielerorts als Sitz des Lebens; vielleicht liegt diese Ideenassoziation auch hier zugrunde. Alles aber, was nach diesem merkwürdigen Jagdfrühstück von Fleisch und Hautteilen des Tieres an den Händen der Jäger kleben geblieben ist, muß unweigerlich an das Gewehr geschmiert werden; so will es die Regel. Dann eilt alles davon; das Tier ist zwar erlegt, doch ist seine Seele nicht getötet worden; es wird sich rächen wollen, und dem muß begegnet werden. Mit vielerlei Wurzelzeug kehren die Mannen zurück; ohne viel Zeit zu verlieren, haben sie sich mit dem Saft jener Kräuter und Wurzeln eingerieben, und damit sind sie gegen die Rache des besiegten Gegners gefeit.
Doch was ist eine einfache Antilopenjagd gegen den Wust von Aberglauben und Geisterfurcht, wie er vor, während und nach einer Elefantenjagd zutage tritt! Ich muß es meiner Feder hier versagen, die Einzelheiten der Bereitung dieser Medizinen und Amulette zu schildern und ihre mehr als abenteuerlichen Bestandteile aufzuzählen. Eine Elefantenjagd zwingt nicht nur den Herrn des Hauses selbst zu einer ganz bestimmten Lebensweise bei Tag und bei Nacht, sondern zieht auch die der Frau schon mindestens eine Woche vorher in ihren Bann. Für gewöhnlich haßt der Neger nichts mehr als eine Unterbrechung seiner Nachtruhe; jetzt stehen Mann und Frau[S. 252] halbe Nächte lang, um den Weidmann durch richtig wirkende Amulette für seine schwere Aufgabe würdig vorzubereiten. Teile der menschlichen Nachgeburt, von menschlichen Gehirnen und dergleichen spielen auch jetzt wieder eine große Rolle, aber auch menschliches Sperma tritt nunmehr hinzu, und vor allen Dingen Rindenstücke von den verschiedensten Bäumen, mit deren Abkochung der Jäger sich und sein Gewehr einreibt. Ich muß darüber auf die offizielle Bearbeitung meiner Ergebnisse verweisen, wo der Leser diese und so manche andere der tausend Einzelheiten meiner Forschungsergebnisse nachlesen mag.
Wir können und wollen die kühnen Jäger auch nicht auf ihrem Zuge begleiten; uns mag es genügen, zu betonen, daß, wenn alle anderen Maßnahmen, den Elefanten zum Stehen zu bringen, versagen, ihnen ein unfehlbares Mittel unter allen Umständen bleibt. Dieses ist zudem sehr einfach: man nimmt Erde aus den vier Fußtapfen des verfolgten Tieres, mischt sie mit einer bestimmten Wurzelmedizin und bindet diese Mischung irgendwo fest, dann muß der Elefant dort stehenbleiben, mag er wollen oder nicht.
Sie haben ihn denn auch glücklich zur Strecke gebracht, den edlen, unter der Aasjägerei schwarzer und weißer Nimrode heute leider so unglücklichen Dickhäuter. Wie eine Anklage gegen den gefühllosen, profitgierigen Europäer, der es sich nicht hat versagen können, dem ersten besten hergelaufenen schwarzen Halunken die totbringende Erfindung des Freiburger Mönches zugängig zu machen, liegt der gefällte Koloß da. Feig und vorsichtig, mit gezücktem Messer schleicht jetzt der beherzteste der schwarzen Jäger heran; ein rascher, kräftiger Schnitt: die Rüsselspitze liegt abgetrennt in den Händen des Negers; ebenso rasch ist sie auch schon vergraben. Sie lebe noch lange, heißt es; sie sei auch das Gefährlichste am Elefanten, und sie dürfe nicht länger sehen, was nun geschehen wird. Was nun geschehen wird? Überflüssige Frage. Der Neger ist ein Naturkind und ein Kind überhaupt, er springt und tanzt also um den gefällten Riesen und verknallt unsinnige Mengen seines teuren Pulvers in die Luft. Aber[S. 253] dann tritt doch gleich wieder das ewige Furchtgefühl vor der allbelebten Natur ein, der Reigen löst sich, die Jäger verschwinden; mit Wurzeln kehren sie aus dem Pori zurück und reiben ihre schweißtriefenden Leiber ein. Jetzt erst sind sie gefeit gegen die rachebrütende Seele des Elefanten, der ja in Wirklichkeit ein mächtiger Häuptling ist, und können mit Muße an das Herauslösen der Zähne, das Zerlegen des Tieres selbst, das Vertilgen ungeheurer Massen frischen Fleisches und das Konservieren der überflüssigen Fleischvorräte gehen. Das geschieht in derselben Weise, wie man am Rovuma Fische trocknet, nämlich auf etwa einen halben Meter hohen Rosten über dem Feuer; andere ziehen es vor, das in Streifen geschnittene Fleisch an der Luft zu trocknen. Viel soll es nicht sein, was in dieser Weise der Behandlung bedarf; der Neger gleicht dem Aasgeier, er wittert sozusagen auf Meilen, wo ein Stück Fleisch die Eintönigkeit seiner Ugalidiät einmal zu unterbrechen berufen ist, und so sorgen schon nach unglaublich kurzer Zeit Hunderte von Kostgängern für den raschen Abgang des schönen Bratens.

[S. 254]
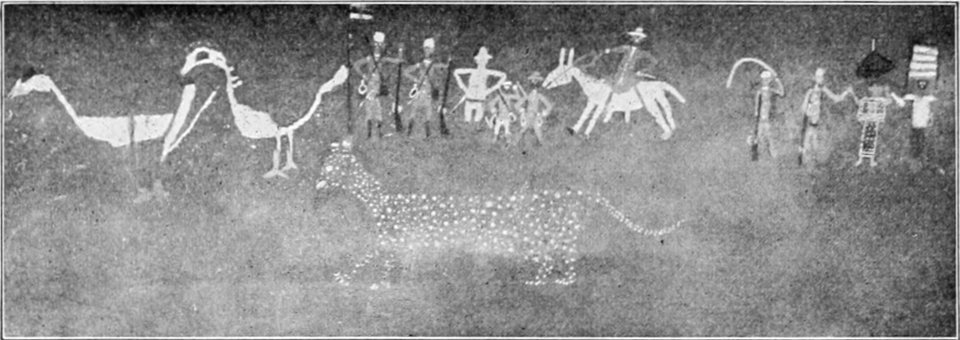
Newala, Anfang September 1906.
Ich lebe seit ein paar Tagen in einer andern Welt; ich bin dem Himmel nahe, denn ich sitze hier in einer Höhe von mehr als 700 Meter über dem Spiegel des Indischen Ozeans und schaue aus mehr als 500 Meter Höhe stolz auf das Graugrün der unendlichen Ebene im Westen hinab. Das heißt, dieser wundersame Anblick über jene Ebene zu meinen Füßen, über den Rovuma mit seinem breiten, gegenwärtig vom Wasser allerdings nur spärlich gefüllten Bett im Südwesten, auf die Bergkette von Massassi weit im Nordwesten, auf die zahllosen Inselberge in jeder Entfernung im Süden, Westen und Nordwesten, dieser Blick wird mir erst, wenn ich reuig wieder einen Kilometer westwärts von meinem jetzigen Ruhesitz schreite, da Newala nicht am jähen Steilrande des Plateaus liegt, sondern tausend Meter landeinwärts.
Und nun erst der klimatische Gegensatz, wenigstens gegen die Hölle Chingulungulu und das Fegefeuer Akundonde! Frisch ist’s hier wie auf dem Kamm des Thüringer Waldes, und eiligst haben wir Europäer nach unseren „Wintersachen“ gegriffen. Doppelte Decken des Nachts[S. 255] und eine warme Weste am Morgen und Abend genügen allein nicht; ich habe außerdem einen würdigen Überzieher aus vergangenen Semestern aus der Lade genommen, Nils, der Wikinger, aber wandelt in einem Überrock einher, von dem er behauptet, er sei erst vor reichlich einem Jahrzehnt von seinem Leibschneider in Treungen im fernen Nordland gefertigt worden; ich hingegen lebe der Überzeugung, daß diesmal zwar der edle Vasco da Gama unschuldig ist, daß aber einer von Nils’ wikingischen Ahnen vor tausend Jahren schon in diesem Gewande die nordischen Meere durchfurcht haben muß.

Doch bitte Schritt für Schritt! Zwischen unserem Abschied von Chingulungulu und unserem Einzug in die Boma von Newala liegen nur elf Tage, aber wieviel, oder richtiger wievielerlei haben mir diese anderthalb Wochen gebracht! Nie haben meine Träger vor lauter Lust und Ausgelassenheit so getobt und gelärmt, als zu jener Frühmorgenstunde, in der sie von der Untätigkeit bei Matola entbunden wurden. Stillsitzen ist nichts für Wanyamwesiträger; sie wollen laufen, wollen etwas Neues sehen; zu guter Letzt huldigen auch sie dem Grundsatz: „Andere Städtchen andere Mädchen“. Ich habe schließlich schwere Mühe gehabt, meine 24 rüstigen Kerle — die Rugaruga von Lindi habe ich schon in Massassi leichten Herzens entlassen — über[S. 256] die Gefahren dieses Kapua hinwegzubringen; sie wurden gewalttätig, vergriffen sich an Frauen und Mädchen und gaben auch zu sonstigen Klagen Veranlassung. Zur Ablenkung haben sie unsere Barasa mit den schönsten und längsten Tischen aus halbierten Bambusknüppeln ausstaffieren müssen; sie haben alle paar Tage uns beiden Weißen einen neuen Choo zu bauen gehabt, einen immer schöner und luxuriöser als den andern — nichts hat gefruchtet. Trotz ihrer Last von 60, 70 Pfund sind sie wie die jungen Kälber an jenem Morgen einhergesprungen, als wir dem Rovuma zuschritten.
Und wie freudig sind wir alle ausgeschritten! Im Handumdrehen liegt das schattenlose Pori von Chingulungulu hinter uns; eine scharfe Wendung des Weges aus seiner Westrichtung nach Süden, ein kurzer steiler Abstieg; wir stehen an den Fluten des Nasomba. Fluten ist etwas euphemistisch ausgedrückt, doch nach der wasserlosen, der schrecklichen Zeit kommt uns auch der dünne Wasserfaden, der dieses tiefe Tal durchzieht, wie ein schiffbarer Strom vor. Über abgeerntete, ausgedehnte Mais- und Hirsefelder, zwischen grünenden Bohnenbeeten und prachtvollen Tabakpflanzungen geht es vorwärts; hohe Termitenhügel künden alle Augenblicke, wie fruchtbar hier die Erde ist; auf hohen Pfählen angebrachte Wachthäuschen zeigen andererseits, daß Wildschwein und Affe, von hundert anderen Schädlingen zu schweigen, auch hier lüstern sind, der Segnungen menschlichen Fleißes teilhaftig zu werden. Längst ist Knudsen seiner Jagdleidenschaft gefolgt; von Zeit zu Zeit donnert eins seiner mehr oder minder ehrwürdigen Schießeisen über Hügel und Tal dahin. Ich habe inzwischen den fast gänzlich schilfverwachsenen Lichehesee passiert; nach der Karte muß ich demnach dicht am Rovuma sein. Auch die Vegetation kündet größeren Wasserreichtum an; wir kommen an Baobabs von gewaltigen Abmessungen vorüber; wir zwängen uns durch niedere Palmendickichte, und die Kronen stolzer Fächerpalmen rauschen zu unseren Häupten. Ich will gerade in ein neues Gebüsch eindringen, da reißt mich die nervige Faust Hemedi Marangas, meines neuen Gefreiten,[S. 257] zurück. „Mto hapa, Bwana,“ sagt er dabei, „hier ist der Fluß, Herr.“ Ein Schritt noch, und ich wäre die wohl 5 bis 6 Meter hohe, steile Uferwand hinuntergestürzt, an deren Fuß ich erst jetzt jene breite Wasserfläche erglänzen sehe, von deren Reizen mir Nils Knudsen hundertmal erzählt hat, ja, die selbst auf nüchternere Gemüter, wie das Ewerbecks, ihren Eindruck nicht verfehlt haben. „Hapana“ ist in meinen Ohren das schrecklichste Wort, ein Ausdruck, der mich allmählich nervös macht; das sonore „Hapa“ des Gefreiten habe ich damals gesegnet.

Was soll ich singen und sagen von jenen fünf oder sechs glücklichen Tagen an den Ufern und auf den Inseln dieses durch Livingstone[S. 258] geheiligten Stromes. Für den Ethnographen ist dort zurzeit wenig zu holen. Vor 40 Jahren noch, als Livingstone stromaufwärts zog, war es anders, da waren die Ufer des Rovuma dicht besetzt mit Ansiedelungen der Wamatambwe; die Fluten des Stromes trugen tausend Einbäume jenes rührigen Fischervolkes, und ein reges, fröhliches Leben herrschte überall. Doch wie ein Reif in der Frühlingsnacht sind auch hierher die Wangoni gekommen; von dem einst so stolzen, zahlreichen Stamm der Wamatambwe sind heute nur noch ganz spärliche Reste übrig geblieben, die sich regellos über die ungeheure Länge des Rovuma verteilen oder aber in den anderen Völkerschaften der Makua, Yao und Makonde aufgegangen sind. Der Reisende muß schon, wie ich das so gewohnt bin, Glück haben, um ein paar Angehörige dieses verlorenen Volkes zu Gesicht zu bekommen.
Wir haben unser erstes Lager hart am Strombett aufgeschlagen, ich, wie immer, am weitesten gegen den Wind unmittelbar am Wasser, daneben Knudsens Zelt; die Träger müssen weiter leewärts im Schutz einer überhängenden Uferwand unterkriechen. Derartige Wände sind hier allgemein; während und nach der Regenzeit schüttet der Strom, der dann in majestätischer Breite ungeheure Wassermassen dem Ozean zuwälzt, seine Alluvialebene immer höher auf; in der späteren Trockenzeit, wie gerade jetzt, liegt dagegen das 1 bis 1½ Kilometer breite Bett fast ganz trocken; wo sonst die gelben Fluten rauschen, dehnen sich jetzt unabsehbare Sand- und Kiesbänke. Zwischen ihnen irrt der Rovuma in der Trockenzeit unsicher hin und her, hier und da in einem geschlossenen Bett, das etwa so breit ist wie das der Elbe bei Dresden, meist aber in zwei, drei Arme aufgeteilt, die man bequem durchwaten kann. Doch trotz seiner Ohnmacht hegt der Fluß Angriffsgelüste; in starker Kurve schießt er auf die nächste Uferstelle zu; unheimlich brodeln und quirlen seine sonst so klaren Gewässer; stolze Bäume spiegeln ihre Wipfel am stillen Uferrand in diesem Wasser; doch wie lange noch? Dann kommt ein Tag, wo das Fleckchen Erde, das sie so lange verziert und verschönt haben, einem Bild der[S. 259] Verwüstung Platz gemacht hat: die stolzen Bäume sind gestürzt; die Wurzelenden hoch in der Luft, tauchen sie mit ihren Kronen tief in den Strom hinein. Der aber, ein gefräßiger Nimmersatt, gräbt weiter und weiter.
Es ist am späten Nachmittag; in einem ziemlich großen, enggeschlossenen Kreise stehen ein Dutzend Neger an einer flachen Stelle mitten im Bett des Rovuma; aufmerksam, fast ängstlich spähen sie umher, den Blick starr aufs Wasser gerichtet, als wollten sie es bis zum Boden des Stromes durchdringen. Was ist der Männer Beginnen? Hat etwa der weiße Herr kostbare Schätze verloren, die er durch seine Mannen suchen läßt? Des Rätsels Lösung ist weit einfacher. Schaut in den Kreis hinein: zwei Tropenhüte schwimmen auf dem Wasser; wenn sie sich über dessen glänzende Fläche einmal emporheben, seht ihr zwei Blaßgesichter, den beiden Wasungu Knudsen und Weule zugehörig, die voll Entzücken, dem ewigen Bad in der engen Gummiwanne mit ihrem halben Eimer Wasser enthoben zu sein, ihre schlanken Glieder in den belebenden Fluten des Stromes kühlen. Und die schwarzen Männer? Der Rovuma steht nicht umsonst in dem Rufe, einer der krokodilreichsten Ströme Ostafrikas zu sein; da ist es immer gut, eine kleine Postenkette aufzustellen; zudem ist es recht drollig, die ängstlichen Gesichter der schwarzen Helden zu bewundern, trotzdem das Wasser auf weite Entfernung hin kaum knietief ist.
Und es will Abend werden; ein steifer Westwind hat eingesetzt, der das breite Bett des Stromes mit ungehinderter Heftigkeit hinauffegt; selbst die magere Wasserader des Rovuma versucht einige kümmerliche Wellen zu werfen. Froh des ungewohnten Anblicks schweift das Auge flußabwärts; Totenstille ringsum, nichts von dem alten, frohen Wamatambwe-Leben der 1860er Jahre. Doch, was ist das? Fern in der letzten Strombiegung ein schwarzer Punkt, der rasch größer wird; unsere Schwarzen mit ihren Luchsaugen haben das Phänomen längst erspäht und starren wie wir beiden Europäer in gleicher[S. 260] Richtung. „Mtumbwi, ein Einbaum“, ertönt es wie aus einem Munde, als der Punkt sich bei einer Biegung des Fahrwassers zu einer schwarzen Linie entwickelt. Nach einer Viertelstunde ist das Boot heran, ein Einbaum einfachster Form, mit traurigem Inhalt: mehr tot schon als lebendig kauert in seinem Hintergrunde ein altes Weib. Mich dauert die Ärmste; ein Wink; ein älterer und ein jüngerer Mann springen gewandt ans Ufer. Ein paar Fragen. „Die ist sehr krank, die Bibi,“ heißt es, „sie wird wohl noch heute sterben.“ Ich sehe selbst, hier ist menschliche Hilfe zwecklos. Schon stehen die beiden Männer wieder an ihrem Paddelruder; nach zehn Minuten sieht man sie schräg oben am anderen Ufer anlegen; sie tragen ein unförmiges Bündel über die Sandbank weg in den Busch — ein Menschenschicksal hat sich erfüllt.
Nils Knudsen hatte mir in seiner gewohnten Weise wieder wahre Wunderdinge von dem Lagerplatz Naunge weiter oberhalb am Rovuma erzählt; „da müssen wir unbedingt hin, Herr Professor,“ hatte er wieder und wieder gesagt; „dort ist es zu schön“. So ganz unrecht hatte Nils diesmal nicht; der Platz mit seinem wilden Felsengewirr am und im Strom, die kleinen Katarakte zwischen den moosbewachsenen Steinen, das dunkle Grün der dichten Ufervegetation, alles das war in der Tat verlockend genug. Doch wie sah es dafür am Boden selbst aus! Zertreten die Grasnarbe, die Büsche zerzaust, dazu der unverkennbare Duft negroider Fäkalien überall. Danke, sagte ich, als ich hier, genau auf den Spuren des schottischen Missionars, stromaufwärts zog; Safari, vorwärts! Schon hundert oder ein paar hundert Meter vom Stromufer ab beginnt das lichte Pori. So bin ich mit einem viertel Dutzend meiner Askari gleichsam als linke Seitendeckung durch die Ufervegetation selbst stromaufwärts marschiert, unter unsäglichen Anstrengungen, aber doch froh des frischen Naturbildes, des Stromes mit seiner ewig wechselnden Szenerie. Endlich habe ich, was ich suche: mitten im Strombett, wohl 600 bis 700 Meter von uns ab, erhebt sich, steil und scharf wie der Bug eines Kriegsschiffes, eine[S. 261] Strominsel; mit den roten Wänden leuchtet sie weit über das Silbergrau der Sandbänke hinweg, oben aber ist sie von einer kompakten Masse saftigen Grüns überwuchert. Ein gellender Pfiff durch das Pori zu meiner Karawane hinüber, ein kecker Sprung in die Tiefe, und schon wate ich im tiefen Sande direkt auf jenes Eiland zu.
Das Idyll, das ich für einige Tage als Einsiedler auf dieser wohl 8 Meter hoch senkrecht aufsteigenden Rovuma-Insel genossen habe, wird mir zeitlebens unvergeßlich bleiben. Nils Knudsen ewig auf der Jagd, von der er stets mit saftigem Braten heimkehrt; unsere Leute infolgedessen in bester Stimmung, dabei weitab unter dem Winde; unsere Zelte tief unten in einer schmalen Sandschlucht am Fuß der Insel: ich selbst schließlich wie in einer grünen Laube einsam oben, erreichbar nur nach dem streng vorgeschriebenen Anruf „Hodi Bwana“. Nur meine Leibdienerschaft darf mir unangemeldet bringen, was Omari, der jetzt einige Gerichte passabel zu kochen weiß, Schönes und Gutes für seinen der Pflege bedürftigen Herrn hergerichtet hat. Es war herrlich!
Herrlich war auch unsere letzte Station am Rovuma. Es war die Einmündungsstelle des Bangala, jenes größten linken Nebenflusses unseres Grenzstromes, der sich auf der Karte so stattlich ausnimmt, der aber jetzt zur Trockenzeit gleichwohl nur ein Wadi war; man hätte mehrere Meter tief graben müssen, um zu seinem unterirdisch fließenden Wasser zu gelangen. Wir haben es gar nicht nötig gehabt, wir lebten und webten dort im klaren Wasser des Rovuma selbst, vor allem meine Leute, die ein geradezu amphibisches Leben führten. Wie rein und sauber schritten sie einher, seitdem sie wieder die tägliche Möglichkeit des Waschens und Badens vor sich sahen. „Msuri we! bist du schön!“ sage ich im Vorbeigehen anerkennend zu Chafu koga, dem Dreckschwein; so etwa nämlich läßt sich sein Name übersetzen. Das selbstgefällige Schmunzeln auf dem Bronzegesicht des Edlen war allein eine Reise nach Afrika wert!
Nur eins kann den Aufenthalt am Rovuma etwas verleiden; es ist der furchtbare Nachtwind, der gegen Sonnenuntergang anhebt, sich[S. 262] dann von Stunde zu Stunde bis fast zur Stärke eines Orkans steigert, um gegen Mitternacht abzuflauen. Gegen ihn hilft keine Schutzwand und kein Verkriechen hinterm Zelt; kein Windschützer rettet die Lampe vor dem Verlöschen; unweigerlich müssen Herr und Diener um acht Uhr ins Bett.
Und dann die kitzligen Nachtbesuche. Zwar die der Elefanten mögen noch hingehen; die Tiere sind hier sehr zahlreich, aber doch auch sehr scheu, sie umgehen das Lager in weitem Bogen. Nicht so der Löwe; er scheint es zu lieben, beim bleichen Mondeslicht zwischen meinen Leuten spazieren zu gehen. Am Bangala war er die Reihe meiner schnarchenden Leute entlang gewandelt und war schließlich, wie der Posten, der mit fertig gemachtem Gewehr in einiger Entfernung davon gestanden hatte, mit boshaftem Grinsen erzählte, zu Häupten meines Kochs Omari stehengeblieben. „Soll ich ihn fressen oder nicht?“ schien der König der Tiere bei sich zu überlegen. Lange stand er so; dann ein tiefes, verdrießliches Knurren, als wenn er sagen wollte: „Nee, du Kerl, du bist zu unappetitlich“, und langsam war er in den Wald getrottet.
Luisenfelde — ich weiß nicht, nach welcher Luise du genannt worden bist, aber ich werde deiner lange gedenken als eines Kulturgrußes inmitten des echtesten afrikanischen Pori. Schon der Name Bergbaufeld klingt so unternehmend und dabei doch anheimelnd. Zwar warst du mit deinen Granaten zu einem nur kurzen Dasein verurteilt, trotzdem der glückhafte Herr Vohsen, dein vormaliger Besitzer, den leuchtend roten Stein stolz Kaprubin benannte. Granaten sind zu billig, sie wachsen auch zu vielerorts. So ist nach kurzer Frist der Bedarf gedeckt gewesen, wie es der technische Ausdruck so schön besagt; Herr Marquardt, der konquistadorenhafte Leiter des Bergbaufeldes, zog heim, und Nils Knudsen, der Mann für alles, saß vergessen im Busch. Tatsächlich im Busch, denn das stolze Haus mit seinem Doppeldach — unter dem äußeren, schweren Strohdach liegt noch ein anderes aus Wellblech — blieb dem Norweger fortan[S. 263] verschlossen; er mochte in einem der beiden Wirtschaftsgebäude sein Unterkommen finden. Jetzt haben wir in Erinnerung geschwelgt; wir haben auf unserm Marsch vom Rovuma nordwärts eigens einen viertel Tag haltgemacht, um unser sonntägiges Mittagessen unter der Veranda des Herrenhauses einzunehmen. Ein doppeltes Memento liegt dort vor uns: mitten in dem langen, weiten Hofraum ein großer Haufen jener Kaprubine, für die der Markt nicht mehr aufnahmefähig war, und mit denen jetzt die Hand des jungen Negerkindes wie mit gewöhnlichen Murmeln spielt; im Vordergrunde aber das Grab von Marquardts einzigem Töchterlein. Dreijährig, zu den besten Hoffnungen berechtigend, ist es mit Vater und Mutter hier in die Einöde gekommen; nach nur stundenlanger Krankheit hat es im Sande der Rovuma-Ebene sein frühes Grab gefunden. Wir Europäer sind nüchtern und hart und glauben nicht an Vorbedeutungen, dem Neger war der jähe Tod der Kleinen schon längst vor seinem Eintritt kein Geheimnis mehr.

„‚Herr, hier wird einer sterben.‘ Mit diesen Worten,“ so erzählt Knudsen, „tritt eines Tages einer der schwarzen Arbeiter aus den Granatgruben an mich heran. ‚Dummes Zeug‘, sage ich und jage den Burschen weg. Am nächsten Tage kommt er wieder: ‚Herr, hier wird[S. 264] einer sterben.‘ Wieder jage ich den Mann weg, aber trotzdem kommt er wieder. Nacht für Nacht sitzt eine Eule auf Marquardts Haus und schreit. Das geht eine Woche so fort und auch noch eine zweite; dann erkrankt plötzlich Marquardts Töchterchen, und wenige Stunden darauf ist es tot. Da ist der Vogel nicht wiedergekommen; sein Name aber ist Liquiqui.“
Die eine Geschichte löst andere aus; Matola hat uns beim trauten Schein der Abendlampe so manche erzählt. Hier ein paar von ihnen.
„Zwischen hier,“ so berichtete Matola in Chingulungulu, „und dem Nyassa liegt ein hoher Berg, Mlila mit Namen; an dem führt der Weg vorbei. Und am Wege stehen zwei Beile und eine Schaufel; und wer es versucht, sie wegzutragen, der bringt es nicht fertig. Lädt er sie auf seine Schulter, so erfaßt ihn alsbald das Gefühl, sie nicht mehr zu haben; er dreht sich um und sieht, wie Beile und Schaufel wieder auf ihren Platz gehen. Eigentümer der Beile und der Schaufel aber ist Nakale.“
Die andere Geschichte lautet folgendermaßen: „Beim alten Wayaohäuptling Mtarika hat man ein großes Wunder gesehen: Usanyekörner, die roten Früchte dieser Hirseart, weinten in dem Korbe, in dem sie standen. Und das kam so. Sie (die Leute) hatten die Usanye in der Schambe abgehackt und in den Korb gelegt. Und beim Zusammenpressen fingen die Körner an zu schreien und zu weinen, und sie jammerten im Korbe. Aber die Leute wußten nicht, woher das Geschrei kam, und warfen die Usanyekörner aus dem Korbe heraus, um in und unter dem Korbe nachzusehen. Aber sie fanden nichts; auch hörten sie jetzt nichts. Darauf taten sie die Körner wieder in den Korb; da ertönte das Geschrei von neuem. Und alles Volk lief erschreckt weg und holte Leute. Auch diese sahen nach, fanden aber auch nichts. Und alle gingen höchst erstaunt von dannen. Als sie aber heimkamen, siehe, da tanzte der Mörser; auch die großen Mbale, die großen Tonschalen, tanzten; und Yongōlo, der Tausendfuß, baute sich Häuser. Am nächsten[S. 265] Morgen liefen sie alle zusammen, um sich zu befragen, was das alles bedeuten solle. Und drei Tage danach starb Mtarika. Das war die Bedeutung.“


Wir haben Luisenfelde nur zum Teil aus Pietät berührt: hauptsächlich ist der Umstand, daß der Weg von der Bangalamündung nach Akundonde gerade hier vorbeiführt, die Ursache unseres Besuchs gewesen. Akundonde ist dann nicht mehr weit; ein anderthalb- bis zweistündiger Marsch im tiefeingeschnittenen Bett des Namaputa aufwärts, ein kurzer, steiler Aufstieg auf die Höhe der nächsten Hügelwelle, und wir stehen vor der typischen Negeransiedelung dieser Länder: einem mäßig großen, sorgfältig gesäuberten Platz mit dem Pfeilerbau der Barasa in der Mitte; um ihn herum ein halbes Dutzend Hütten im Rund- oder Viereckstil, alle mit schwerem, weitausladendem und bis fast zur Erde reichendem Strohdach; auf dem Kamm des Hügels entlang in weiten Abständen eine Reihe anderer Gehöfte. Akundonde behauptet, unseren Besuch erwartet zu haben; trotzdem ist er nur wenig entgegenkommend und zugänglich; ein Kater nach der Libation von neulich wird kaum die Ursache sein, denn dazu ist die Kehle des alten Sünders zu ausgepicht; näher liegt es schon, an sein wehes Bein zu denken. Ich habe gerade eine Flasche echten „alten“ Jumbenkognaks zur Verfügung, jenes berühmten Getränks, das wie Rosenöl duftet, dessen Geschmack ich aber nicht zu schildern vermag; ich spendiere sie dem alten Häuptling, lasse ihn aber sonst links liegen. Dies kann ich ohne Gefahr für das Gelingen meiner Expedition wagen, denn der junge Jumbe des Dorfes, ein fixer, nach landläufigen Begriffen stutzerhaft gekleideter Yao, an dessen Weste sogar[S. 266] eine dicke Uhrkette baumelt und der den dazugehörigen Zeitmesser alle zwei Minuten demonstrativ zückt, ist ein viel brauchbarerer Führer durch das Volkstum dieses entlegenen Bezirks als der griesgrämige alte Akundonde. Was hat uns der junge Mensch allein an autochthonen Kunstwerken vorgeführt! Wir brauchten bloß von Haus zu Haus zu wandern, um unter den verschwiegenen Dachtraufen alle Wände mit den schönsten Fresken bedeckt zu finden. Auch einen kleinen Friedhof konnte der Führer uns zeigen; ein paar Yaogräber, über denen ich nun zum ersten Male das niedrige Hüttendach mit den darauf befestigten Stoffen erschauen konnte. Fast stimmungsvoll nahmen sich in der kurzen Abenddämmerung diese schon halb verfallenen Zeichen der Pietät auch im barbarischen Afrika aus.
Bei Akundonde findet dieses Jahr Unyago statt. Dies wußten wir, und daher setzten wir alles daran, möglichst alles zu erfahren und alles zu sehen. Das Versprechen eines fürstlichen Honorars hat denn auch alsbald seine Schuldigkeit getan; nur meine Träger und Soldaten dürften nicht mit, meint der Jumbe, Moritz und Kibwana sei aber der Zutritt gestattet. Meine beiden Mohrenknaben haben das Feldleben schon herzlich satt, deswegen bedarf es erst einer kleinen Auffrischung ihres Diensteifers; dann aber trotten sie, wenn auch widerwillig, mit der Kamera hinter uns her.
Mit merkbarer Heimlichkeit hat der Jumbe uns zwei Weiße und die beiden Diener aus dem Bereich des Dorfes hinausgeführt; immer tiefer geht es in das schweigende Pori hinein, das hier mit seinen stattlichen Bäumen fast an einen deutschen Hochwald gemahnt; selbst das Grün ist hier frischer und allgemeiner, als es jenseits Chingulungulu zu finden gewesen war. In der erklärlichen Spannung des Forschers, der vor etwas Neuem, Ungeahntem steht, achte ich weder auf Ort noch Zeit; wir mögen eine halbe, aber auch eine ganze Stunde fürbaß geschritten sein; endlich brechen wir durch ein Gebüsch; wir stehen vor einer kleinen Hütte; wir sind am Ziel.
[S. 267]

Das Ziel ist des Erstrebens wohl wert gewesen. Bevor ich noch Größe, Bauart und Stil des länglichen Gebäudes habe mustern können, sind wir bereits von einer Schar halbwüchsiger Knaben umringt. Mit lautem Zuruf und energischer Handbewegung treibt der Jumbe sie zurück; ein älterer Mann tritt jetzt heran; er muß aus der Hütte selbst gekommen sein, denn er steht wie aus dem Boden gewachsen plötzlich da. Feierliche Begrüßung seitens des Wamidjira, denn diesen Oberleiter des ganzen Knaben-Unyago haben wir in der Person dieses würdigen Mannes vor uns: sodann ein leiser Wink mit seinen Augen zu den Knaben hin. Die stehen bereits in einer langen Reihe ausgerichtet, wundersam anzuschauen mit ihren großen Grasschürzen, die die schmächtigen Körper gleichsam wie die von Überballetteusen erscheinen lassen; am Munde jeder ein röhrenförmiges Instrument, dem sie nunmehr ihre Begrüßungsmusik entlocken. Auch jetzt wieder muß ich tief bedauern, so wenig musikalisch zu sein, denn das Spiel ist etwas Einzigartiges. Ich lasse die nicht unschöne[S. 268] Melodie zu Ende gehen; dann trete ich näher heran, um die Kapelle genauer zu besichtigen. Jedes der Instrumente ist lediglich ein Stück Bambusrohr, alle an Länge und Weite verschieden, alle aber unten mit dem natürlichen Internodium verschlossen und oben glatt abgeschnitten. Dergestalt verfügt jeder der kleinen Musikanten nur über einen Ton, doch das ist sein Ton, und den weiß ein jeder von ihnen so präzis und fehlerlos in das „Lied ohne Worte“ einzufügen, daß ein vollkommen harmonisches Ganzes entsteht. Moritz hat inzwischen seines Amtes als Finanzminister gewaltet; einzelne der Knaben haben es sogar über sich vermocht, mir hinter der Hütte die Wirkungen des chirurgischen Eingriffs, der bereits um einen Monat zurückliegt, bei dem einen oder anderen aber noch immer Eiterungen verursacht, zu zeigen. Doch jetzt treibt es mich in die Hütte selbst.
Luxus ist ein Begriff, dessen sich der Europäer in Afrika sehr bald auch für seine Person entwöhnt, den er bei den Eingeborenen aber gar nicht erst suchen darf; wie primitiv und anspruchslos jedoch diese für Monate berechnete Behausung der 15 Knaben ist, spottet jeder Beschreibung. Die Daggara, wie die Beschneidungshütte offiziell genannt wird, ist ein Bau von zirka 10 Meter Länge bei 4 Meter Breite, also ein an sich ganz stattliches Bauwerk; doch Schutz gegen die Unbilden der Nacht vermögen weder die aus krummen, ästigen Baumstämmen gebildeten Seitenwände, durch deren Lücken der Wind ungehindert hindurchpfeift, noch auch das ebenso luftige, schlecht gehaltene Strohdach zu gewähren. Türöffnungen sind zwar da, in der Mitte jeder Längswand eine, doch fehlt ihnen der Verschluß. Tritt man ins Innere selbst, so blickt das Auge zunächst nur auf ein Meer von Hirsestroh; es liegt auf dem Boden, mit Aschebergen durchmischt; es ragt an den Wänden empor; es breitet sich schließlich in unordentlicher Lagerung über 16 ursprünglich vielleicht ganz saubere Betten und Bettchen. Eins von diesen ist das Ruhelager des Meisters, die 15 anderen sind die Schmerzenslager seiner Jünger; auf ihnen haben die Ärmsten die schmerzhafte Operation[S. 269] ohne Narkose, ohne lokale Anästhesie, ohne Antisepsis und ohne Asepsis über sich ergehen lassen müssen, mit zusammengebissenen Zähnen und ohne einen Schmerzenslaut von sich zu geben. Dieser ist bei den tapferen Yao, diesen Spartanern des Ostens, verpönt. Übermannt den immer noch kindlich empfindenden, kleinen Mann trotz allen Heldenmuts der Schmerz, was ist die Folge? Er wird überbrüllt vom homerischen Gelächter der Anamungwi, seines Mentors, und seiner Gefährten.

Heute sind die 15 Betten schon arg mitgenommen; ein Teil von ihnen ist vollkommen niedergebrochen, auf anderen finden sich nur noch kümmerliche Reste des alten, sauberen Strohbelags; wir durch die Ordnungsliebe der deutschen Hausfrau verwöhnten Angehörigen einer hohen Kultur sehen mit einem Blick, daß hier das ordnende Walten der weiblichen Hand gänzlich fehlt. Dafür sprechen auch die großen[S. 270] Aschehaufen zwischen je zwei Betten; sie sind der Beweis, daß jeder der kleinen Patienten sich gegen die empfindliche Kühle der Tropennacht durch ein sorgsam unterhaltenes Feuer zu schützen sucht; dafür spricht auch vor allem die unmeßbar dicke Dreck-, Staub- und Aschenschicht, mit denen jeder der kleinen Kerle vom Scheitel bis zur Sohle überzogen ist. Das große gemeinsame Bad, das den Aufenthalt in der Daggara und damit auch die Novizenzeit der angehenden Männer beendigt, ist denn auch ein nicht nur langentbehrter Genuß, sondern direkt eine Notwendigkeit.
Doch was ziert die Mitte des Hauses? Ist es ein ins Afrikanische übersetzter Weihnachtsbaum mit seiner buntgefärbten Epidermis und seinem Behang von Fellstreifen, Tierschwänzen und Vogelbälgen, oder was stellt dieses merkwürdige Phantom sonst dar? Die Lupanda ist es, wie ich vom Meister vernehme, der Baumast, nach dem das ganze Mannbarkeitsfest der Knaben seinen Namen führt; Unyago ist die Bezeichnung für die Pubertätsfeste schlechthin, Lupanda der Name für die Knabenbeschneidung. Näheres kann oder, wohl richtiger, will mir der Alte nicht sagen; ich muß also sehen, einen anderen Gewährsmann für diese und so viele andere Fragen zu bekommen, insbesondere auch für das Mädchen-Unyago, das nach alledem, was ich raunen höre, zum mindesten ebenso interessant sein muß wie die Lupanda.

So habe ich an jenem Spätnachmittage im Pori westlich von Akundonde gedacht, ohne zu ahnen, daß kaum einen Tag später bereits ein Teil meines letztgeäußerten Wunsches in schönster Weise in Erfüllung gehen sollte. Hastig kommt der durch sein Honorar begeisterte Jumbe kurz nach dem Mittagessen zu Knudsen und mir in unser Lager. Dieses haben wir, mehr idyllisch als vor dem Abendwinde geschützt, auf dem höchsten Punkte des Hügels am Waldesrand aufgeschlagen; Knudsen hat wie immer für das Beziehen der Barasa plädiert, aber unser alter Feind, die Windhose, die uns selbstverständlich auch hier wieder gerade bei der Erbsensuppe überraschte, hat ihn sehr bald eines Besseren belehrt. Jetzt dämmern wir im Halbschlaf unter der Banda,[S. 271] jener Laube aus Zweigen und Gras, die jeder Trägerführer mit seinen Leuten im Nu zu errichten versteht, pressen uns aus Gewohnheit wegen der glühenden Hitze den schmerzenden Kopf und denken an nichts, die unfraglich beste Beschäftigung in diesen Breiten. Da trabt der Jumbe heran; in Akuchikomu sei Echiputu, ruft er schon von ferne, der Bwana kubwa und der Bwana mdogo könnten viel sehen, wenn sie hingingen; aber die Weiber seien scheu und furchtsam, und die Träger und Soldaten dürften deswegen auch jetzt nicht mit. Wenige Minuten später sind wir bereits auf dem Marsch; Moritz und Kibwana haben diesmal arg zu schleppen, denn zur großen Kamera habe ich auch noch den Kinematographen gesellt, der ach so lange schon zur Untätigkeit verdammt gewesen ist und von dem ich mir manches verspreche. Zudem ist der Weg noch länger als gestern; er führt erst nach Nordosten, immer den Hügelkamm entlang, biegt dann nach Westen[S. 272] ab und steigt in das grüne Tal eines munteren Baches nieder. Schon ehe wir dieses erreichen, gibt es Aufenthalt: ein ungeheurer Hüttenring sperrt uns den Pfad; Bauten allerprimitivster Art sind es; ein paar Stangen senkrecht und schräg in die Erde gerammt, darüber eine Querstange, das Ganze bedeckt mit dem 2 bis 3 Meter langen afrikanischen Stroh; das ist alles. Aber Hütte reiht sich an Hütte, in fast mathematisch genauer Kreislinie umzirken sie eine Fläche von wohl über 50 Meter Durchmesser. Dies ist der eigentliche Festplatz, doch nicht für die Mädchen, sondern für das Lupanda; hier beginnt der lange Festturnus der Knabenbeschneidung mit Tanz, Schmaus und Gelage, und hier findet auch, wenn die Knaben nach 3 oder 4 Monaten geheilt und in die Mysterien des Geschlechtslebens und den Sittenkodex des Stammes eingeweiht zurückkehren, das Schlußfest statt. Also schnell heraus mit Stativ, Kamera und Platte; vom Anfänger in der Lichtbildkunst bin ich längst ein Fundi, ein Meister, geworden, der im Handumdrehen seine 20, 30 Aufnahmen bewältigt; ein Blick noch auf die zwei kleinen Aschenhügel an bestimmten Stellen des Platzes, dann geht es auch schon weiter.
Es ist 2 Uhr mittags; die noch immer unangenehm hochstehende Sonne sendet ihre glühendsten Strahlen auf den freien Platz des elenden kleinen Makuadorfes hernieder, in das wir soeben eingetreten sind. Dorf ist schon viel zu viel gesagt, kaum den Namen Weiler verdienen die paar kläglichen Strohhütten, deren wenige Bewohner sich erkühnt haben, die ganze Umgegend zu Gaste zu laden. In der Tat ist viel Volks versammelt, vor allem Frauen und Mädchen; die Männer treten an Zahl sichtlich zurück. Schon daraus würde man entnehmen können, daß es sich um die Feier eines ausgesprochenen Frauenfestes handelt.
Kein Fest ohne den schmückenden Rahmen. Und was für einer ist es, der sich unserem erstaunten Auge darbietet! Ganz afrikanisch, nicht übergroß, aber vollkommen ausreichend ist der Festsaal, den die Gastgeber hier errichtet haben. Die Neger verstehen es meisterhaft, aus[S. 273] den billigsten Materialien, mit den einfachsten Hilfsmitteln in der größten Schnelligkeit zweckentsprechende und auch in Stil und Form ganz ansprechende Bauten herzustellen. Dieser hier ist kreisrund; die peripherische, aus Holzstangen und Hirsestroh gefertigte Wand ist etwa 2 Meter hoch, mit zwei einander gegenüberliegenden Türöffnungen; der Durchmesser beträgt etwa 10 Meter, das Dach wird von einem Mittelpfeiler getragen. Gerade jetzt ziehen die Weiber feierlich in den Festraum ein, aus dem bereits das bekannte Stimmen mehrerer Trommeln dröhnend und polternd ertönt. Der Hinweis des Jumben auf die Scheu der hiesigen Frauen ist sichtlich gerechtfertigt; wer von den Weibern uns sieht, nimmt schnell Reißaus. Erst nachdem es uns Fremden gelungen ist, uns ungesehen an die Außenwand des Festsaals heranzuschlängeln und dort inmitten eines dichten Haufens verständiger Männer einen sehr erwünschten Unterschlupf zu finden, beruhigen sich die Festteilnehmerinnen. Aber zeichnen läßt sich gleichwohl auch jetzt noch keine von ihnen. Ich habe die Gewohnheit, wo immer es geht, mit einigen wenigen raschen Strichen jedes malerische Motiv zu skizzieren; und wie malerisch sind gerade diese Motive! Lippenscheiben, Nasen- und Ohrpflöcke sind mir seit meinem Einmarsch über die Küstenzone hinaus ins Innere etwas Altes und Vertrautes geworden, doch Exemplare von solcher Größe und Rassentypen von so ausgesprochener Wildheit und Unberührtheit zu bewundern, habe ich bislang doch noch keine Gelegenheit gehabt. Und wenn so ein Frauenzimmerchen gar erst lacht! Das ist einfach unbeschreiblich; solange das Gesicht den normalen, ernsten Ausdruck bewahrt, steht die schneeweiß gefärbte Lippenscheibe ebenso ernsthaft horizontal in die Weite, notabene wenn ihre Trägerin noch jung und schön ist; verzieht sich aber dieses selbe Gesicht zu dem kurzen kichernden Auflachen, wie es nur der jungen Negerin eigen ist, wupp! mit einem kurzen, schnellen Ruck fliegt das Pelele nach oben, es richtet sich steil auf über dem elfenbeinweißen, noch völlig intakten Gebiß; strahlend schauen auch die hübschen braunen Augen des jungen Weibes in die Weite; unter dem[S. 274] Gewicht des schweren Holzpflocks gerät die um fast Handbreite vorgezerrte Oberlippe in ein rasches Zittern; das Baby auf dem Rücken des Weibes — sie haben fast alle ein Baby auf dem Rücken — fängt unter dem forschenden Blick des fremden Mannes jämmerlich zu weinen an — kurz, es ist ein Anblick, den man erlebt haben muß; zu schildern vermag ihn keine Feder.
Unser Platz ist gut gewählt, ungehindert können wir das ganze Hütteninnere überschauen. Die menschliche Psyche ähnelt sich überall, ob unter dem 10. oder 11. Grade südlicher Breite, oder aber in den Schneewüsten Sibiriens oder den Bankettsälen europäischer Festhallen: überall huldigt sie dem Grundsatz: Ehre, wem Ehre gebührt.
„Was sind das dort für drei Knirpse?“ frage ich den Jumben, der dienstbeflissen neben mir steht und mit zufriedenem Verständnis den Vorgängen im Innern folgt. Drei angehende Jünglinge sind es, die an einer reservierten Stelle des Saales auf Ehrenschemeln sitzen. Das sind die Ehemänner der Frauen, deren Echiputu heute gefeiert wird.
„Und Echiputu, was ist das?“ Das ist das Fest der ersten Menses; doch es ist eine lange Geschichte. Diese lange Geschichte jetzt zu verfolgen ist indessen keine Zeit; in dem bewußten, jedem Besucher Ostafrikas unvergeßlichen Takt, der bei allen Ngomen wiederkehrt, haben die Trommeln eingesetzt; im gleichen Augenblick hat sich der dichtgeballte Knäuel der schwarzen Leiber auch schon zu einem Reigen geordnet. In einer Art Bachstelzenschritt bewegt er sich rhythmisch wiegend und gleitend um den Mittelpfahl. Doch dieser ist nicht frei, sondern lieblich grinsend umstehen ihn drei alte Hexen.
„Wer ist das?“ frage ich.
„Das sind die Anamungwi, die Lehrerinnen der drei Mädchen, die heute den Lohn ihrer Arbeit ernten; sieh Herr, was jetzt passiert.“ Einstweilen passiert noch nichts; der Tanz geht weiter und weiter, zunächst noch in der alten Art, dann in einer neuen. Diese ist weniger afrikanisch als allgemein orientalisch, es ist der gewöhnliche sogenannte Bauchtanz. Endlich geht auch er zu Ende; der Reigen löst sich[S. 275] wieder zu einem wilden Durcheinander auf; die eine greift hierhin, die andere dorthin, dann sammelt sich alles wieder um die Anamungwi. Diese lächeln jetzt nicht mehr, sondern sehen recht hoheitsvoll drein; und sie haben ein Recht dazu. Eine nach der anderen überreichen ihnen die Frauen ihre Gaben: Stücke neuen Zeuges, Perlenschnüre, fertige Hals- und Armbänder aus Perlen und dergleichen. „Das ist alles recht gut und schön,“ scheint der Blick der Beschenkten zu sagen, „doch ist das etwa ein Äquivalent für die unsägliche Mühe, die uns die Heranbildung unserer Amāli, unseres Zöglings, seit Jahren gemacht hat? Da müßtet ihr uns schon ganz anders kommen.“ Doch die Festgesellschaft läßt sich durch diese stumme Kritik nicht im mindesten beirren, ganz wie anderswo in der Welt plappert alles durcheinander, und alles ist eitel Lust und Freude.
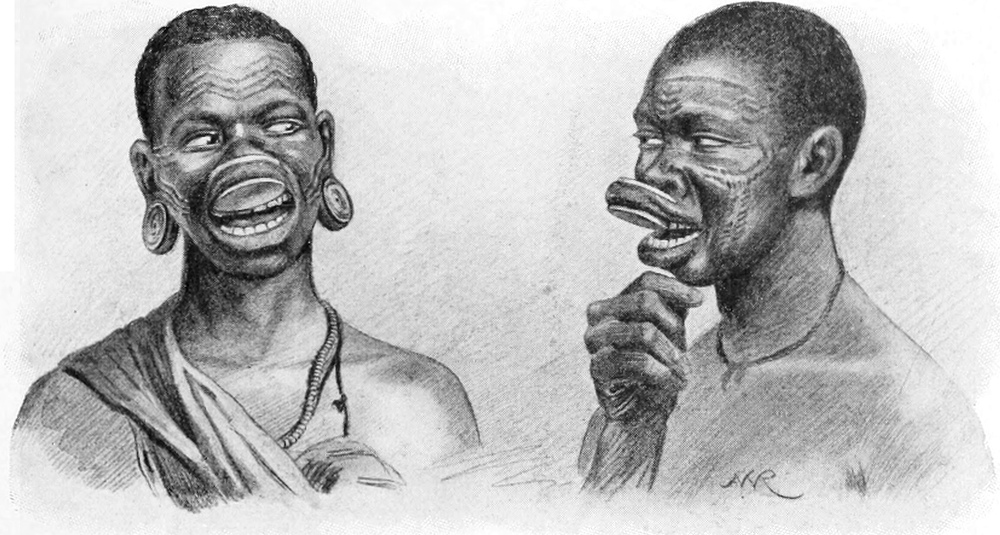
Eine neue Phase. „Hawara marre“, knurrt der Jumbe. Dies kann auch Nils Knudsen nicht übersetzen, denn es ist Kimakua, das er nicht versteht; aber der Jumbe ist vielsprachig wie alle Intelligenzen hierzulande; „Kisūwi mkắmŭle“ heiße es im Kiyao, „der Leopard bricht aus“. In diesem Augenblick geschieht auch schon etwas Unerwartetes:[S. 276] die drei jungen Kerle haben sich blitzschnell erhoben; ein lautes Gekrache und Geraschel — durch die leichte Strohwand sind sie nach außen gebrochen und entweichen in der Richtung auf die entfernteren Dorfhütten zu. Ich habe bis jetzt nicht klar ersehen können, ob diese jugendlichen Ehemänner selbst den Leoparden repräsentieren sollen oder ob sie als durch den imaginären Leoparden verfolgte Größen zu betrachten sind; in beiden Fällen jedoch kann unsereinem das behagliche Schlendertempo, in dem sie davonpilgern, wenig einleuchten und noch weniger imponieren, viel weniger jedenfalls als das mit ebensoviel Verve wie Ausdauer gesungene Lied „Hawara marre“ der Frauen, das in das sonnendurchglühte Pori noch hinausschallt, längst nachdem die drei Leoparden verschwunden sind.
Ein anderes Bild. Die Festhalle ist leer; dafür wimmelt es jetzt von buntfarbigen, abenteuerlichen Gestalten auf dem danebenliegenden, sauber gekehrten Platz. Jetzt erst sieht man, wie schön sich alles gemacht hat. Wie gleißend Gold erstrahlen die schweren, massiven Messingringe von mehr als Daumenstärke an Fuß- und Handknöcheln; in den leuchtendsten, reinen Farben erglänzen auch Schurz und Obergewand, beide soeben erst von dem galanten Ehemann auf eigens zu diesem Zweck ausgeführter Expedition vom Inder in Lindi oder Mrweka für teures Geld erstanden; weißer noch womöglich als sonst leuchtet schließlich der Lippenklotz in seinen wuchtigen Abmessungen zu dem staunenden Fremden herüber. Und wie glänzen die wolligen Krausköpfe und die braunen Gesichter unter der dicken Schicht frisch aufgetragenen Rizinusöls, dem Universalkosmetikum des ganzen Ostens! Wieder stehen die Anamungwi in hoheitsvoller Pose da; wieder drängt sich alles um sie. Diesmal kommt der materiellere Teil: Maiskolben sind es, Hirserispen und ähnliche, ebenso nützliche wie angenehme Dinge. Sie regnen in Massen in ihre Hände.
Und wiederum ein neues Bild. Die Kapelle hat noch sorgfältiger als gewöhnlich ihre Instrumente gestimmt; mit einem letzten Aufzucken sinkt das hellodernde Strohfeuer gerade in diesem Augenblick in sich[S. 277] zusammen. Bŭm, bŭm búm, bŭm bŭm búm, bŭm bŭm búm, setzt auch schon die erste von ihnen ein. Hei, wie fliegen dem Manne die Hände! Trommeln und Trommeln ist zweierlei, der Ngomenschlag indes ist eine Kunst, die gewiß nicht jeder lernt; es ist nicht gleichgültig, ob die Hand mit der ganzen Innenfläche oder den Fingerspitzen allein auf das pralle Fell niedersaust, oder ob die untere oder obere Knöchelreihe der geballten Faust den Ton hervorbringt; auch dazu gehört sicherlich eine gewisse Begabung. Wir Europäer sind nach ziemlich allgemeiner Annahme psychisch doch wesentlich anders organisiert und veranlagt als die schwarze Rasse, doch auch unsereinen lassen Takt und Rhythmus gerade dieses Ngomenschlags durchaus nicht kalt. Unwillkürlich fängt auch der Europäer an, mit den Beinen zu wippen und zu knicken, und fast möchte er in die Reihe der schwarzen Gestalten eilen, gälte es nicht das Dekorum der Herrscherrasse zu wahren und Auge und Ohr anzuspannen für alles, was da vorgeht.
Ikoma heißt der Tanz, in dem die Frauen sich jetzt wiegen. Unser Auge ist zu wenig geschult für die feinen Unterschiede zwischen all diesen einzelnen Reigentänzen; deswegen ermüden wir auch schon vom bloßen Zusehen viel früher als der Neger im angestrengtesten Tanze. In diesem Falle tut auch die Sonne ein übriges; dem Knaben Moritz ist bereits schlecht geworden; wie er behauptet, von dem Dunst der Menschenmenge. Als wenn der Bursche nicht selbst mit duftete! Zwar habe ich ihn noch nicht wie seinen Kollegen Kibwana vorzeiten in Lindi unter Androhung von Peitschenhieben und Ohrfeigen in den Indischen Ozean zu jagen brauchen, weil dieser edle Vertreter des Wassegedjustammes so fürchterlich nach faulem Haifischfleisch roch, als wenn er selber schon monatelang im Grabe gelegen hätte; allzuviel Recht, sich über seine Landsleute zu mokieren, hat das Bürschchen Moritz gleichwohl kaum. Ich bin gerade im Begriff, meine Apparate abzubauen, da endlich ändert sich das Bild der im ewigen Gleichmaß durcheinanderwogenden[S. 278] schwarzen Leiber mit einemmal erheblich. Bis dahin ist alles, auch nach unseren Begriffen, höchst dezent vor sich gegangen, jetzt aber, was muß ich sehen! Mit rascher Gebärde fliegen die bunten Kattune hoch, Unter- und Oberschenkel und die ganze Gesäßpartie liegen frei; rascher schreiten die Füße, feuriger und lebhafter tänzeln die einzelnen Partnerinnen im Kreise umeinander. Und mich bannt, wovon ich schon lange gehört, was mein Auge aber vordem nie erschaute. Wuchtige Ziernarben sind es, auf Oberschenkeln, Gesäß und Rücken in den mannigfachsten Mustern eingeritzt und durch vielfaches Nachschneiden im Stadium der Verschorfung zu diesen dicken Wulsten herangebildet. Auch das gehört zum Schönheitsideal hierzulande.
Ich habe das Ende des Ikomatanzes zu meinem Leidwesen nicht abwarten können; einmal fühlten sich die Teilnehmerinnen trotz des kleinen Silberstücks, das ich freigebig an jede von ihnen austeilen ließ, durch die Anwesenheit eines Vertreters der weißen Rasse, die den meisten von ihnen bis dahin nur vom Hörensagen bekannt geworden war, sichtlich bedrückt, so daß die ungezwungene Fröhlichkeit des geschlossenen Festsaals hier draußen durchaus nicht aufkommen wollte, sodann gebot die Rücksicht auf Moritz, der vor Übelkeit schon ganz grau war, schleunigste Heimkehr.
Der Jumbe von Akundonde besitzt wohl den Vorzug der praktischen Führung, aber er ist kein Theoretiker; um von den Weistümern seines Volkes und der Makua viel zu wissen, ist er wohl noch zu jung. Auch Akundonde selbst schweigt sich aus, vielleicht bedarf es bei ihm immer erst eines stärkeren Reizmittels, wozu ich aber nicht in der Lage bin, zumal wir selbst hier gänzlich auf unsere Konserven, die üblichen mageren Hühner und ein paar von Knudsen erlegte alte Perlhühner angewiesen sind; von der reichlichen Pombezufuhr, wie sie in Massassi und Chingulungulu unser bierfreundliches Herz entzückt hatte, keine Spur. Leichten Herzens sind wir denn auch schon am vierten Tage von Akundonde aufgebrochen, um in dreitägigem Marsch das langersehnte Newala zu erreichen. Stationen: Chingulungulu, wo[S. 279] ein großer Teil unseres Gepäcks liegengeblieben war, sodann Mchauru, ein außerordentlich weitläufig gebauter Ort in der gleichnamigen Landschaft und am gleichnamigen Fluß in den Vorbergen des Makondeplateaus.
Mchauru ist in mehrfacher Beziehung interessant genug; zunächst in topographischer: wohl 20, ja 30 Meter tief in den lockeren Aufschüttungsboden eingeschnitten, zieht sich das Flußbett dahin, in südwestlicher Richtung, dem Rovuma zu; es ist eine wahre Kletterpartie, in diese Klamm hinunterzugelangen. Unten stößt man keineswegs direkt auf fließendes Wasser, sondern man muß auch hier erst noch mindestens 2 Meter tief in den reinen Sand hineingraben, bevor man das unterirdisch abströmende Naß erreicht. Damit rechnen auch die Eingeborenen, auf deren enge, tiefe Wasserlöcher der Wanderer alle Augenblicke stößt. Um so üppiger ist dafür die Vegetation im ganzen Gebiet; woher sie in diesem Gebiet des Regenschattens kommt, ist mir noch nicht ganz klar; möglich, daß der Humusgehalt hier größer ist als an den meisten Stellen der weiten Ebene.
Mchauru ist nicht nur landschaftlich schön, sondern auch ethnographisch berühmt im ganzen Lande; einmal durch einen Fundi, der die schönsten Ebenholznasenpflöcke fertigt und sie am geschmackvollsten mit Zinnstiftchen auslegt, sodann durch den Zauberer Medulla; dieser beiden Personen wegen habe ich überhaupt hier haltgemacht. Der Kipini-Fundi war nicht zu finden; er sei verreist, hieß es; aber Medulla war daheim.
Durch wahre Bananenhaine — für mich ein ganz neuer und ungewohnter Anblick — und ausgedehnte Fruchtfelder von Mais, Bohnen und Erbsen sind wir, d. h. wir beiden Europäer und die engere Garde mit den Apparaten, von unserm an der Barrabarra unter einem riesengroßen Baum aufgeschlagenen Lagerplatz eine kleine Stunde südwestwärts gezogen. Ab und zu führt der Weg im Flußbett entlang; dann ist es ein mühseliges Waten im unergründlichen Sande. Endlich heißt es: wir sind da. Wir klettern einen[S. 280] kleinen Hügel empor und stehen vor einer offenen, schuppenähnlichen Hütte. Ein Negergreis sitzt darin, nicht kauernd nach der Weise der Eingeborenen, sondern wie wir mit ausgestreckten Beinen auf einer Matte. Begrüßung; mein Anliegen: seine Zaubermittel soll er mir erklären und käuflich ablassen, fernerhin aber soll er uns etwas weben. Nur zwei Männer sind nach den Erzählungen der Eingeborenen im ganzen weiten Lande noch in der Lage, dem Fremdling und auch den eigenen Stammesgenossen diese unter der Wucht des eingeführten Kattuns bereits ausgestorbene Kunst vorzuführen. Den einen, einen zittrigen Greis, habe ich vor vielen Wochen in Mkululu kennen gelernt; der andere sitzt jetzt vor mir. Der Mkululumann hat mich arg enttäuscht; von Weben keine Ahnung, auch nichts vom Vorhandensein eines Webstuhls selbst; nur einen mäßig guten Baumwollfaden hat uns der Alte mit seiner Spindel zu bereiten gewußt. Das war alles gewesen.








Um so größer sind meine Erwartungen bezüglich Medullas. Doch die Medizinen gehen vor; wir feilschen mit ihm wie die Armenier, der Mann läßt sich auf nichts ein; schließlich zeigt er uns ein paar der üblichen Kalebassen mit ihren fragwürdigen Mixturen, fordert aber dafür so unverschämte Preise, daß nun auch ich einmal, und zwar mit großer Genugtuung, sagen kann: „Hapana rafiki, gibt’s nicht, Freundchen.“ Auch Medulla ist Philosoph; „na, denn nicht“, denkt er allem Anschein nach, beginnt ein großes Gespräch über seinen Namen, versucht sich dann mit der Aussprache des meinigen und geht erst allmählich zu dem zweiten Teil des Programms über. Wie ein Reporter unserer gräßlichen modernen Wochenblätter stehe ich mit meinem Apparat auf der Lauer; Medulla sitzt ungünstig, draußen schreiendes Licht, in seiner kühlen Hütte tiefes Dunkel; ich nötige ihn sich umzusetzen, er tut’s nicht; ich bitte, ich schmeichle ihm, er grinst, holt umständlich seine Pfeife hervor, zündet sie mit glühender Kohle an, pafft und rührt sich nicht. Im Vertrauen auf mein Voigtländersches Kollinear lasse ich ihn schließlich sitzen, um überhaupt nur weiter zu[S. 281] kommen. Ich will den Webstuhl sehen und wie er gebraucht wird. Erst müsse er, Medulla, den Faden machen, heißt es. Ich füge mich. Langsam greift der Alte in einen Korb, holt ebenso bedächtig eine Handvoll Kapseln hervor, entkernt sie kunstgerecht und beginnt nun, die flockige weiße Masse mit einem Stäbchen zu schlagen. Überraschend schnell ist das ziemlich große Quantum Baumwolle gleichmäßig locker. Medulla nimmt sie in die Linke und beginnt mit der Rechten den Rohfaden zu zupfen. „Aha,“ denke ich, „die Sache kommt dir bekannt vor; das haben vor mehr als 30 Jahren die Eichsfelder ebenso gemacht, wenn sie allwinterlich in unser hannöversches Dörfchen kamen, um dort den Bauern die Wolle zu verspinnen.“ Doch damit hört auch schon die Parallele auf, der weitere Gang ist wieder ganz urmenschlich: Anknüpfen des Rohfadens an das Fadenende auf der Spindel, Durchziehen dieses Fadens durch den unsere Öse ersetzenden Spalt, Wirbeln der Spindel in der Rechten unter weit abgespreizter Linker; sodann ein Herniedergehen mit beiden Armen, ein rasches[S. 282] Rollen der Spindel auf dem rechten Oberschenkel — der Faden ist zum Aufwickeln fertig.

Medulla hat es fertiggebracht, uns eine ewige Zeit in derselben Weise zu langweilen; den berühmten Webstuhl hat auch er schließlich nicht hervorgeholt, sicher aus dem einfachen Grunde, weil dieses Rudiment eines alten Kulturzustandes wohl nur noch im Munde seiner leichtgläubigen Landsleute existiert. Der gerissene Allerweltskünstler versprach bei unserem mehr als kühlen Abschied zwar hoch und heilig, er werde mit seiner Maschine nach Newala kommen, doch dies hat ihm nicht einmal der dümmste meiner Leute geglaubt.
[S. 283]

Newala, Mitte September 1906.
Hurra, Unyago überall, an allen Ecken und Enden; es ist eine Lust zu leben! Mit dem reizvollen Fest von Akuchikomu scheint der Zauberbann gebrochen, der mir gerade die besten Wochen hindurch die Einsicht in diesen völkerkundlich so wichtigen und hochinteressanten Gegenstand verwehrt hat; an nicht weniger als zwei typischen Festfeiern habe ich in der kurzen Zeit meines Newala-Aufenthaltes bereits teilgenommen, und beide waren noch dazu Mädchen-Unyago. Und das hat mit seiner Güte Akide Sefu getan.
O du braver Sefu bin Mwanyi, du Zierde deiner Vaterstadt Ssudi, du Stolz und Perle deines Standes, wie soll ich dir danken, was du bereits an mir getan hast, täglich tust und fernerhin noch tun wirst! Du bist ein Mann von edlem Schnitt des Antlitzes, von hohem Wuchs und der Farbe der Nachkommen des Propheten; Negerblut hast du wohl kaum ein Tröpfchen in deinen Adern, sondern rein und unvermischt hat sich die Reihe deiner arabischen Ahnen durch[S. 284] die Jahrhunderte hindurch bis auf dich herab fortgeführt. Und sprachgewandt bist du, daß Nils Knudsens Ruhm schnell vor dir verblaßt! Bewahre dir dein Verständnis auch für die Ziele späterer Reisender, dann kann es an Früchten deutscher wissenschaftlicher Forschungsarbeiten nicht fehlen!
Wir hatten uns von dem schrecklich mühsamen Aufstieg, den die Steilheit des Plateauabsturzes gerade hier bei Newala bedingt, ein klein wenig erholt, hatten uns notdürftig in der gegen den gefürchteten Abendwind von Newala weit offenen Barasa in der Boma, der Palisadenumzäunung, dieses Ortes eingerichtet und uns gegen die geradezu arktische Kälte der ersten Newala-Nacht durch alle verfügbaren Decken zu schützen gesucht, da kam auch schon im frühen Morgengrauen der diensteifrige Akide herbeigeeilt, um uns nach dem Makondedorf Niuchi zu führen; dort sei heute das Schlußfest des ersten Mädchen-Unyago, da würde ich viel Neues sehen und hören. Eine Stunde später hatten meine Auserwählten, wozu in diesem Falle auch mein gutes, altes Maultier gehörte, und wir uns bereits durch eine tüchtige Portion urechten Makondebusches hindurchgewunden; mein Reittier hätte, selbst wenn es in seinem angeborenen Stumpfsinn dazu fähig gewesen wäre, sich durchaus nicht zu wundern brauchen, warum es denn heute die gewohnten 180 Pfund nicht zu tragen hatte, denn an Reiten war bei diesem Kampf mit Dorn und Busch, die selbst auf dem begangensten Makondepfade kaum 30, 40 Zentimeter eines halbwegs freien Raumes offen ließen, nicht zu denken. Gänzlich unvermittelt standen wir auf einem kleinen, freien Platz inmitten einiger Häuser und sahen mit ebenso großer Verwunderung auf einen stattlichen Haufen seltsam ausschauender Frauengestalten, die erschreckt zu uns herüberstarrten. Ich sah sofort, daß auch hier möglichste Zurückhaltung nur von Nutzen sein könne und verschwand mit all meinen Apparaten und Leuten hinter der Ecke der nächsten Hütte. Von dort aus habe ich ganz ungestört eine Summe von Vorgängen sich abspielen sehen, wie sie in dieser Eigenart bisher wohl selten einem Reisenden sichtbar geworden sind.
[S. 285]
Es ist 8 Uhr morgens; im frischesten Grün schließt sich der Makondebusch fast über unseren Häuptern zusammen; nur ein Baum mitten auf dem Dorfplatz und einige wenige, ebenso stattliche Gefährten ragen über das Buschwerk und die niedrigen Makondehütten hinaus in die klare Morgenluft. Die wenigen Weiber, die bei unserer Ankunft den Platz mit Büscheln grüner Zweige sauber gefegt hatten, sind blitzschnell in den Schwarm der übrigen Frauen zurückgetaucht. Diese stehen wie eine Mauer um fünf andere, in schreiendes Bunt gekleidete Wesen, die in Hockstellung im Schatten eines Hauses kauern, sich mit den Händen Augen und Schläfen überdecken und durch die Finger unverwandt zu Boden starren. Da, ein schriller Ton; fünf oder sechs der Frauen eilen mit grotesken Sprüngen über den Platz, keck steht das Pelele, die Lippenscheibe von wahrhaft fabelhaften Dimensionen, in die Luft, unter ihm aber fliegt die weit vorgestreckte Zunge in raschen Horizontalschwingungen hin und her. Dies gehört nun einmal zu dem berühmten Frauentriller Ostafrikas; ohne dies ist er nicht kunstgerecht. Den ersten sechs folgen bald ein Dutzend andere Weiber.
ertönt es aus ihrer Mitte, zunächst solo, dann im Chor; Händeklatschen im strengen Takt, tänzelnde Schreitbewegungen über den Platz hin und her begleiten das Lied. Trennungsschmerz im wilden Osten, denke ich, als mir Sefu in rascher Gewandtheit den Text übersetzt hat. Da ertönt auch schon ein neuer Sang:
Auch der Vortrag dieses Sanges dauert eine geraume Zeit; dann steht alles plötzlich wieder in dichter Scharung um jene fünf Kleiderbündel herum. Aus dem Schwarm treten fünf ältere Gestalten hervor; mit Bündeln von Hirserispen schmücken sie das Haupt ihrer Schülerinnen, denn das sind jene buntfarbigen Wesen. Diese erheben sich jetzt, treten eine hinter der andern an, legen beide Hände auf die Schultern des[S. 286] „Vordermannes“, die Trommelkapelle setzt ein; alt und jung wiegt den Mittelkörper rhythmisch und meisterhaft zugleich im Bauchtanz.
„Das Chihakatu (eine kleine Korbschale) des Liwile wird früh aus dem Haus herausgetragen“, so erschallt es jetzt aus dem Chor heraus. Mit dem Chihakatu ist anscheinend der Ährenschmuck gemeint; der Neger liebt es, zu symbolisieren.
Endlich geht auch dieses Lied zu Ende, der Reigen löst sich auf; nach allen Seiten eilen die Frauen auseinander, kehren aber sofort zurück, um Hirse, Maniok, Kleidungsstücke u. dergl. vor den fünf Lehrerinnen niederzulegen. Diese haben sich inzwischen zu neuem Tun gerüstet; das erstaunte Auge des Weißen sieht, wie ein Ei zerschlagen und von dem Gelben den fünf Novizen etwas auf die Stirn gestrichen wird; ein anderer Teil dieser Masse wird mit Rizinusöl vermischt und den Mädchen auf Brust und Rücken gesalbt. Das ist das Zeichen der Reife und des beendeten Unyago. Überreichung von noch mehr neuen Stoffes an die Mädchen bildet den Schluß.
Damit scheint der erste Teil des Festes zu Ende zu sein. Sefu macht mich aufmerksam auf eine bestimmte Stelle des Festplatzes, an der ein einfacher Stock dem Boden entragt; unter diesem Stock seien Medizinen vergraben, die zum Unyago gehören; an einer anderen Stelle aber sei schon vor Monaten ein großer Topf mit Wasser in die Erde versenkt; dieser sei auch Medizin.
Noch während dieses Privatkollegs hat sich der Schwarm der Weiber von neuem geordnet. Nach einem Triller, der selbst uns Fernstehenden die Trommelfelle fast platzen macht, ein Emporfliegen aller Arme mit einem Ruck; im nächsten Augenblick sausen sie auch schon wieder hernieder, um von nun an mit jenem Händeklatschen, das in dieser Virtuosität nur den Anwohnern des Indischen Ozeans eigen zu sein scheint, folgendes Lied zu begleiten:
Zu deutsch heißt dies etwa: „Seht euch einmal das Mädchen an,[S. 287] sie hat einen Perlenschurz geliehen und versucht nun, ihn kokett und elegant zu tragen.“
O, ihr Weiber, knurre ich bei Sefus Übersetzung; ihr gleicht euch überall, eitel auf der einen, boshaft auf der andern Seite. Das Lied ist ein Spottgesang; es bezieht sich auf ein Fräulein Habenichts, die in geborgtem Putz erscheint. „Der wollen wir es anstreichen“, sagen, nein singen die anderen.
Und jetzt nehmen sie sogar mich vor:
singen sie. Dem Sinne nach heißt das etwa:
„Ihr, die ihr hier (bei der Unyago) zusammen seid, freut euch, belustigt euch. Wir, die wir hierher gekommen sind, wir wollen nicht mitspielen, wir wollen bloß zuschauen.“
Wenn Sefu recht hat, und dem scheint doch wohl so, so sind diese Worte als mir in den Mund gelegt aufzufassen; entweder sind sie dann ein Ausfluß meines Edelmutes: ich will durchaus nicht stören; oder aber sie sind eine captatio benevolentiae: bleib ja ferne, Weißer, wir fürchten uns sonst.
Ganz geheuer scheint den Teilnehmerinnen trotz meiner diskreten Zurückhaltung überhaupt nicht zu sein, denn sie singen nunmehr bis zur Erschlaffung:
Große Pause.
Der zweite Hauptteil des Programms bringt zunächst die Wiederholung einer Partie von Teil I: noch tiefer in ihre grellbunten Tücher vermummt, so daß von Gesicht und Armen nichts zu sehen ist, treten zuvörderst die Festjungfrauen an, wie vorhin in Reihen rechtsum; an sie gliedert sich in derselben Anordnung die ganze andere Gesellschaft an. Jetzt setzt auch schon die über gewaltigem Feuer neugestimmte Kapelle von frischem ein, und wieder beginnt das Dauerlied: „Chihakatu cha Ruliwile“ usw.; wieder fliegen die Mittelpartien[S. 288] der Körper im Bauchtanz. Das dauert eine geschlagene halbe Stunde lang; dann löst sich die lange Reihe auf, die älteste der Lehrerinnen tritt frei vor die übrigen hin, setzt eine kritische Miene auf und harrt der Dinge, die da kommen sollen. Und es kommt. Wie ein schillernder Falter löst sich eins der bunten Zeugbündel aus der Masse heraus, tänzelt zierlich vor die Alte hin,
setzt der Chorus ein, von dem Kleiderbündel aber sieht der höchst erstaunte Weiße nur noch Kopf- und Fußpartie in einiger Ruhe, alles, was dazwischenliegt, verschwimmt zu einem unerkennbaren Etwas. Erst ein keckes Nähertreten erläutert mir das: die Kleine „zittert“ mit ihrer Beckenpartie, sie wirft sie so schnell hin und her, daß tatsächlich keine Körperlinie zu verfolgen ist. Die eine tritt ab, die anderen folgen der Reihe nach; Lob und Tadel werden aus hohem Munde auf sie herabgesprochen. Was der Liedertext aber bedeutet, kann mir auch Sefu nicht sagen.

[S. 289]
Der dritte Teil folgt. Ebenso neugierig und erwartungsvoll wie ich selbst, blicken jetzt auch die fünf jungen, nunmehr mannbar gewordenen Mädchen auf den Festplatz; sie haben sich von ihrer Umhüllung befreit und fühlen sich inmitten der rechts und links von ihnen aufgestellten Mütter und Tanten anscheinend recht wohl. Da huscht in schnellem Trippelschritt ein neues Kleiderbündel aus dem Busch heraus; ihm folgt alsbald ein zweites, nach wenigen Augenblicken ein drittes und ein viertes. Aha, eine Quadrille, denke ich, aber diesmal habe ich mich getäuscht; richtiger wäre es schon zu sagen ein Pas de deux, denn die vier Masken — als solche stellen sich die Figuren bei einer Wendung heraus — haben sich sofort paarweise gegeneinander geordnet, um sich nunmehr in ganz ähnlicher Weise, wie ich es früher schon in Chingulungulu gesehen habe, zu bewegen; die mannigfaltigsten Evolutionen mit Armen und Beinen, Verdrehungen und Verbeugungen des Oberkörpers, Zitterbewegungen der Mittelpartie, kurz alles afrikanisch, ganz echt und ursprünglich. Insoweit bringen die Masken also nichts Neues; doch um so überraschender ist der An- und Aufzug selbst. Makondemasken sind heute in den größten ethnographischen Museen bekannt, in Gebrauch gesehen hat sie indes, wie es scheint, noch niemand, wenigstens ist das nirgends geschildert worden. Also mir Verwöhntem blüht nun auch dieses Glück. Die Masken sind aus Holz, zwei von ihnen stellen Männer dar, die anderen Frauen. Dies sieht man auf hundert Schritt an den prachtvoll herausgearbeiteten Pelele, deren Weiß sich aus der schwarzen, starren Fläche effektvoll heraushebt. Im übrigen ist der Anzug bei Männlein und Fräulein gleichartig; er verfolgt den Grundsatz, nichts Menschliches sehen zu lassen: Kattun überall, vom engumhüllten Nacken bis über die Finger und die Zehenspitzen hinunter.
Dieses Übermaß der Umhüllung gibt auch den Schlüssel zum beabsichtigten Zweck des Ganzen: die Masken sollen schrecken. Junge Männer sind es, die sich solchermaßen verkleidet haben; sie wollen unerkannt sein und bleiben; sie sollen die Mädchen vor dem endgültigen[S. 290] Eintritt ins mannbare Alter noch einmal tüchtig ängstigen und einschüchtern. Dazu wählen sie ganz allgemein zunächst die Maske, im besonderen aber mit Vorliebe bekannte schreckhafte Gestalten: Porträts gefürchteter Männer, berühmter Krieger und Räuber, Darstellungen großer Tiere; zuletzt aber den Scheitani, den Satanas. Dieser tritt mit langen Hörnern auf und großem Barte und ist wirklich erschrecklich anzusehen.
Noch schwingen die vier Masken ihre Gliedmaßen und Körper auf dem Festplatz herum, bald vereint gegeneinander, bald sich trennend und mit allerhand Kapriolen den Kreis umtanzend, da gibt es schon wieder etwas Neues. Tap — tap — tap — tap steigt es heran, unheimlich, riesengroß; wild flattert ein ungeheurer Stoff im wehenden Morgenwind; gespenstisch lange Arme, ebenfalls flügelgleich mit Stoff besetzt, schlagen wie Windmühlenflügel in die Luft; ein totenstarres Antlitz grinst uns entgegen; fleischlos wachsen stangengleiche Beine meterlang nach unten. Den kleinen Mädchen wird jetzt wirklich angst, auch meiner Leibgarde scheint etwas „schwummrig“ zumute zu sein; den weißen Forscher aber darf so etwas nicht anfechten, er hat zu schauen, zu beobachten und zu knipsen.
Der Gebrauch von Stelzen ist innerhalb der gesamten Menschheit nicht übermäßig häufig; außer bei uns sind sie meines Wissens nur noch gebräuchlich im ostasiatischen Kulturkreis, dann merkwürdigerweise auf den Markesasinseln im östlichen Stillen Ozean und an einzelnen Teilen der westafrikanischen Küste. Wie unter diesen Umständen diese Schreitgeräte gerade hier auf die Berginsel des Makondeplateaus geraten, ist mir vorläufig ganz unerklärlich. Sind sie eingeführt? Und woher? Oder sind sie der Rest einer uralten Sitte, die einstmals vom Kap Lopez bis zu dieser gerade entgegengesetzten Stelle des dunkeln Erdteils gereicht hat, bei der aber die ganzen Zwischenglieder über das alte Tanzgerät hinaus fortgeschritten sind, während es sich im äußersten Westen und im äußersten Osten erhalten hat? Unwillkürlich bewegen mich solche Fragen, trotzdem es dazu eigentlich nicht Zeit ist, denn es gibt allerlei zu sehen.
[S. 291]
Die Idee des Schreckenwollens tritt auch bei dem Stelzentänzer ganz offenkundig zutage; schon in der Art seiner Bewegung; mit wenigen Riesenschritten rast er über den ziemlich geräumigen Platz, entsetzt weichen die dort kauernden Schwarzen zurück, denn es sieht aus, als wolle das Ungetüm sie haschen oder zertreten. Doch schon hat es sich abgewandt und storcht weit am anderen Ende auf die fünf Festjungfrauen zu; kreischend sind diese und manches andere Wesen zurückgetaumelt. Und schon steht der Gewaltige vor meiner Kamera; „knips“, ich habe ihn. Fast möchte man das verblüffte Gesicht des Trägers durch die Maske zu sehen vermeinen, so überrascht zaudert sie einen Augenblick, um dann mit schnellen Schritten davonzueilen.
Ein Vergnügen kann dies Stelzenlaufen im übrigen nicht sein; ermüdet hat sich der Mann an das Dach eines der Häuser gelehnt; er schaut nunmehr zu, wie wiederum die vier Parterremasken ihre Zeit für gekommen erachten und von neuem zum Tanz antreten. Doch auch das will nicht mehr so recht; eine bleierne Hitze lagert über uns allen, die Sonne ist inzwischen bis zum Zenit emporgestiegen; ein großer Teil der Festteilnehmer hat sich bereits verlaufen, auch die anderen sehnen sich sichtlich nach ihrem Ugaliberge. Rasch baue ich ab; ein kurzes „los“; von neuem zwängen wir uns durch Dickicht und Dorn des Makondebusches Newala zu.
Nur einen einzigen Tag hat mir der nimmer rastende Akide Zeit gelassen, die Eindrücke von Niuchi einigermaßen zu verarbeiten, da hatte er auch schon wieder ein großes Unternehmen in Aussicht. Sefu wohnt nur 30 bis 40 Meter von uns entfernt in einem Gebäude im Küstenstil. Er ist nicht wie Nakaam und Matola landeseingesessen, sondern ein, sagen wir, hierher versetzter Beamter der deutschen Kolonialregierung, oder, um einen Vergleich zu wählen, ein zünftiger studierter Landrat, während die anderen beiden Großgrundbesitzern gleichen, die man wegen ihres festen Fußens in Land und Volk mit diesem Amte betraut hat. Er hat etwas mehr Sinn für Wohnlichkeit[S. 292] als sonst seinen Rassengenossen eigen ist, denn er hat vor seiner Barasa, jenem in Ostafrika stets vorhandenen offenen Raum vor dem Hause, wo er seine Schauri abhält und wo er auch die Führer der durchziehenden Handelskarawanen mit großer Würde zu empfangen pflegt, ganz hübsche Sitzbänke aus Bambus herrichten lassen, sogar solche mit Rückenlehnen, beides hierzulande ein unerhörter Luxus. Sefu ist in allen seinen freien Minuten bei uns; schon am frühen Morgen tritt er an, und auch abends friert er mit uns um die Wette in unserem Windfang von Rasthaus, das wir wohl oder übel werden zubauen müssen, um den abendlichen Stürmen den Eingang etwas zu erschweren.

Also Sefu hat etwas Großes vor. Diesmal könne er mir ein Fest der Matambwe im Dorfe Mangupa zeigen; es sei zwar auch wieder ein Chiputu der Mädchen, also das Schlußfest des ersten Unterrichts, den diese 8- bis 11jährigen Kinder vorher mehrere Monate hindurch in einer besonderen Hütte genossen hätten; aber bei den Matambwe sei manches anders als bei den Yao und Makua; auch sei der Weg nicht weit; wenn wir 7½ Uhr am nächsten Morgen ausrückten, würden wir bei anderthalbstündigem Marsche gerade recht zum Beginn kommen.
Von dem berühmten Makondebusch hatte ich schon bei der Expedition nach Niuchi einen kleinen Begriff bekommen, aber doch noch nicht den ganz richtigen. Über diese Vegetationsform ist schon viel geschrieben worden, aber ich glaube, das Thema ist unerschöpflich. Nicht, daß dieser Busch außergewöhnliche ästhetische Reize aufwiese durch berückende Szenerien oder den lieblichen Wechsel zahlreicher Pflanzenarten; nichts von alledem, er ist vielmehr eine ganz gleichartige, kompakte Masse von dünnen Stämmen, Ranken, Zweigen und[S. 293] Blättern. Aber gerade das ist das Unangenehme; dieses unbeschreiblich dichte Gewirr läßt niemand hindurch, es sei denn, daß er sich erst mit Axt und Beil in mühseliger, blutiger Arbeit einen Weg geschlagen habe. Ach, wie oft haben unsere schwarzen Krieger dies allein im Laufe des letzten Jahrzehntes, insbesondere dem bösen Machemba gegenüber, durchzukosten Gelegenheit gehabt. Uns Epigonen ist es bequemer gemacht; unsere siegreichen Kämpfe gegen die vordem so unzuverlässigen und so oft unbotmäßigen Elemente des Südens haben zu der weisen Maßnahme geführt, daß jeder einigermaßen wichtige Ort mit allen anderen durch Wege verbunden ist, die ihren Namen Barrabarra, d. h. geschlagener Weg, in des Wortes eigentlichstem Sinn verdienen; zur Not könnte eine Sektion von vier Gliedern auf ihr marschieren, so breit ist diese allerdings auch hier stellenweise stark verwachsene Straße.
Wir sind von der nach Ostsüdost auf Nkunya zu führenden Barrabarra sehr bald nach rechts abgeschwenkt und geraten immer tiefer in den Busch hinein. Reiten ist längst nicht mehr möglich, jeder einzelne kämpft vielmehr einen sehr vorsichtigen Kampf gegen die Upupu. Mir hat Nils Knudsen schon gleich nach unserer Ankunft in Newala ein sehr eindringliches Kolleg über dieses nette Pflänzlein gehalten, deshalb bin ich gewarnt; wehe aber dem Unglücklichen, der sich eines solch fürsorglichen Mentors nicht erfreut. Arg- und harmlos schreitet der Pionier europäischer Kultur durch den grünen Busch dahin; „eine neue Art von Bohnen“, denkt er und greift in hehrem Wissensdrang nach einer Handvoll dunkelgrüner Schoten, die von schlanker Ranke freundlich zu ihm herunternicken. Doch sein Wissensdrang wird dem Unglücklichen für lange Zeit vergällt sein, denn die Folgen dieses Griffs sind furchtbar; Knudsen behauptet, daß Juckpulver eine Annehmlichkeit dem Upupu gegenüber bedeute; daß der von ihm Betroffene fähig sei, für den guten Rat, wie er sich von dieser Höllenpein befreien könne, selbst einen Mord zu begehen; jedes Reiben, jedes Kratzen bringe ihn dem Wahnsinn näher, auch Baden und Waschen[S. 294] sei ganz zwecklos; lediglich Asche, feuchte Asche als Brei aufgetragen, nehme die feinen Giftkristalle nach kurzer Zeit hinweg. Wie sooft, liegt also auch hier das Gute so nah, nur muß man das Rezept kennen.
Punkt 9 Uhr stehen wir einer ähnlichen Festhütte gegenüber, wie wir sie seinerzeit in Akuchikomu gesehen haben, nur daß die hiesige Likuku, wie sie heißt, ein Zwilling ist; die Baumeister haben gleich zwei dieser runden, niedrigen Salons aneinandergebaut. Das Fest soll gerade beginnen, wie mir Sefu sagt. Ich bin hart und barbarisch genug, den Jumben dieses weltverlorenen Örtchens, dessen einer Fuß schon gänzlich in Fäulnis übergegangen ist, der infolgedessen die Gegend im weitesten Umkreis in entsetzlichster Weise verpestet, aber trotzdem das Gefühl hat, die Honneurs machen zu müssen, einen Kilometer weit unter den Wind transportieren zu lassen; dann baue ich mich mit meiner Kamera zur Seite eines Busches auf und harre der Dinge, die nun kommen sollen.
Eine Zeitlang hören wir nichts als den berühmten Frauentriller in vielfacher Variante, in Sopran und Alt, piano und fortissimo, gleichsam als ob die Weibergesellschaft, die in dichtem Klumpen hinter dem Doppelhaus steht, sich erst ein bißchen üben wolle. Inzwischen erglänzen die Weiber immer mehr; sie salben sich mit Rizinusöl ein, daß sie triefen. Und dabei haben sie Lippenscheiben von einem Ausmaß, wie ich es noch nimmer geschaut. Mit einem Male ändert sich das Bild: „die sieben Schwaben“, bemerke ich halblaut zu Nils Knudsen hinüber, ohne zu bedenken, daß dieser brave Norweger unmöglich mit unserem Märchenschatz vertraut sein kann. Doch das Bild stimmt: sieben Weiber an einer Stange von bedeutenden Abmessungen sind es, die sich aus dem Knäuel loslösen, um mit raschem Schritt den links von der Likuku liegenden Festplatz zu erreichen. Jetzt erst sehe ich, daß die Stange eigentlich eine Fahne ist, und zwar eine riesige: eine ganze Zeugbahn funkelnagelneuen, buntfarbigen Kattuns hängt von ihr in ihrer ganzen Länge herab. „Nini hii, was ist das?“ frage ich Sefu. Es sei das Unterrichtshonorar für die Lehrerinnen, an die[S. 295] es sehr bald verteilt werde, aber vorher wolle man das große Stück dem Volk erst in seiner ganzen Schönheit zeigen. Dies geschieht denn auch, immer unter dem Fortsingen jenes Liedes, das die sieben Schwäbinnen schon seit ihrem Hervorkommen aus dem Hintergrund gesungen haben:
„Watata wadihauye kuninga akalumbane kundeka unguwánguwe.“
Nach Sefu soll das heißen:
„Mein Vater hat mich schlecht behandelt, er hat mir einen schlechten Mann gegeben; der ist von mir gegangen, und ich sitze nun da.“ „Verlassen, verlassen, verlassen bin i“, singe ich in meiner übermütigen Laune mitten in den schon recht heißen afrikanischen Morgen hinein; doch wie sich Lied und Chiputu zusammenreimen, das bringe ich selbst mit Hilfe von Freund Koschat nicht heraus. Ich habe auch gar keine Zeit dazu, denn schon führt die ganze Gesellschaft eine Art Walpurgisnacht auf; so ähnlich würde wenigstens ein afrikanischer Goethe eine der Faustszene analoge Festlichkeit auf den Höhen des Kilimandscharo vermutlich darstellen! Besen, Mutterschweine und andere nette Attribute der ehrsamen Zunft fehlen zwar hier gänzlich, aber die schlohweiße Holzscheibe in der Oberlippe, die Riesenpflöcke in den Ohren, die Kämme im Kraushaar, die schweren Ringe an Arm und Fuß, schließlich das unglückliche Baby bei jeder jungen Hexe und merkwürdigerweise auch bei so mancher älteren, dies unterstützt die Illusion mehr als genug; trillernd und händeklatschend läuft, springt und tanzt der wüste Haufen wild durcheinander, daß mir Hören und Sehen vergeht.
Plötzlich tiefe Stille. Eng hintereinander geschmiegt, tief gebückt, den ganzen Körper in grellbunte, neue Tücher gehüllt, kommen aus derselben „Kulisse“ die Gestalten der fünf Novizen hervor. Man läßt sie bis an den Festplatz herantrippeln, dann aber bricht ein Lärm los, gegen den die Walpurgisnacht noch ein lindes Gesäusel war; jetzt wirbelt und donnert zu allem nämlich auch noch das halbe Dutzend Trommeln der unvermeidlichen Kapelle. Rasch hat sich das Chaos[S. 296] indessen zu einem großen Kreise geordnet; in der Mitte stehen die fünf mir nunmehr schon vertrauten Kleiderbündel wie in Niuchi so auch hier in tiefgebeugter Haltung da. Die Trommeln haben Ton und Tempo gemäßigt; im sattsam bekannten Takt gleiten und schieben die Frauen sich im Kreise herum. Schließlich wechseln die Rollen; auch hier tritt die Meisterin vor die Front, alles andere bildet Staffage, die Novizen aber zeigen auch hier jetzt ihre Kunst im Zittern der Gesäßpartie. Nun ist auch diese Prüfung beendet; fast scheint es, als gratuliere man ihnen, dann wälzt sich die ganze Masse der Zwillingshütte zu. Seltsamerweise schreiten dabei die fünf Novizen rückwärts; in dieser Richtung verschwinden sie mit den anderen im Dunkel jenes Doppelbaues. Doch während die erwachsenen Frauen in dessen Innern bleiben, erscheinen die fünf Mädchen schon nach wenigen Minuten wieder; eine im mäßigen Abstand hinter der andern, überschreiten sie den Festplatz, diesmal in normaler Gehweise. Husch, husch, sind sie auch schon im dichten Busch verschwunden.
Das Abtreten der fünf Mädchen muß wohl das offizielle Ende des Festes bedeuten, denn seitens der Frauen erfolgt nichts mehr; dafür treten jetzt die Herren der Schöpfung in Aktion. Für sie scheint nunmehr die Fidelitas zu beginnen; wie von einem Magnet angezogen, haben sie sich Mann für Mann auf die beiden Hütteneingänge zu bewegt, Mann für Mann verschwindet in ihnen, doch niemand kehrt wieder. Das interessiert mich sehr, und neugierig trete auch ich an den einen Hütteneingang heran. Ei, was muß ich sehen! Es fehlt nur noch, daß einer mit des Basses Grundgewalt das hehre Lied anstimme: „Im tiefen Keller sitz’ ich hier“; in langen Reihen steht Topf an Topf! Gewaltige Gefäße würziger Pombe sind es in erklecklicher Anzahl, die hier ihres Endzwecks harren. Man hat uns leider nicht eingeladen, sicherlich nicht aus Mangel an Gastfreundlichkeit, sondern wohl mehr aus Scheu; daher sind wir rasch von dannen gezogen. Aber neidisch waren wir doch.
[S. 297]

Newala, gegen Ende September 1906.
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum. Dank dem braven Sefu, oder richtiger wohl, weil es die Zeitumstände so mit sich gebracht, habe ich zunächst den goldenen Baum der frohen Feste genossen und gerate seitdem immer rettungsloser in den Bann der grauen Theorie hinein, das Studium des Unyagoverlaufs für beide Geschlechter in seinem ganzen Umfange. Wie schwer wird mir gerade diese Arbeit gemacht! Mit dem Knaben-Unyago bin ich allmählich ins reine gekommen, wenngleich auch die Festlegung seiner Regeln unendliche Mühe verursacht hat; aber die andere Seite des Problems erscheint mir geradezu als verhext, so viel Schwierigkeiten und Widerstände türmen sich seiner Lösung entgegen. So etwas könnte unter andern Umständen schließlich auch den geduldigsten Forscher zur Verzweiflung bringen, doch dazu ist hier auf dem Makondeplateau erfreulicherweise gar keine Zeit, denn zu jener Frage gesellen sich hundert andere, die nicht minder interessant und wichtig[S. 298] sind und demgemäß mit ebenderselben Dringlichkeit der Beantwortung harren.

Doch ich sehe ein, ich muß die Darstellung meiner Forschungsarbeit und ihrer hauptsächlichsten Ergebnisse höflicherweise hübsch systematisch aufbauen, damit sie genießbar werde.
Im Grunde genommen stellt schon das ganze Milieu von Newala eine Art Widerstand gegen jede intensive Forschungsarbeit dar. Nicht daß wir hier oben, zirka 750 Meter über dem Meer, so von der Hitze litten wie in dem allmählich zu einem Backofen gewordenen Tieflande; die 26½ bis 27 Grad C, die das Schleuderthermometer in den ersten Nachmittagsstunden in unserer Barasa zeigt, verursachen uns zwar genau dieselben schrecklichen Kopfschmerzen wie die 30 und mehr Grad in der Ebene, aber einmal gewöhnt man sich doch auch an diese Hitzeserien-Temperatur, andererseits werden die heißen Stunden des Tages von den Negern ganz allgemein verschlafen und sind also auch für mich nicht übermäßig kostbar. Viel schmerzlicher dagegen ist der Zeitverlust, den ich durch die Häufung einer ganzen langen Reihe[S. 299] von anderen Umständen erleide; dem Fernstehenden mögen sie zum Teil fast drollig erscheinen; auch uns beiden Europäern geben sie hin und wieder Anlaß zur Fröhlichkeit, doch ein Hindernis bilden sie gleichwohl.
Da ist zunächst der tägliche Temperaturgang; in rascher Folge tropft es schwer auf das Zeltdach hernieder, unter dem der Weiße, warm und mollig in zwei vortreffliche Kamelhaardecken gehüllt, in den grauenden Morgen hineinschlummert. Es regnet, denkt er im Halbschlaf und dämmert weiter. Doch das Schicksal ist wider ihn: ein Ächzen und Stöhnen erhebt sich, daß er alsbald verstört auffährt. Schon hat er die Ursache erkannt: die Zeltstricke sind so straff angespannt, daß die eschenen Tragstangen sich fast halbkreisförmig biegen. „O, der verflixte Posten!“ Mit beiden Beinen fahre ich unter dem Moskitonetz hindurch und rufe den pflichtvergessenen Krieger herbei, zur Strafe auch die beiden andern Nummern. Nicht ohne Anstrengung gelingt das Werk des Strickeverlängerns. Dabei ist es auch schon hell geworden, so daß ein Weiterschlafen nicht mehr lohnt. Nun kommt der schönste Augenblick des Tages: die Morgenwäsche; jetzt, 6 Uhr, sind es eben 14 bis 14½°; das ist für Afrika eine arktische Temperatur; die lange Reihe der alaunisierten Kalebassen enthält denn auch ein Wasser, das mir eiskalt vorkommt. Wahrhaft köstlich ist in ihm das Bad oder die Abreibung, zu der ich jetzt schreite. Kibwana ist Kammerdiener; er hat sich an die weiße Farbe längst gewöhnt, aber die Glotzaugen der schwarzen Männlein und Fräulein, die durch den Zaun des Akidengehöfts oder durch die Lücken in der Palisadenwand der Boma auf dieses Morgenschauspiel gucken, sind verwundert genug. Von Regen übrigens keine Spur; es ist der Morgentau, der von den dichtbelaubten Mangobäumen, unter denen wir unsere Zelte aufgebaut haben, überreichlich herabtropft. Auch von der Sonne ist nichts zu sehen; ein schwerer Nebel wallt über Newala hin; nicht einmal die hohen Grabbäume draußen am Tor sind in diesem weißen, wogenden Meere zu erkennen. Instinktiv legen Knudsen und ich die schon früher[S. 300] geschilderte Winterkleidung an; ich füge sogar noch ein Halstuch in Gestalt eines zusammengefalteten Taschentuchs hinzu. Nils Knudsen aber schließt seinen Wikingerrock sorgsam bis an das blonde Kinn.
Dabei ist es gegen 6½ Uhr geworden; arbeitsfreudig verlasse ich das Zelt genau in dem Augenblick, als meine Krieger zum täglichen Dienst antreten. Diesen habe ich schon in Massassi eingeführt; um nicht ganz zu verbummeln, müssen die Soldaten täglich zwei Stunden stramm exerzieren. „Antreten! Stillgestanden, richt euch! Augen geradeaus!“ Meldend tritt Hemedi Maranga an mich heran. Der stramme Bursche hat der Gesellschaft in kurzer Zeit einen ganz andern Zug beigebracht; er ist ein geborener Krieger, während sein Vorgänger Saleh wohl mehr für die Jagd geeignet erscheint. Ihn hat das Bezirksamt in das mittlere Lukuledital beordert, damit er dessen unglückliche Bewohner endlich von jener Löwenplage befreie, die nach unserm Durchmarsch im Juli schon wieder zahlreiche Menschenleben gefordert hat. Möge ihm sein gefährliches Werk vollauf gelingen!
Während ich mich mit meinem Frühstück vergnüge — dick eingekochtem Kakao, dazu den obligaten dicken Eierkuchen mit eingebackenen Bananen —, ist der Gefreite mit seiner Truppe ins Gelände gezogen, um den Buschkrieg zu üben oder die Kompagnieschule zu exerzieren. „Legt an! Feuer! Geladen!“ Klar und schneidig wie die Kehle des besten deutschen Unteroffiziers tönt das aus Negermund immerhin befremdliche Kommando von weither zu mir herüber. Doch ich habe nicht Muße, auf diesen Heimatgruß zu achten, denn schon sind meine Gelehrten langsam und mit der Würde des alten Negers herangetreten. Wir haben gestern verabredet, daß sie um 7 Uhr hier sein sollen.
„Ja, aber haben denn die alten Herren eine richtig gehende Uhr, Herr Professor, oder wie bringen Sie ihnen den Termin sonst bei?“
Freilich haben die Männer eine Uhr, eine für afrikanische Verhältnisse sehr genaue sogar; nach ihr richten wir uns hier alle. Bis[S. 301] zum Umfallen ermüdet, haben Weiße und Schwarze gestern gegen Sonnenuntergang ihre Arbeiten unterbrochen.

„Ihr kommt morgen früh wieder“, lasse ich durch Sefu den fünfzehn Greisen in Kimakua und Kimakonde verdolmetschen, „saa“, und dabei strecke ich meinen Arm nach Osten und im Winkel von 15 Grad über den Horizont. Aufmerksam schauen die Männer her. „Habt ihr es verstanden?“ lasse ich zur Vorsicht fragen; einheitlich heben sie alle den Arm und halten ihn ebenfalls einen Augenblick in jenem Winkel über die Horizontale erhoben. 15 Grad, das ist eine Stunde nach Sonnenaufgang, also 7 Uhr; will ich die Männer später haben, so vergrößere ich den Winkel entsprechend. Das ist Landesbrauch hier, keine Erfindung von mir; die Leute verstehen es, den Sonnenort bis auf minimale Zeitdifferenzen genau anzugeben.
Ein paar Stunden sind bei Frage- und Antwortspiel über dies oder jenes Gebiet der heimischen Volkskunde rasch dahingeflogen; noch[S. 302] immer kauern die alten Herren im Halbkreis um mich herum auf einer riesenhaften Matte. Am ersten Tage unserer gemeinsamen Arbeit hat einer von ihnen seinen natürlichen Gefühlen freien Lauf gelassen und mit großer Virtuosität einen langen Strahl braunen Tabaksaftes nach Seemannsart durch die Zähne gerade vor meine Füße lanciert. „Schensi, du Bauer!“ habe ich daraufhin halb unwillkürlich den Unbeleckten angeknurrt. Seitdem habe ich keine Veranlassung wieder gehabt, auch nur den geringsten Verstoß gegen die guten Sitten rügen zu müssen. Zwar die Leute riechen; sie duften nach Schweiß, ranzigem Öl und wer weiß wonach sonst noch, so daß mir im Laufe der Stunden immer übler wird; sie haben immer eine ganze Wolke von Fliegen mitgebracht, die sich aufs eifrigste bemühen, die Augenleiden ihrer schwarzen Herren auf den weißen Fremdling zu übertragen; aber sonst: alle Achtung! Die Beobachtung, die ich bisher überall gemacht habe, daß diesen Wilden ein starkes natürliches Taktgefühl eigen ist, bestätigt sich auch hier wieder. Damit vergleiche man einmal das Benehmen gewisser Volkskreise und Volksschichten bei uns daheim, die wir doch alle Kultur, alle Zivilisation und allen Takt gepachtet haben wollen. Nein, wir Weißen sind doch keine besseren Menschen!
Aber heiß ist der Schuppen allmählich geworden; das nordische Gewand ist nicht mehr am Platze. Also Metamorphose: die schweren Tippelskirchstiefel herunter und auch die dicken, wollenen Strümpfe; desgleichen das derbe Wollhemd, Weste und Halstuch; an ihre Stelle treten jetzt durchweg durchlässige, dünne Tropensachen. Um Mittag fliegt auch der Khakirock in die Ecke; ihn vertritt jetzt ein dünnes Lüsterjäckchen. Damit ist der Negativprozeß vollendet; gegen Abend fängt der andere wieder an. Mit einer scharfen, eisigen Bö hat der gefürchtete Abendwind Newalas eingesetzt — mit einem kräftigen gleichzeitigen Nieser haben Knudsen und ich die fröhliche Fortdauer unseres chronischen Katarrhs, der nur bei Tage latent ist, festgestellt. Jetzt hilft es nichts, stückweise müssen wir wieder den ganzen Winterkram an unsere jetzt ach so mageren Leiber schmiegen.[S. 303] Instinktiv tun wir gleich noch ein übriges und legen auch noch die berühmten Überzieher an, wenn der nunmehr mit voller Wucht einsetzende Sturm wahre Wolken von Schmutz und Staub durch unseren Wohnraum wirbelt. Diesen haben wir im Laufe der Wochen immer mehr zubauen müssen; die ursprünglich an der offenen Seite aufgespannten Matten sind längst durch eine solide Strohwand ersetzt worden; sie hat ein Fach nach dem andern ergriffen, so daß jetzt, am Ende des Monats, tatsächlich nur noch ein einziges großes „Fenster“ dem Licht Eingang gewährt. Abends binden dann meine Träger mein großes Segeltuch vor diese Öffnung, doch auch selbst die damit vollständig gewordene Abdeckung der Windseite macht den Raum nicht wohnlich; wenn ich um 10 oder 10½ Uhr abends vom Entwickeln und Umlegen meiner photographischen Platten schweißgebadet aus dem als Dunkelkammer dienenden Zelt in die Barasa komme, finde ich meinen nordischen Freund als ein dickes, unförmiges Bündel vor; er hat sich in alle verfügbaren Decken gewickelt, klappert aber trotzdem vor Frost. Schnell kriecht dann jeder in sein warmes Zelt. Warm sind diese übrigens auch erst, nachdem wir vor ihnen, quer gegen den Wind, eine mit dicken Balken abgesteifte Hirsestrohwand aufgebaut haben; vorher drohte der Wind die Zelte allnächtlich einfach niederzudrücken. Dies sind die täglichen Sorgen um Kleidung und Unterkunft; sie sind nicht groß, nehmen aber immerhin einen gewissen Bruchteil meiner kostbaren Zeit vorweg. Durch die Sorge um unseres Leibes Nahrung und Notdurft wird dieser Bruchteil leider noch wesentlich vergrößert.
Es ist nächst dem Busch die größte Eigentümlichkeit des Makondeplateaus, daß es auf seiner Oberfläche quellen- und wasserlos ist; sein Boden besteht bis tief hinein in den Schoß der Erde aus lockerem Gefüge: sandigen Lehmen und lehmigen Sanden. Im Westen gehören diese Schichten der oberen Kreide an; man nennt sie Makondeschichten; im Osten sind sie tertiär, man nennt sie Mikindanischichten; beiden gemeinsam aber ist die hervorragende Wasserdurchlässigkeit.[S. 304] Diese bringt es mit sich, daß alle Niederschläge, sofern sie nicht von dem reichlichen Pflanzenwuchs festgehalten werden oder verdunsten, schnell in die Tiefe sinken, bis dahin, wo undurchlässige Schichten, flachgeneigte Newalasandsteine oder uralte Granitkerne ganz von der Art der Inselberge draußen in der Ebene, die wir auch im Schoß des Makondeplateaus vermuten müssen, ihnen ein Halt gebieten. Auf diesen Schichten sickern dann die Wässer abwärts, sie treten naturgemäß erst am Rande des Plateaus zutage und machen diesen Rand im Gegensatz zu dem quellenlosen Plateau selbst zu einem an Quellen und Bächen überreichen Gelände.

Demnach wird also das Plateau selbst unbewohnt sein, alles Volk aber wird sich an seinem Rand angesiedelt haben? Das ist der Gedankengang, den wir siedelungstechnisch rationell denkenden Europäer entwickeln werden. Tatsächlich wohnt nicht ein Mensch unten, oben aber wohnen mehr als 80000 Makonde, fast 5000 Wangoni, Tausende von Wayao und Makua, und eine mir nicht bekannte Anzahl von Matambwe. Neuerdings besteht allerdings die Tendenz, mehr und mehr in die wasserreichere Niederung hinunterzusteigen; das ist die Folge des Aufhörens der Mafiti-Einfälle und der Ausfluß unserer deutschen Kolonialpolitik, deren feste Hand auch die Neger längst fühlen. Diese Tendenz erstreckt sich indessen nur auf die fortschrittlicheren Elemente, die Yao und Makua; die Makonde bleiben davon unberührt; bei ihnen ist es noch heute wie seit unvordenklicher Zeit: kaum ist in Haus und Feld die unumgänglich notwendige Arbeit getan, dann nimmt auch schon Vater und Sohn, oder auch Mutter und Tochter die 1½ bis 2 Meter lange Stange auf die Schulter, an der vorn und hinten je ein oder wohl auch je zwei große Flaschenkürbisse befestigt sind. Mit merkbarer Eile schreiten sie dahin, dem Plateaurand zu, von dem ihr Weiler unangenehm weit abliegt; ein steiler Abstieg auf schlechtem Pfad, ein kurzes Verweilen in sumpfiger Niederung, ein mühseliger, beschwerlicher Aufstieg Hunderte von Metern steil in die Höhe. Endlich haben sie[S. 305] es geschafft, hoch aufatmend gehen, ja traben sie fast ihrem Dörfchen zu. Die Makonde stehen im Ruf — auch ich habe ihn, trotzdem ich noch nicht einmal im Zentrum ihrer Verbreitung weile, bereits bestätigt gefunden —, daß sie den größten Teil ihres Lebens dem Feldbau widmen; der zweitgrößte Teil entfällt ganz ohne Frage auf die nach unseren Begriffen törichte Zeitverschwendung des weiten Wasserweges. Wenn die Hälfte der Familienmitglieder täglich je zweimal zwei Stunden oder noch mehr vertrödelt, um gerade so viel Wasser herbeizuschleppen, in schwerster Arbeit sogar, nur um sein bißchen Ugali herrichten und einen trüben Trunk tun zu können, so ist das ökonomisch ein Widersinn.
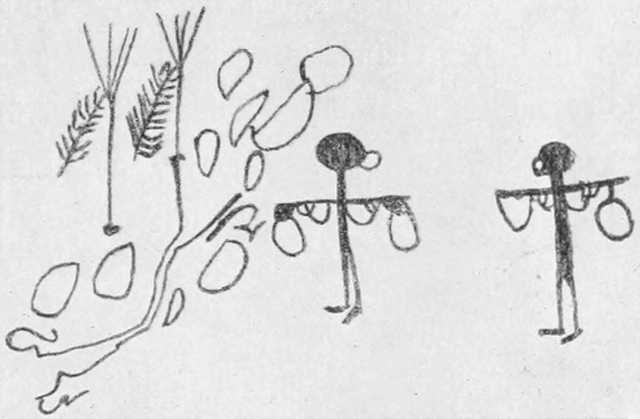
Auch Newala leidet unter dieser Wasserferne, wenigstens das heutige Newala; ein früheres Newala hat unten am Fuße des Plateaus in einem wunderschönen Tale gelegen. Ich habe es besucht; von Häusern kaum noch eine Spur; nur ein christlicher Friedhof mit den Gräbern mehrerer englischer Missionare und im christlichen Glauben gestorbener Neger zeugen noch von der alten Herrlichkeit. Aber in welch wundervoller Umrahmung! Ein dichtgeschlossener Hain prächtigster Mangobäume rings um die verwaschenen Kreuze und Steine; hinter ihnen, das Nützliche mit dem Angenehmen vereinigend, eine ganze Plantage in voller Reife prangender Zitronenbäume. Es ist nicht die kleine afrikanische Frucht, die dem Durchreisenden heute mühelos in den Schoß fällt, sondern eine viel größere und auch viel saftreichere fremde Varietät. Alt-Newala untersteht heute der Jurisdiktion des schwarzen Pastors Daudi von Chingulungulu; mit ihm bin ich gut Freund, daher ist es selbstverständlich, daß er mir[S. 306] für die Dauer meines Aufenthaltes in Newala den Nießbrauch dieses Zitronenhains überläßt.
Der Wasserweg von Neu-Newala bis in die 500 Meter tiefer gelegene Talsohle hinunter ist nicht nur weit und beschwerlich, sondern das Wasser, welches Knudsen und ich geliefert bekommen, ist auch schlecht, grundschlecht. Dazu kommt, daß Newala zu vornehm und üppig eingerichtet ist; es hat nicht nur ein Klosett ganz im Küstenstil, sondern auch eine besondere Kochhütte. Sie liegt rechtsab von unserer Barasa an der Bomawand; ihr Inneres ist von uns aus nicht zu übersehen. Das haben die Köche natürlich sofort herausgefunden und tun, oder vielmehr lassen, was sie wollen. In jedem Fall scheinen sie es mit dem Abkochen unseres Trinkwassers recht wenig genau zu nehmen; ich wenigstens kann die dysenterieartigen Anfälle, an denen Knudsen und ich schon seit längerer Zeit leiden, lediglich auf die Pflichtvergessenheit unserer beiden Küchenchefs zurückführen. Kann man so einen Menschen nicht dauernd kontrollieren, so ist er zu allem fähig. Zu dieser Darmstörung kommen noch die Unannehmlichkeiten glasharter Nägel an Fingern und Zehen, die bei jeder derben Berührung Sprünge bekommen; bei mir auch noch Pickeln überall.
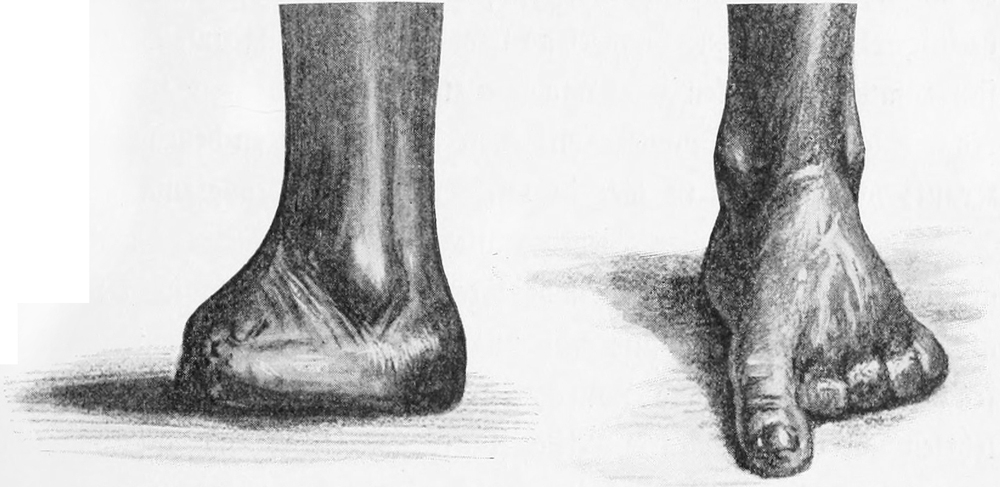
Seit einer Woche führen wir obendrein den Kampf gegen den Sandfloh, der in dem warmen Sande des Makondeplateaus sein Dorado gefunden hat. Unsere Leute sieht man den ganzen Tag, soweit ihnen ihre Dauerkatarrhe und die auch bei ihnen stark grassierende Dysenterie dazu Zeit lassen, mit ihren unteren Extremitäten beschäftigt, um diese Geißel Afrikas abzuwehren und ihren verheerenden Wirkungen vorzubeugen. Daß den hiesigen Eingeborenen als Folge dieser Sandflohplage eine oder ein paar Zehen fehlen, ist etwas Häufiges; vielen fehlen alle Zehen, ja selbst der ganze Vorderfuß, so daß das Bein in einen unförmigen Stumpf als den letzten Rest des ehemals so wohlgeformten Beines endigt. Diese Zerstörungen werden bekanntlich durch das Weibchen des Sandflohes hervorgebracht, das sich unter die Haut einbohrt und dort einen bis[S. 307] erbsengroßen Eiersack entwickelt. In allen Büchern steht zu lesen, daß man auf das Vorhandensein eines solchen Schmarotzers durch ein unerträgliches Jucken aufmerksam gemacht werde; nach meinen Erfahrungen stimmt das sehr wohl, soweit die zarteren Teile der Fußsohle, die Partien zwischen und unter den Zehen und die innere Fußseite in Frage kommen; bohrt sich das Tier indessen durch die härteren Teile des Ballens oder der Ferse hindurch, so kann es selbst dem aufmerksamsten Beobachter passieren, daß er das Tier erst im höchsten Reifestadium entdeckt. Dann ist es aber allerhöchste Zeit, es vorsichtig herauszuheben, um ähnlichen Verwüstungen, wie man sie hier täglich zu Dutzenden sieht, vorzubeugen. Beim Europäer mit seiner weißen Haut ist das Auffinden des Sandflohes übrigens weit leichter, als es den Schwarzen gemacht wird, von deren Haut sich der dunkle Punkt kaum abhebt. Die vier oder fünf Sandflöhe, die mich trotz steten Tragens hoher, geschlossener Schnürschuhe bisher zu ihrem Sitz auserkoren haben, hat mir der vielgewandte Knudsen herausgehoben; ein Auswaschen der Höhlung mit Sublimat erscheint mir dabei immer ganz angebracht. Die Neger haben ein anderes Desinficiens, sie füllen die Öffnungen mit Wurzelgeschabsel; in einem winzigen Makuadorf am Steilabhang des Plateaus südlich von Newala sah ich eine Frau,[S. 308] die den Raum unter den Nägeln prophylaktisch mit Wurzelpulver ausstopfte. Ob es der Alten etwas nützen wird, wer weiß es.
Der Rest der vielen kleinen Hindernisse, die uns hier das Dasein erschweren, wirkt mehr komisch als ernsthaft. In Ermangelung von etwas anderem Rauchbaren greifen Knudsen und ich jetzt zu dem Inhalt einer vom Inder in Lindi bezogenen Zigarrenkiste. Diese ist sehr schön beklebt und aufgemacht, aber wehe dem Unglücklichen, der sich, wie wir, mit ihrem Inhalt befaßt! Ob diese schwelenden Giftnudeln Opium oder ein anderes Narkotikum enthalten, von uns beiden weiß es niemand zu sagen, denn nach dem zehnten Zuge sind wir beide „matt“; dreiviertel betäubt und hundeelend liegen dann Wiking und Deutscher in sich zusammengesunken da. Langsam erholt man sich — was geschieht? Nach einer halben Stunde greift man doch wieder zu dem scheußlichen Kraut; so unstillbar ist hier in den Tropen der Drang zum Rauchen!
Auch meine jetzigen Fieberanfälle sind kaum geeignet, noch ernst genommen zu werden. Ich habe ihrer hier in Newala nicht weniger als drei gehabt, aber alle mit unglaublich kurzem Verlauf. Emsig fragend, schreibend und notierend quäle ich mich mit meinen „Gelehrten“ herum, der starke Mittagskaffee hat die Lebensgeister mächtig angeregt; das Gehirn arbeitet außerordentlich intensiv, so daß die Arbeit rasch vorwärtsschreitet. Eine wohltuende Wärme durchrieselt den ganzen Körper, macht jedoch mit einem Male einem heftigen Kältegefühl Platz, das mich jetzt, beim wärmsten Sonnenschein, nachmittags 3½ Uhr, bereits zwingt, den Überzieher anzulegen. Jetzt arbeitet auch das Gehirn nicht mehr so scharf und logisch, besonders bei syntaktischen Feststellungen des schwierigen Imakuāni, der Sprache der Makua, an die ich mich zum Überfluß auch noch herangewagt habe. Da halte ich es denn doch allmählich für angezeigt, meine Temperatur zu messen, der Einfachheit halber gleich im Sitzen und ruhig weiterarbeitend; 38,6° ist das Ergebnis! Nun aber hinaus, meine Herren, heißt es im gleichen Augenblick! Wenige Minuten später steht mein Bett in der Barasa; unmittelbar darauf liege ich auch schon[S. 309] darin und beginne mich mit heißem Zitronenwasser innerlich zu behandeln. Drei Stunden später zeigt das Thermometer gegen 40°; ich lasse mich jetzt, beim Einsetzen des Abendwindes, mitsamt meinem Bett ins Zelt zurücktragen — würde ich meinen furchtbar schwitzenden Körper der eisigen Abendtemperatur aussetzen, so könnte das meinen Tod bedeuten —, liege dort noch eine kleine Weile und finde dann zu meiner Beruhigung, daß das Fieber nicht mehr steigt, sondern anfängt zurückzugehen. Das ist ungefähr 7½ Uhr; als ich kurz nach 8 Uhr noch einmal messe, ist die Kurve zu meinem maßlosen Erstaunen auf unter 37° heruntergegangen; mir ist absolut wohl; ich lese noch ein paar Stunden und könnte sehr wohl rauchen, wenn ich etwas Ordentliches hätte. Aber Inderzigarren? Pfui Teufel!
Wie ist so etwas denkbar? muß ich mich selbst als Laie fragen. Das kann doch unmöglich Malaria sein; näher liegt die Vermutung, daß diese rasch verlaufenden, hohen Fieberanfälle die Folge einer zu intensiven Sonnenbestrahlung sind, eine Art Insolationsfieber oder Sonnenstich. Wenn ich mein Fiebernotizbuch nachsehe, wird mir dies immer wahrscheinlicher, denn regelmäßig treten diese Anfälle im Anschluß an größere Strapazen und langen Aufenthalt in praller Sonne ein. Für mich haben diese kurzen Unpäßlichkeiten wenigstens das Gute, daß sie mich nur stundenweise von der Arbeit abhalten, denn am nächsten Morgen bin ich regelmäßig wieder vollkommen frisch und gesund.
Nicht so gut geht es leider meiner Perle von Koch und dem Knaben Moritz; jener leidet an einer ungeheuren Hydrozele, die ihm kaum erlaubt aufzustehen, Moritz aber hat Dunkelarrest wegen seiner entzündeten Augen. Leider versteht Knudsens Koch, ein bis vor wenig Wochen gänzlich unbeleckter Wilder von irgendwo aus dem Busch, noch weniger als mein Omari. Folge: Nils Knudsen ist selbst zum Koch avanciert. Er hat diese seine neue Tätigkeit sogleich mit einer großen Tat begonnen; da wir nichts Ordentliches mehr zu essen haben, hat er die vier von Matola erstandenen Ferkel, hübsch säuberlich in einen großen Tragkorb gepackt, von Chingulungulu[S. 310] heraufholen lassen und kaltblütig das größte von ihnen gemordet. Den ersten Schweinebraten haben wir leichtsinnigerweise doch Knudsens wildem Koch anvertraut; er war infolgedessen ungenießbar; den Rest des Tieres haben dann wir zu einem Gelee verarbeitet, das uns nach den langen Wochen der Unterernährung herrlich mundet und von dem wir mittags und abends geradezu fabelhafte Portionen vertilgen. Wenn nur nicht die ewigen Teltower Rübchen dabei wären! O du gesegnete Stadt auf märkischem Sande, wer hätte je geahnt, daß du so nachhaltig in die Ernährung eines stillen, deutschen Gelehrten eingreifen würdest! Dieser boshafte Dr. Jaeger! Er war ein Mann von Zeit und Muße; ihm halste daher die Landeskundliche Kommission die Besorgung aller Nahrungsmittel für seine und meine Expedition auf. Feierlich überweist mir eines schönen Tages in Daressalam der mit der Verpackung dieser Sachen betraute Handlungsbeflissene meinen Anteil. Seitdem leide ich unter einer ständigen Rübenfurcht; ich habe das Gericht an sich ganz gern, aber nur einmal im Jahre, ungern häufiger. Doch wie ergeht es mir hier? Ich trete an die Kiste heran, die gerade leergegessen werden muß; der Deckel fliegt hoch; ein Griff hinein, eine Konservenbüchse kommt zum Vorschein; ein Blick auf die Etikette: Teltower Rübchen. Puh! Die Dose verschwindet; ein zweiter Griff; dasselbe Ergebnis; ein dritter, nichts anderes. Nach langem Suchen erst kommt dann ein anderes Gemüse zutage; oder auch nicht, denn diese anderen sind allmählich zu Ende gegangen, nur die Teltower sind geblieben! „Denn helpt dat nich“, sage ich mit Fritz Reuter; aber zehn Jahre lang esse ich zu Hause keine Teltower mehr!
Bei all diesem kleinen Leid, das aber nun einmal dazu gehört, um Afrika schmackhaft zu machen, gibt es wenigstens ein erfreuliches Moment: Nils Knudsen hat mit der Geschicklichkeit eines Feinmechanikers meinen 9 × 12-Apparat wieder in Ordnung gebracht oder ihn doch wenigstens so weit wieder hergestellt, daß ich ihn mit einiger List gebrauchen kann. Wie der Mann ohne Fingernägel[S. 311] mit dieser kniffligen Arbeit hat fertig werden können, bei der er den ungemein komplizierten Momentverschluß nur mit Hilfe eines plumpen Schraubenziehers auseinandernehmen und wieder zusammensetzen mußte, ist mir noch heute schleierhaft, aber er hat es geschafft. Der Mangel an Fingernägeln hingegen zeigt den guten Nils von einer Seite, die mit seiner bei der Apparatreparatur bewiesenen Intelligenz merkwürdig kontrastiert, die andererseits allerdings auch aufs innigste mit seinem zehnjährigen Hinterwäldlertum zusammenhängt. Wäscht er da eines Tages in Lindi irgendeinen Köter. Dieser muß wohl eines schärferen Reinigungsmittels bedürftig gewesen sein, denn Nils hat ein Gefäß mitbekommen, dessen Inhalt stark und kräftig riecht. Gewissenhaft nimmt unser Freund die Reinigung vor, wundert sich ein wenig, daß sie dem Hunde sehr schlecht bekommt, ist dann aber sehr erstaunt darüber, daß ihm seine eigenen zehn Fingernägel im Laufe weniger Tage wegeitern. „Wie kann ich aber auch wissen, daß man Karbolineum verdünnen muß“, knurrt er oftmals noch jetzt entrüstet, wenn er seine schrecklich zugerichteten Fingerenden sorgenvoll mustert!
Weit und breit haben wir die Umgegend durchschweift, seitdem wir in Newala hausen; zunächst alter Gewohnheit gemäß, sodann aber, weil der Akide Sefu mit der Zusammenstellung seines Gelehrtenkollegiums durchaus nicht so rasch fertig geworden ist, wie er sich zuerst anheischig gemacht hatte. Aber das schadet weiter nicht, denn auch bloß von außen gesehen, sind Land und Leute interessant genug.
Das Makondeplateau gleicht einer großen, rechtwinkligen, an den Ecken abgerundeten Tafel; es ist, vom Indischen Ozean bis Newala gemessen, etwa 120 Kilometer lang und im Mittel zwischen dem Lukuledi und dem Rovuma gegen 80 Kilometer breit; es umfaßt also gegen zwei Drittel der Fläche des Königreichs Sachsen. Nun ist diese Fläche nicht horizontal, sondern von ihrem Südwestrande flach, aber ganz gleichmäßig gegen den Ozean hin geneigt. Von der Schwelle, auf der Newala liegt, kann man viele Meilen über den Makondebusch nach Osten und Nordosten schauen, ohne einem Hindernis zu begegnen;[S. 312] es ist ein grünes Meer, aus dem nur hie und da dichte Rauchwolken in langer Erstreckung emporwirbeln und -wallen, zum Zeichen dafür, daß auch hier Menschen wohnen und daß sie ihre Feldkultur ganz nach der Weise so vieler anderer Naturvölker vorwaltend auf die Verbrennung des niedergeschlagenen Holzbestandes gründen. Dessen Asche ist zugleich die einzige Düngung. Selbst am strahlend hellen Tropentag ist so ein Brand ein großartiges Schauspiel.
Ungleich weniger wirkungsvoll ist der Eindruck, den gegenwärtig die große Ebene vom Plateaurand aus erweckt. Sooft es mir meine Zeit gestattet, unternehme ich den kleinen Ausflug an diesen Rand, bald hierhin, bald dahin, stets in der stillen Hoffnung, endlich einmal eine klare Luft mit weiter Aussicht vorzufinden; immer aber vergebens: wohin man dort unten schaut, allerorten steigen Rauchwolken hoch, der lebhafteste Beweis für die unausgesetzte Tätigkeit des Waldbrennens; rauchig und dunstig ist auch die ganze Luft. Schade drum, das Panorama von hier bis weit hinten an die Madjedjeberge muß unter günstigeren Umständen wirklich großartig sein. Jetzt haben photographische Aufnahmen eigentlich kaum einen Zweck, die Profilzeichnung aber gibt nur einen sehr schwachen Begriff der ganzen Szenerie.
Bei einem dieser Ausflüge habe ich mich absichtlich selbst einmal am Makondebusch versucht. Der Plateaurand von heute ist das Ergebnis einer ungeheuer tiefgreifenden Zerstörung durch Erosion und Abrutschung; überall greifen kurze, aber Hunderte von Metern tiefe Täler in die Makondeschichten ein. Eine Folge des lockeren Gefüges dieser Formation ist es, daß nicht nur die Seitenwände dieser Täler fast senkrecht abstürzen, sondern daß die Täler auch mit einer ebenso steilen Rückwand enden; dergestalt ist der Westrand des Makondeplateaus von lauter Talkesseln umsäumt. Um von einer Seite eines solchen Kessels auf die andere zu gelangen, habe ich mich eines Tages mit einem Dutzend meiner Leute durch den Busch geschlagen. Es war eine sehr lichte Stelle, mit mehr Gras als Buschwuchs; aber welche Mühe hat dieser Weg von ein paar hundert Metern gekostet,[S. 313] und wie sahen wir alle nachher aus! Die dünnen Kattunstoffe meiner Leute in Fetzen, sie selbst aus hundert kleinen Wunden blutend; sogar unsere derben Khakistoffe hatten den Dornen dieser Vegetationsformation nicht standgehalten.

Meine seit langem gehegte Ansicht über die Entstehung dieses Makondebusches hat sich immer mehr befestigt: er ist ohne Zweifel kein Naturprodukt, sondern erst die Folge der menschlichen Kultur. Wohin der Mensch hier oben auf dem Hochland noch nicht mit Hacke und Axt gedrungen ist — ein halbwegs geübtes Auge sieht dies ohne weiteres —, da steht auch heute noch ein wirklicher, wunderschöner Hochwald, der den Vergleich mit unserem deutschen Mischwald sehr wohl aufzunehmen vermag. Wo der Mensch aber jemals seine Hütte gebaut und sein Feld beackert hat, da entsteht hinterher dieser gräßliche Busch. Geht man auch nur ein paar Stunden irgendwo auf dem Hochland die Barrabarra entlang, so hat man vollauf Gelegenheit, diese Metamorphose in jeder Phase ihrer Entwicklung zu verfolgen. Seitwärts tönt hallender Axthieb herüber, nicht bloß von einer Stelle,[S. 314] sondern über einen ganzen Komplex verteilt. Wenige Schritte weiter sieht der Wanderer, was vorgeht; wohl meterhoch und höher liegt das niedergeschlagene Unterholz geschichtet; zwischen ihm aber ragen als letzte Säulen alter Pracht die Stämme des Hochwaldes. Doch auch sie gewähren ein Bild des Jammers; der böse Makonde hat sie geringelt, d. h. er hat sie ringsherum in breitem Bande der Rinde beraubt, so daß sie dem Absterben verfallen sind; zudem hat er noch eine Reisigpyramide um sie aufgebaut. Unverdrossen hacken Vater und Sohn, Mutter und Schwiegersohn im Hintergrunde weiter; kaum daß das sonst so neugierige Volk nach dem weißen Fremdling aufschaut. Und kommt dieser Fremdling eine Woche später desselben Weges gezogen, verschwunden ist das Reisig, verschwunden sind die Pyramiden; eine dicke Aschenschicht lagert, wo vor kurzem noch grünender Wald sich breitete. Die starken Bäume aber recken ihre noch immer glimmenden, schwelenden Stämme und Äste in stummer Anklage zum Himmel, oder aber sie sind bereits niedergebrochen, mehr oder minder zu Asche verglüht und zeichnen sich dann als weißer Streifen auf dunklem Grunde ab.
Das ist der Zerstörungsprozeß, den der Makonde in gleicher Weise am jungfräulichen Urwalde wie auch an den Stellen seines Heimatlandes vornimmt, wo er vor Jahren schon einmal geackert hat, nur daß er im letztern Fall des Verbrennens der großen Bäume überhoben ist. Diese gibt es in der sekundären Buschformation nicht mehr.
In das gebrannte und mit der Hacke gelockerte Stück Waldland sät der Eingeborene sein Getreide, pflanzt er sein Gemüse. Im ganzen Lande hat er Beetkultur. Diese erfordert eine sorgsame Pflege, die ihr der Neger auch zuteil werden läßt; Unkraut wird im Süden Deutsch-Ostafrikas nicht geduldet. Mißernten kommen wohl im trockneren Tiefland vor, auf dem niederschlagreicheren, allmorgendlich taufeuchten Hochland sind sie ganz unbekannt. Dessen glückliche Bewohner sind sogar in der angenehmen Lage, die sonst so stolzen Yao und Makua von unten bei sich als Diener und Knechte zu sehen. Hunger[S. 315] tut weh, und so ziehen es die Angehörigen jener beiden Völkerschaften vor, einmal eine Zeitlang da den Diener zu spielen, wo sie sonst zu herrschen gewohnt sind.
Jedoch der leichte sandige Boden ist bald erschöpft, er würde bei einer nochmaligen Bestellung keine Ernte mehr ergeben. Dies weiß der Eingeborene seit Jahrtausenden; längst hat er vorgearbeitet und den Komplex nebenan mit Axt und Feuerbrand urbar gemacht. Auf ihn siedelt er nunmehr mit seinen mannigfachen Kulturen über; das alte Feld wird zur Brache. Doch nur ganz kurze Zeit liegt es wüst und greulich anzusehen da, dann kommt Allmutter Natur und nimmt ihr mißhandeltes Kind liebevoll in ihre Obhut; tausendfältig sprießt es allerorten aus dem ausgesogenen Boden hervor, selbst die alten Baumstrünke schlagen von neuem aus. Im nächsten Jahr ist der Neuwuchs bereits mehr als kniehoch; rasch wuchert er in die Höhe; nach wenigen Jahren schon ist er jener undurchdringliche, schreckliche Busch, der erst wieder fällt, wenn der schwarze Herr des Landes seinen Turnus beendigt hat und an die alte Stelle zurückkehrt.
Mit diesem Busch sind die Makonde mit Leib und Seele verwachsen, ja nach meinen Yaogewährsleuten bedeutet sogar ihr Name nichts anderes als Buschvolk. Nach ihrer eigenen Tradition sitzen die Makonde zwar schon seit langen, langen Zeiten hier oben, aber zu meiner Überraschung legten sie doch eine sehr starke Betonung auf eine ursprüngliche Einwanderung. Diese sei von Südosten, von der Rovumamündung und von Mikindani her erfolgt; der Anlaß dazu sei die ewige Beunruhigung ihrer friedlichen Vorfahren durch die kriegerischen Schirasi der Küste und die fortgesetzten Raubzüge der Sakalaven von Madagaskar herüber gewesen; vor diesen hätten sich die Ur-Makonde auf das unzugängliche Plateau zurückgezogen. Ich bin in der Völkerkunde Afrikas auf Grund einer 20jährigen Beschäftigung mit ihr sehr wohl bewandert, aber daß Bevölkerungsvorgänge in diesem so friedlich und ruhig erscheinenden Erdteile sogar durch von außen kommende Hochsee-Unternehmungen bedingt und veranlaßt worden seien,[S. 316] war mir doch im ersten Augenblick etwas vollkommen Neues. Es wird indessen schon seine Richtigkeit haben. Warum jedoch die Makonde gerade im dicksten Busch und weit vom Plateaurand ab wohnen müssen, und warum sie nicht an die rieselnden Quellen der Niederung selbst zu dauerndem Wohnsitz herniedersteigen dürfen, das lehrt aufs klarste ihre wunderhübsche Stammessage. Auch noch manch anderes Lehrreiche steht darin.
„Die Geburtslandschaft des Stammes, mit Namen Mahuta, ist auf der Südseite des Plateaus zum Rovuma hin gelegen; dort aber stand nur dichter Busch. Aus diesem Busch hervor ging ein Mensch, der sich niemals wusch und schor, der nur wenig aß und trank. Der ging aus und machte ein Menschenbildnis aus dem Holze eines Savannenbaumes, nahm es mit sich in seine Buschwohnung und stellte es dort aufrecht hin. Während der Nacht erwachte das Bildnis zum Leben, und es war ein Weib. Daraufhin gingen sie zusammen hinunter zu den Wassern des Rovuma, um sich zu waschen. Hier gebar das Weib ein Kind, welches jedoch nicht lebend zur Welt kam. Sie verließen das Land und zogen über die Hochländer bis in das Tal des Mbemkuru, wo sie sich niederließen. Dort gebar das Weib abermals ein Kind, das wiederum tot zur Welt kam. Daraufhin kehrten sie in die hochgelegene Buschlandschaft Mahuta zurück, und dort wurde das dritte Kind geboren, welches nach der Geburt am Leben und gesund blieb. Mit der Zeit zeugten sie noch viele, viele Kinder und hießen sich Wamatanda. Diese bildeten die Stammfamilie der Makonde, auch Wamakonde genannt, d. h. Urbewohner. Der Stammvater, der Buschmensch, aber gab seinen Kindern das Gesetz, daß sie ihre Toten aufrecht begraben sollen zum Andenken an die erste Mutter, die aus Holz geschnitzt und aufrecht stehend zum Leben erwacht sei; ferner warnte er seine Kinder, in die Täler und an die großen Wässer zu ziehen, denn dort wohne die Krankheit und der Tod. Als Regel solle gelten, daß mindestens eine Stunde Weges sei von der Hütte bis zum Wasserplatze; dann würden ihre Kinder gedeihen und von Krankheiten verschont bleiben.“
[S. 317]

Die Erklärung des Namens Makonde lautet bei meinen Gewährsleuten etwas anders als bei Pater Adams, dessen kleinem, aber inhaltreichem Büchlein: „Lindi und sein Hinterland“ ich diese Stammessage der Makonde entnehme. Aber sonst stimmt mein Befund genau mit dem sachlichen Inhalt dieser Stammessage überein. Waschen? Hapana, gibt es nicht. Wozu auch? Zudem ist das Wasser spärlich und reicht kaum zum Kochen und Trinken; von den anderen tut es ja auch keiner; warum soll also gerade ich so unangenehm auffallen? Scheren aber ist bei dem kurzen, krauswolligen Haarwuchs kaum vonnöten; also auch dieser Vorschrift des Urahnen ist leicht zu folgen. Damit aber hört das, was uns lächerlich dünkt, auf. Von einer Reihe hiesiger Künstler habe ich eine ziemlich große Anzahl stattlicher, 40 bis 60 Zentimeter hoher Holzskulpturen erworben, die allesamt Frauen aus der großen Völkergruppe der Mavia, Makonde und Wamatambwe darstellen; die Figuren sind merkwürdig gut gearbeitet und geben den Frauentypus vortrefflich wieder, vor allem auch die später noch zu schildernde Verschönerung des Körpers mit Ziernarben. Über Zweck und Bedeutung ihrer Werke befragt, wußten die Künstler nichts Plausibles anzugeben, oder aber, was ich heute für wahrscheinlicher halte, sie wollten nicht. Also:
Ehrlich gestanden, ich habe diesen ins Ethnographische variierten alten Vers beim Empfang jener Figuren laut in den sonnendurchglühten Tropentag hinausgesprochen, aber ich habe wohlweislich nicht danach gehandelt. Einstweilen mußte ich mich mit der kargen Angabe eines der Künstler begnügen, die Figuren gäben lediglich das „nembo“[S. 318] wieder, die Körperverunstaltung durch Lippen- und Ohrscheiben und Ziernarben. Mit der Adamsschen Sage jedoch rücken diese Figuren ohne weiteres in ein anderes Licht, sie sind doch mehr als zwecklose Kostümpuppen, ja man darf dreist annehmen, daß sie, wenn auch der Mehrzahl der heutigen Makonde unbewußt, Darstellungen jener Urmutter sind. Diesmal wäre der alte Vers also doch angebracht gewesen, denn die Urmutter gehört ebenso in den Kreis des hiesigen Eingeborenenkultus wie die Ahnen überhaupt.
Auf die Vorgeschichte des Volkes bezieht sich in der Stammessage unzweifelhaft zunächst der Hinweis auf den Abstieg von Mahuta hinunter zu den Wassern des Rovuma, sodann der andere auf die Wanderung über die Hochländer bis in das Tal des Mbemkuru; beide Wanderungen des Urelternpaares bedeuten in Wirklichkeit wohl Wanderungen des Volkes selbst. Der Abstieg in das nahe, an seinen Rändern außerordentlich fruchtbare und wildreiche Rovumatal ist ohne weiteres verständlich; doch auch das Überschreiten der Lukuledisenke, der Aufstieg zum Rondoplateau und der erneute Abstieg zum Mbemkuru liegen durchaus innerhalb des Bereichs der Wahrscheinlichkeit, denn alle diese Gebiete weisen genau dieselben Naturbedingungen auf wie der äußerste Süden.
Nun kommt aber etwas gerade für unser „bakterielles“ Zeitalter höchst Interessantes. Die Ur-Makonde sind in den sumpfigen Flußniederungen ihres Lebens nicht froh geworden, Krankheiten waren bei ihnen an der Tagesordnung, und viele starben; erst nachdem sie wieder nach Mahuta in die Heimat zurückgekehrt waren, besserte sich der Gesundheitszustand des Volkes. Wir sehen im Neger gern und mit Vorliebe den naturfremden und naturfürchtigen Dümmling, dem alles Ungemach von bösen Geistern und Naturgewalten herrührt. Viel richtiger wird es sein, hier anzunehmen, daß die Leute malariadurchseuchte und malariafreie Gebiete sehr bald haben unterscheiden lernen. Diese Erkenntnis schlägt sich dann nieder in der Warnung des Urvaters, nicht wieder in die Täler und an die großen Wässer zu[S. 319] ziehen, denn dort wohne die Krankheit und der Tod. Um aber auch gleichzeitig vor den bösen Mavia auf der Südseite des Rovuma gesichert zu sein, wird noch bestimmt, daß jede Siedelung um einen Minimalabstand von jenem Steilrand abliegen solle. So wohnen sie heute noch.
Sie wohnen so auch ganz gut, jedenfalls besser und geschützter als die Makua, die modernen Eindringlinge des Südens, die hier auf dem Westrande des Plateaus in ziemlich breiter Zone Fuß gefaßt haben. Von der Stattlichkeit der Yaohäuser unten in der Ebene und besonders in Massassi, Susa und Chingulungulu hat weder die Behausung der Makua, noch die der Makonde etwas an sich. Jumbe Chauro, ein an der Barrabarra nach Mahuta unweit Newala gelegener Makondeweiler, ist von allen mir bisher bekannten Siedelungen des Stammes noch der bei weitem stattlichste; seine Hütten sind auch recht geräumig. Doch wie ruppig ist ihre bauliche Ausführung gegenüber den fast eleganten Palästen der Elefantenjäger in der Ebene! Das Dach ist noch verwahrloster, als es in der Trockenzeit hier überall Usus ist; an den Wänden nur hie und da die kümmerlichen Anfänge oder die kläglichen Reste eines Lehmbewurfs; das Innere aber eine wahre Hundehütte; Schmutz, Staub und Unordnung überall; von Zimmereinteilung ist nur in wenigen Hütten etwas zu merken, und dann ist sie auch nur durch ganz liederlich zusammengeflickte Bambuswände hergestellt.
Nur in einem habe ich hier einen Fortschritt feststellen können, in der Methode des Hausverschlusses. Diese ist im ganzen Süden bei aller Einfachheit sinnreich; die Tür besteht stets aus derben Stangen von Bambus oder Holz, die mit dem uns schon bekannten Bindemittel des Baumbastes an zwei Querriegel gebunden werden; auch die Drehung um den einen Türpfosten erfolgt in zwei Schleifen, und zwar nach innen. Will der Bewohner sein Haus verlassen, so nimmt er zwei derbe Stangen her, oberarmdick und etwa 1,5 Meter lang. Die eine lehnt er von innen schräg gegen die Mitte der Tür, so daß sie einen Winkel von 60 bis 75 Grad mit dem Erdboden bildet; dann nimmt er die andere Stange, dreht sie horizontal und drückt sie[S. 320] mit aller Kraft auf die erste Stange hernieder. Dabei helfen ihm zwei andere kräftige Pfeiler, die in einigem Abstand einwärts von den Türpfosten stehen; sie sind das Widerlager für die Horizontalstange. Der Verschluß ist absolut sicher; nur läßt er sich natürlich nicht bei beiden Haustüren, der Vorder- und Hintertür, ausführen. Denn wie sollte der Besitzer sonst in das Haus hineingelangen? Ich bin aber einstweilen noch nicht über den Hintertürverschluß unterrichtet.
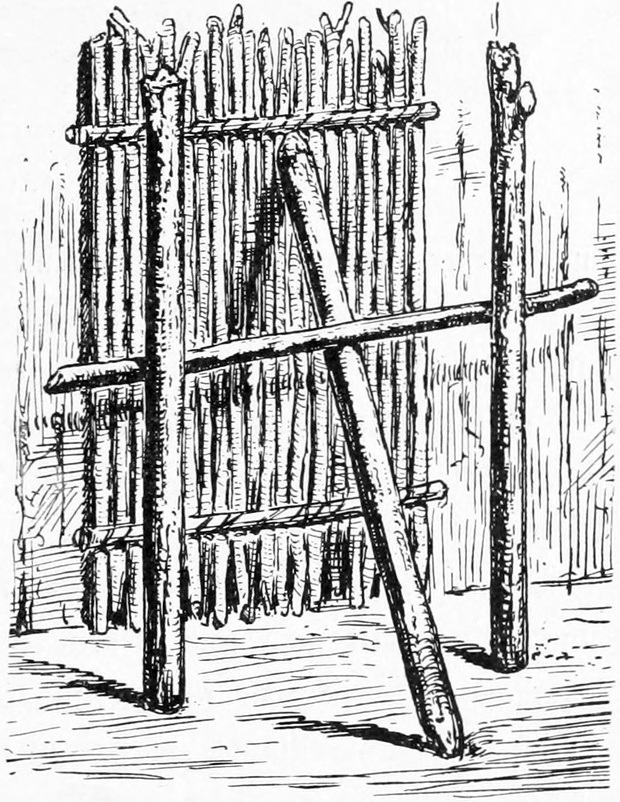
Das ist also der Universalverschluß. Derjenige der Makonde von Jumbe Chauro ist viel feiner, gediegener und origineller. Auch hier ist in bezug auf die Tür alles wie sonst, nur steht an ihrer Innenseite ein einzelner Pfahl etwa 15 Zentimeter von der Türkante ab frei im Hüttenraum; in der Hüttenwand aber befindet sich an dieser Stelle ein Loch, gerade groß genug, um den Arm hindurch zu stecken. Der Tag ist heiß gewesen, nun aber will es Abend werden; still und verlassen liegt das Makondedörfchen im dichten Busch verborgen da. Es ist vollständig menschenleer, denn die ganze Einwohnerschaft ist zu Schmaus und scharfem Umtrunk ins Nachbardorf geladen. Jetzt nahen sich schlürfende Schritte, der Hausvater und die Seinen kehren zurück; sie sind zum nicht geringen Trost für alle diejenigen Blaßgesichter, die aller Abstinenzbewegung zum Trotz noch immer gern ihr Gläschen Bier genehmigen, in keiner anderen Verfassung, als man sich nach einer schweren Sitzung auch bei uns befindet. Nur singt der Makonde nicht; Africa non cantat; in dieser Beziehung wird er also nie ein guter Deutscher werden! Jetzt kommt das Knifflige. Der Negerpapa hat natürlich die Pflicht, das Haus zu öffnen. O ihr Göttinger Semester, wie klar steht ihr wieder vor meiner Seele mit eurem unermeßlichen Hausschlüssel, für den kein Schneider die Taschen groß genug machen konnte, für dessen Last selbst die hintere Hosenschnalle eigens verstärkt werden mußte! Größer als du, unerläßliches Requisit froher Scholarenzeit, ist das Format auch kaum, das der alte Neger aus irgendeinem Versteck zum Vorschein bringt, nur Gestalt und Material sind anders[S. 321] als am Leinestrand. Eisen ist eine plebejische Erfindung fremder, hergelaufener Völker, der Makonde bleibt nach wie vor beim Holz; und wirklich geschickt findet er sich damit ab: der Schlüssel ist ein etwa 30 Zentimeter langer, etwas geschweift gearbeiteter Stab mit abgesetztem Griff; der Bart hat drei derbe Zapfen, die gleich lang sind und in ein und derselben Ebene liegen. Etwas unsicher — auch wieder à la Göttingen — sucht Papa das Schlüsselloch, pardon, das Loch in der Wand. Das hat er vermöge seiner Größe bald entdeckt. Mit nicht unberechtigtem Stolz wagt er einen schüchternen Blick nach hinten, wo Mama, den unvermeidlichen Sprößling im Rückentuch, geduldig — sie ist ja heute mitschuldig — der Lösung des Problems harrt. Diese ist wirklich nicht ganz leicht, die Pombe war gut und der Tag war heiß; merkbar zittert die sonst so ruhige schwarze Hand, als der alte Herr beginnt, die Öffnung für den Schlüssel zu suchen. Schon hebt sich, einem Entenschnabel gleich, die siebenzentimetrige Lippenscheibe der holden Gattin zu scharfer Aufmunterung, da ist das große Werk endlich gelungen, das feine, rechteckige Loch in dem freistehenden Pfeiler ist gefunden; rack, rack, rack, ein dreimaliges rasches Heben und Senken des Schlüssels, schon zieht er einen langen Riegel hinter sich her und quer durch den Pfeiler hindurch. Dieser Riegel hatte mit seinem kolbenförmigen freien Ende sich fest gegen die Innenseite der Tür gestemmt, sie dadurch hermetisch verschließend; jetzt ist der[S. 322] kluge Neger gekommen, hat mit seinem Schlüssel im Innern jenes Pfeilers in senkrechten Nuten laufende Klötzchen gehoben und hat damit den Verschluß gelöst; leicht und frei gleitet der Riegel zurück.
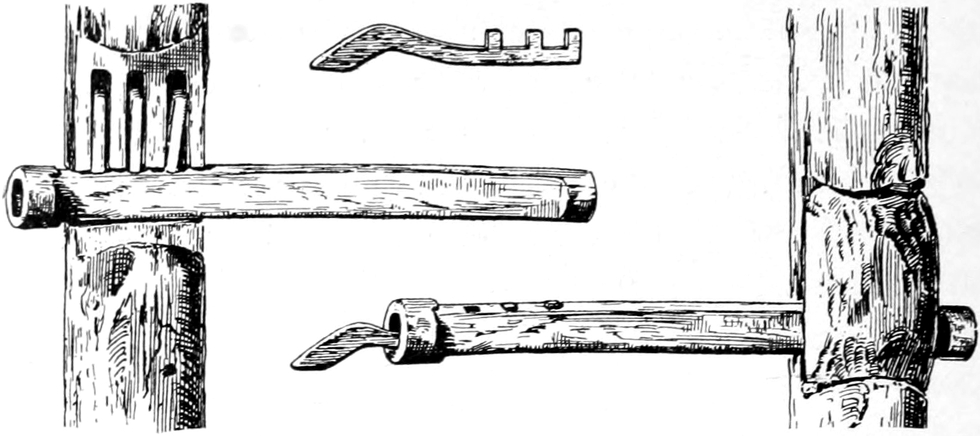
Mit nicht geringem Selbstbewußtsein hat mir erst ein Hausvater diese größte Erfindung des Hochlandes an Ort und Stelle vordemonstriert, und dann ein anderer; beide Male habe ich ein bewunderndes „Msuri sana, sehr schön!“ ausgerufen und den Wunsch geäußert, diese Wunderdinge mit nach dem fernen Uleia zu nehmen, um dort den Wasungu zu zeigen, was für tüchtige Kerle die Makonde seien. Noch bin ich keine fünf Minuten in meinen Windfang von Newala zurückgekehrt, da keucht es auch schon heran; im selben Augenblick senken sich zwei stattliche Bäume vor meinen Augen nieder, und feierlich, wie nach siegreicher Belagerung, überreichen mir zwei stark schwitzende Gestalten die Schlüssel zum Tor der gefallenen Feste. Zum Schlüssel gehört auch das Schloß, hatten die beiden Kommandanten ganz logisch gedacht; ein Griff nach der Axt, krachend fliegt das scharfe, dem trocknen, zähen Tropenholz gegenüber jedoch zu weiche Eisen in die Basis des schloßtragenden Pfeilers hinein. Den Pfahl aus dem Boden auszugraben und ihn dergestalt intakt herbeizuschaffen, das war den beiden Intelligenzen nicht eingefallen. So liegen die Stücke halb zertrümmert vor mir, und statt einer Belobigung bekommen die beiden Besitzer noch Schelte.
[S. 323]
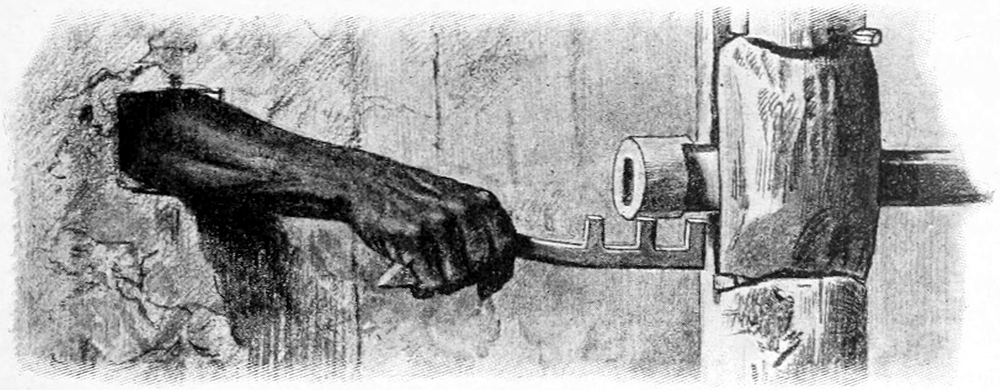
Die Makuahütten sind in der Umgebung von Newala besonders kümmerlich; in ihrer mehr als liederlichen Bauart erinnern sie mich lebhaft an die Interimsbauten der Makua von Hatia; und dabei haben die hiesigen Vertreter des Stammes durchaus keinen Krieg mitgemacht. Es muß also wohl angeborene Faulheit sein, oder aber das Fehlen einer straffen Häuptlingshand. Selbst die Barasa von Mlipa, eine kleine Stunde südöstlich von Newala, nimmt an dieser allgemeinen Verwahrlosung teil; während sonst die öffentlichen Bauten hierzulande stets der Gegenstand einiger Sorgfalt sind, läuft sie sichtlich Gefahr, vom ersten besten kräftigen Oststurm umgewirbelt zu werden. Von einigem Reiz in dem ganzen weiten Siedelungsdistrikt ist lediglich das Grab des verstorbenen Häuptlings Mlipa selbst. Ich habe es in den ersten Vormittagsstunden einmal besucht, wo noch brauende Nebel mit der durchbrechenden Sonne kämpften; da sah der kreisrund angelegte Hain haushoher Euphorbien, die nebst einem zerbrochenen Tongefäß allein noch von der Ruhestätte des alten Negerkönigs zeugen, fast weihevoll aus. Auch meine sonst so materiell und realistisch veranlagten Träger mochten so etwas fühlen, denn sie sangen heute nicht ihre gewohnten Schelmenlieder, sondern feierlich klang es, als wir von dannen zogen, in den dichten, grünen Makondebusch hinein und über ihn hinaus weithin den Steilabhang hinunter:
[S. 324]

„Wir werden schon ankommen mit dem großen Herrn; wir stehen in der Reihe und haben keine Angst, unser Essen und unser Geld vom Serkal, der Regierung, zu bekommen. Wir sind nicht ängstlich; wir gehen zusammen mit dem großen Herrn, dem Löwen, zur Küste und kehren zurück.“
[S. 325]
In bezug auf den Habitus der verschiedenen Stämme hier auf dem Westrande des Plateaus komme ich zu keinem anderen Ergebnis als dem bereits in der Ebene gewonnenen: es ist für einen Nichtanthropologen unmöglich, es dem einzelnen direkt anzusehen, welches Stammes er sei. Ich glaube aber, auch für den Anthropologen von Fach möchte diese Unterscheidung schwer sein, selbst auf Grund der peinlichsten Untersuchung; die ganze große Völkergesellschaft hier im Osten des Erdteils, zwischen dem großen zentralafrikanischen Graben, dem Tanganyika und dem Nyassa im Westen und dem Indischen Ozean im Osten, ist nun einmal eng miteinander verwandt; manche ihrer Sprachen unterscheiden sich nur dialektisch; die Stämme werden zweifellos dieselbe Schädelbildung und denselben Knochenbau besitzen; von auffallenden äußeren Stammesunterschieden kann da unmöglich die Rede sein.
Und selbst wenn sie beständen, hätte ich keine Zeit und Muße, mich mit ihnen zu befassen, denn welch ungeheure Fülle von ethnographischen Erscheinungen allein ist es, die Tag für Tag auf mich einstürmt, die gesehen oder gehört, in beiden Fällen aber begriffen, aufgezeichnet und niedergeschrieben sein will. Fast könnte ich es als ein Glück bezeichnen, daß wenigstens einzelne Forschungsgebiete durch äußere Umstände brachgelegt worden sind. Da ist vor allem das Gebiet der Eisentechnik. Afrika gilt sonst als ein Erdteil, wo der Eisenstein sozusagen auf der Straße liegt und wo es verwunderlich erscheinen möchte, wenn seine Bewohner nicht zur Verhüttung des überall anstehenden Materials gelangt wären; tatsächlich reicht ja auch die Kenntnis des Eisenschmelzens vom Nordrand bis zu den Kaffern.
Hier zwischen Rovuma und Lukuledi liegen die Verhältnisse nicht so günstig. Raseneisenstein oder eine andere Eisenverbindung ist, wie die Makonde erzählen, ihnen nicht bekannt; sie und ihre Vettern, die Wamatambwe, sind demgemäß nicht bis zur Technik des Eisenschmelzens fortgeschritten, sondern haben seit jeher ihre Eisengeräte von den Nachbarstämmen kaufen müssen. Aber auch den[S. 326] Bewohnern des Tieflandes ist es nicht leicht gemacht worden. Nur ein einziger Fundi, ein alter Mann am Huwe, jenem steilwandigen Granitklotz, der sich einsam mitten aus der weiten, grünen Einöde zwischen Massassi und Chingulungulu erhebt und dessen zackiges, wild zerklüftetes Haupt den Wanderer überall grüßt, steht im Ruf, als letzter der Lebenden noch die Kunst des Eisenschmelzens zu bewahren. Schon von Massassi aus wollte ich den Mann in seiner Tätigkeit studieren; doch da hieß es: er ist aus Angst vor dem Aufstand über den Rovuma gegangen; er kommt indes bald wieder. Seitdem habe ich immer wieder gefragt: Ist er denn nun endlich da, der Fundi? „Bado“, hieß es dann urecht afrikanisch.
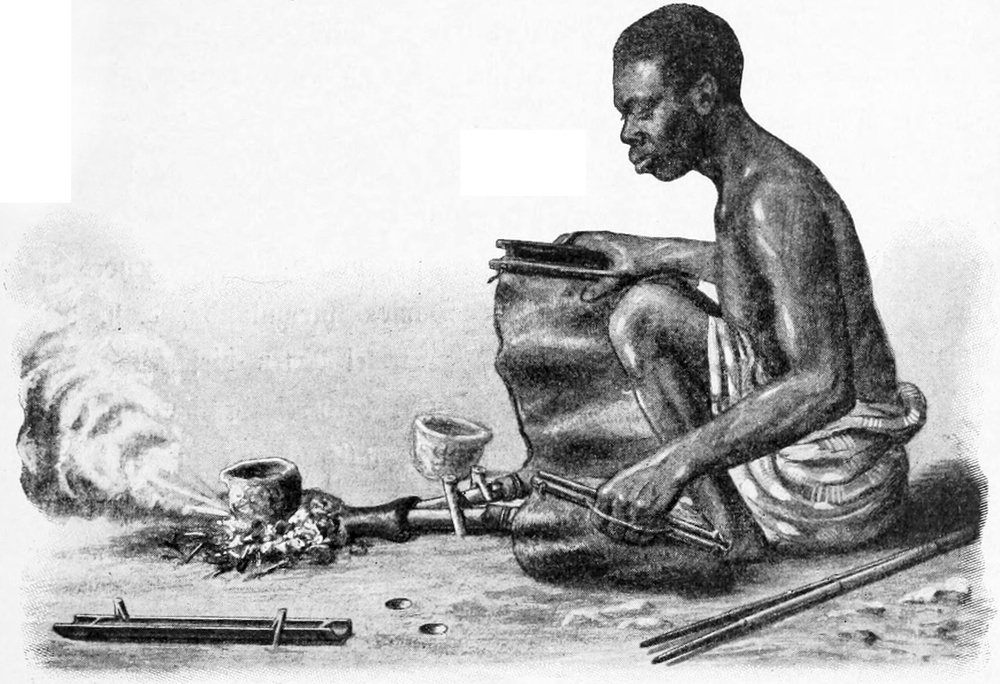
Einen gelinden Trost hat mir dafür ein Gelbgießer gewährt, den ich im Walde von Akundonde erwischte. Der Mann ist der Liebling der Frauen und also wohl auch der Götter; er fabriziert aus goldgleißendem Messing, das er um schnöden Mammon von der Küste erhandelt, jene massiven, wuchtigen Fuß- und Handknöchelringe, die an den schlanken Gliedern der Schönen meine staunende Bewunderung stets von neuem erregen. Wie jeder ordentliche Meister trug der Mann sein gesamtes Handwerkszeug bei sich: 2 Blasebälge, 3 Schmelztiegel, 1 Hammer, das war alles. Bitten ließ er sich nicht lange; eins, zwei, drei waren die beiden Blasebälge am Boden befestigt. Es sind einfache Ziegenbälge, deren Extremitäten durch einen Knoten in sich verschlossen sind, während die obere, für die Luftzufuhr bestimmte, weite Öffnung von zwei Holzleisten eingefaßt wird. Am anderen Ende des Balges ist eine schmale Öffnung gelassen; in dieser steckt eine Holzröhre. Rasch hat der Fundi aus der nächsten Hütte einen Haufen Holzkohlen erborgt; schon hat er auf die Mündungen der zwei Holzröhren — es kommen stets zwei Blasebälge zur Anwendung, um einen dauernden Luftstrom zu erzielen — eine Tondüse gesetzt; mit einem derben Schlag treibt er einen Holzhaken über den Holzröhren in die Erde. Jetzt füllt er den einen seiner kleinen, bereits stark verschlackten Tontiegel mit dem gelben Material,[S. 327] setzt ihn ins Zentrum des Kohlenherdes, der einstweilen nur schwach glimmt, und dann beginnt die Arbeit. In raschem Wechsel fahren die Hände des Fundi mit den Schlitzen der Blasebälge auf und nieder; hebt er die Hand, so spreizt er den Schlitz breit auseinander, so daß die Luft ungehindert in den Fellsack hineintreten kann; drückt er die Hand nieder, so schließt er den Sack, und fauchend bläst die Luft durch Bambusrohr und Düse in das rasch erstarkende Kohlenfeuer. Doch der Mann bleibt nicht bei der Arbeit; schon hat er einen andern herangewinkt, der ihn beim Blasen ablöst. Im Gleichtakt sausen die Hände auf und nieder, der Fundi aber hat aus seinem Rucksack, einer großen Felltasche, noch ein paar Werkzeuge geholt; mit Verwunderung sehe ich, wie er zunächst mittels eines glatten, fingerstarken Rundstabes ein paar Löcher senkrecht in den reinen Sand des Waldbodens drückt. Dies mag nicht schwer sein, gleichwohl entwickelt der Mann dabei bedeutende Sorgfalt. Darauf ein rasches Niederknien,[S. 328] ein paar Schläge auf ein paar kleine Holzhaken; an den Boden genagelt sehe ich eine kleine, niedliche Mulde. Ein Stück Bambusrohr ist es, der Länge nach halbiert, so daß die beiden Endknoten den Miniaturtrog abschließen. Endlich ist das gelbe Metall flüssig genug; mit zwei langen, durch Aufsplittern zangenartig gegabelten Stäben hebt der Fundi den Tiegel vom Feuer: eine kurze, rasche Wendung nach links, ein Neigen des Tiegels, unter Zischen und starker Rauchentwicklung fließt das Metall zunächst in die Bambusform, sodann in die Erdlöcher.
Das Verfahren dieses hinterwäldlerischen Meisters mag technisch nicht auf der Höhe stehen; es läßt sich indes nicht leugnen, daß er mit den geringsten und einfachsten Mitteln vollkommen Ausreichendes zu erzeugen versteht. Die vornehmen Damen hierzulande, d. h. die, welche es sich leisten können, tragen zweierlei Arten dieser schweren, massiven Messingringe: eine im Querschnitt halbkreisförmige und eine kreisrunde. Jene erzeugt der Fundi in genialster Weise in der Bambusform; Peripherie: rund, Oberfläche: horizontal; die andere in seinem kreisrunden Sandloch. Das Anlegen an die Gliedmaßen seiner Kundinnen ist einfach; mit leichten Schlägen seines Hammers legt der Meister das biegsame Metall ohne weitere Belästigung für die Trägerinnen um Arm und Knöchel herum.
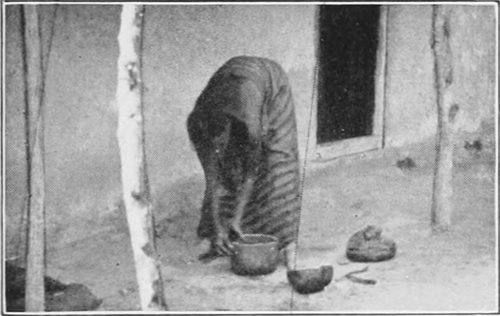







Eine Technik, die immer und überall das Interesse jedes Kulturhistorikers erwecken muß, eben weil sie so eng einesteils mit der Kulturentwicklung der Menschheit zusammenhängt, sodann weil gerade die Rekonstruktion unseres eigenen vorgeschichtlichen Kulturbildes sich in hohem Grad auf ihre Reste stützt, ist die Töpferei. Mit Vergnügen denke ich an die zwei oder drei Nachmittage zurück, wo in Massassi Salim Matolas schlanke, freundliche Mutter mir mit rührender Geduld die keramischen Künste ihres Volkes in konkretem Beispiel erläutert hat. Ist das ein urwüchsiges Verfahren! Einzige Hilfsmittel: in der Linken ein Patzen Ton, in der Rechten eine Kürbisschale mit folgenden Kostbarkeiten als Inhalt: dem Fragment eines[S. 329] ausgelutschten Maiskolbens, einem taubeneigroßen, eiförmigen, glatten Kiesel, ein paar Stückchen Flaschenkürbis, einem handlangen Bambussplitter, einer kleinen Muschelschale und einem Päckchen eines spinatartigen Krautes. Das ist alles. Mit der Muschel kratzt die Frau in den weichen, feinen Sandboden ein kreisrundes, flaches Loch. Inzwischen hat eine frische Negermaid das Kürbisgefäß mit Wasser gefüllt; die Frau fängt nun an, den Klumpen zu kneten. Wie durch Zauberhand entwickelt sich dieser zu einem zwar rohen, aber doch immerhin bereits formenreinen Gefäß, das lediglich einer kleinen Nachhilfe mit jenen Instrumenten bedarf. Gespannt habe ich nach irgendwelchen Anfängen der Drehscheibe ausgeschaut; hapana, gibt es nicht. Ruhig und fest steht der Topfembryo in jener kleinen Vertiefung; tiefgebückt umwandelt ihn die Frau, ganz gleich, ob sie mit dem Maiskolben die größeren Unreinlichkeiten, kleine Steine und dergleichen entfernt oder Innen- und Außenfläche mit dem Bambussplitter glättet, ob sie später, nach eintägiger Trockenzeit des werdenden Gefäßes, mit zugeschliffenem Kürbisstück die Ornamente einsticht oder den Boden ausarbeitet; ob sie mit scharfem Bambusmesser den Rand schneidet, oder das nunmehr fertige Gefäß noch einer letzten Revision unterzieht. Unendlich mühselig ist dieses Frauengeschäft, aber es ist zweifellos ein getreues Spiegelbild des Verfahrens, wie es auch unsere neolithischen und bronzezeitlichen Vorfahren geübt haben.
Die Frau hat das unschätzbare Verdienst, die Erfinderin der Töpferei zu sein. Rauh, roh und rücksichtslos schweift die Männerwelt des Wildstammes durch das Gefilde; mit vereinter List haben die Jäger soeben das Wild zur Strecke gebracht; keinem fällt es ein, die Beute zum Wohnplatz zu schaffen. Schon prasselt, vom kraftvoll gequirlten Bohrstab hervorgerufen, ein helles Feuer zu ihrer Seite; kunstgerecht ist das Tier ausgeweidet und zerlegt; bald wird es als knapp angerösteter Braten hinter den scharfen Zähnen der Männer verschwinden; an Frau und Kind denkt niemand von der Schar.
[S. 330]
Frau und Kind! Kommt, laßt uns unseren Kindern leben! erschallt der Ruf von der einen Seite; ehret die Frauen! von der anderen. Das gilt aber nur von uns, die wir auf diesem Gebiet wirklich die Träger höchster Vollkultur sind. Wie jammervoll und kläglich hat sich dagegen die Urfrau und noch mehr die Urmutter durchhelfen müssen! Ewig nur den Küchenzettel, den eine zwar gütige, aber doch auch nur einseitige Natur darbietet, das hält nicht einmal ein Urmagen aus! Von irgendwo hat Frau Urahne Kunde von den wohltätigen Wirkungen heißen Wassers auf die Mehrzahl altbewährter, aber doch schwer verdaulicher Gerichte erhalten. Die Nachbarin hat es auch versucht. Die sonst so harten Knollenfrüchte hat sie in einer mit Wasser gefüllten Kalebasse — oder war es ein Straußenei, oder gar ein schnell improvisierter Rindenzylinder? — über Feuer gehalten, da wurden sie viel weicher und schmeckten viel besser als vorher; leider aber hat das Gefäß nicht ausgehalten, sondern ist dabei elendiglich von außen verkohlt. Dem kann mit Leichtigkeit abgeholfen werden, denkt sie, und schon hat sie eine Schicht bildsamer, nasser Erde um ein ähnliches Gefäß herumgestrichen. Nunmehr geht es besser, das Kochgefäß bleibt unversehrt, nur hat es sich in dem heißen Feuer in seiner Umhüllung gelockert. Also herunter damit! Ein Griff, ein Ruck, Kern und Hülle sind getrennt — die Töpferei ist erfunden!
Doch zu einer verständnisvollen Benutzung der hartgebrannten Tonhülle selbst hat vielleicht ein um ein weniges anderer Weg geführt. Straußeneier und Kalebassen gibt es nicht überall auf der Erde, dagegen hat der Mensch es überall verstanden, sich aus biegsamen Bestandteilen, Rinde, Bast, Blattstreifen, Ruten und dergleichen, Behälter für seinen Haushalt herzustellen. Auch unsere Erfinderin hat kein wasserdichtes Naturgefäß. „Macht nichts; streichen wir den Korb von innen aus.“ Auch so geht es; aber o weh, das Korbgeflecht verbrennt über dem hellodernden Feuer jämmerlich; immer ängstlicher schaut die Frau dem Kochprozeß zu; sie befürchtet jeden Augenblick ein Leck, aber nichts von alledem. Das Gericht ist geraten und mit[S. 331] besonderem Appetit verzehrt; halb neugierig, halb befriedigt wird das Kochgefäß gemustert. Der vordem so bildsame Ton ist jetzt steinhart geworden, zudem sieht er gut aus, denn das nette, saubere Geflecht des so schmählich verbrannten Korbes zeichnet sich in hübschen Mustern auf ihm ab. So ist mit der Töpferei gleichzeitig auch ihre Ornamentik erfunden worden.
Wir sind heute galant; aber wären wir es auch nicht, eine tiefe Verbeugung geziemte der Frau auch aus dem folgenden Grunde. Der schweifende Mann ist der Entdecker der willkürlichen Feuererzeugung; mit kraftvollem Arm zaubert er den göttlichen Funken aus jedem Astwerk hervor. Das kann ihm die Frau nicht nachtun. Sie ist dafür Vestalin von Urzeit herauf; nichts verursacht so viel Sorge wie die Erhaltung des glimmenden Spans. Und nun gar im Lager erst. Die Männer sind fern. Drohend ballen sich schwere Regenwolken zusammen; schon fallen die ersten dicken Tropfen; wirbelnd rast der Sturm über die Ebene daher. Unruhig zuckt das kleine Flämmchen des glimmenden Astes, das der Frau seit jeher mehr Sorge bereitet als das eigene Kind. Was tun? Ein blitzschneller Gedanke, rasch steht eine primitive Hütte, aus Rindenstücken gefertigt, da; noch immer zuckt zwar die Flamme, doch die Gefahr des Verlöschens in Regen und Wind ist glücklich abgewandt.
Einem solchen oder einem ähnlichen Vorgang ist zweifelsohne die Erfindung des Hauses im Prinzip zu danken; sie der Frau abzusprechen, hat selbst der hartgesottene Weiberfeind nicht das Recht. Der Schutz des glimmenden Herdfeuers gegen das unfreundliche Walten der Natur ist das Hauptmotiv zu Weiterentwicklung der menschlichen Behausung. Der Mann ist an diesem Fortschritt kaum beteiligt, oder doch erst sehr spät. Noch heute ist im ganzen Osten Afrikas das Bestreichen der Hauswand mit Lehm ausschließlich Sache der Frau, wie die Herstellung aller Tongefäße; zwei Überbleibsel, aber zwei sehr bezeichnende. Auch unser europäischer Gemüsegarten ist ein solches gutes, altes Reliquienstück aus den Anfängen höherer menschlicher[S. 332] Wirtschaft, die ich mit dem Einsetzen der Kochkunst beginnen lasse; er interessiert noch heute den deutschen Hausherrn wenig, er geht ihn genetisch ja auch gar nichts an, denn auch er ist eine Erfindung der Frau. Mochten die schweifenden Männer ihr rohgeröstetes Fleisch selbstsüchtig in rauher Tafelrunde unter sich vertilgen, ihr blieb die nette, kleine Auswahl grünender Kräuter und rauschender Ähren, die sie im Laufe der Jahre als genießbar und schmackhaft herausgefunden hatte. Im Wesen ist es noch heute so; selbst das Urgerät dieser alten Beetkultur, die Hacke, steht bei diesem Zweig unseres Feldbaues noch in vollem Gebrauch.
Die edelste Errungenschaft aber, die wir dem anderen Geschlecht verdanken, ist doch die Technik und die Kunst des Kochens selbst. Nur das Rösten ist eine alte Kunst, eine von den Männern der Natur bequem abgelauschte zudem; der vom vernichtenden Waldbrand angeschmorte Kadaver des von der raschen Flamme überholten Tieres hat ihnen den Hinweis gegeben. Das Kochen, d. h. der Veredelungsprozeß organischer Stoffe unter Zuhilfenahme des zum Sieden gebrachten Wassers, ist eine weit jüngere Errungenschaft. Sie ist so jung, daß sie selbst heute noch nicht einmal überall hingedrungen ist; versteht doch der Polynesier wohl zu dünsten, d. h. sein Gericht, sauber in Blätter gewickelt, im Erdloch zwischen heißen Steinen unter Luftabschluß und hie und da unter Besprengung der heißen Steine mit etlichen Tropfen Wassers garzumachen, aber kochen kann er nicht. Ehre sei also der Frau und Dank für alle diese Wohltaten, mit denen sie die werdende Menschheit überhäuft hat!
Jedoch nie hat die böse Männerwelt der Frau das alles gedankt. Noch heute ist sie die Hüterin des Herdes, ganz gleich, ob dieser die Hütte des Negers, den Wigwam des Indianers, den Pfahlbau des Malaien zum behaglichen, von Mann und Kind erstrebten Mittelpunkt des täglichen Lebens gestaltet. Im Dunkel Afrikas und in den Urwäldern Amerikas hat sie freilich noch heute das zweifelhafte Vergnügen, Haus und Küche nicht nur zu erhalten und zu besorgen, sondern[S. 333] auch beide im wesentlichen selbst herzurichten; doch schnöde, undankbar und pietätlos hat die moderne Kultur die Frau aus der keramischen Werkstätte verbannt. Und wenn es die höchste Betätigung kulinarischer Kunst gilt, so ist auch da nicht mehr die Frau die berufene Trägerin dieses Könnens, sondern, uneingedenk ihrer alten Verdienste, stellen wir Köche an und erniedrigen die Frau zur bloßen Hilfeleistung. Wir sind ein undankbares Geschlecht.
Die schlanke Wanyassafrau hat nach einem letzten, prüfenden Blick den fertiggeformten Topf zum weiteren Trocknen in den Schatten gestellt. Als sie mir am nächsten Tage durch ihren stets gegenwärtigen Sohn Salim Matola entbieten läßt, sie wolle das Gefäß jetzt brennen, da erblicke ich sie beim Heraustreten aus meinem Hause schon eifrig beschäftigt. Sie hat eine Schicht daumenstarker, sehr trockner Knüppel auf die Erde gebreitet, den matt gelbgrauglänzenden Topf daraufgesetzt und umtürmt ihn nunmehr mit weiterem Geäst. Hilfreich und entgegenkommend überreicht ihr mein treuer Pesa mbili, der Trägerführer, den schon bereitgehaltenen Feuerbrand; unter beiderseitigem Blasen fachen sie den Stoß unter dem Winde an; schon zuckt die Flamme empor, da übertragen sie den Brand auch auf die Luvseite. Bald ist das Ganze ein einziges Feuermeer. Doch rasch verzehrt sich der trockne Stoff, der Stoß sinkt in sich zusammen, glühend ragt aus ihm das Gefäß hervor; mit langem Scheit wird es von der Frau gewendet, bald so, bald so, damit es gleichmäßig erglühe. Bereits nach 20 Minuten rollt sie das Kunstprodukt aus dem Aschenhaufen heraus, ein Griff nach dem Spinatbündel, das zwei Tage lang in einem Wassertopf gelegen hat; ein Schwung wie mit einem Weihwedel; laut zischen die Tropfen auf dem glühenden Ton auf. An die Stelle des gleichmäßigen Braunrots sind jetzt regellos verteilte schwarze Flecke getreten.
Mit einem Seufzer der Erleichterung und mit sichtlicher Befriedigung hat die Frau sich emporgereckt; sie steht genau in einer Linie mit mir und der Flamme. Eine Rauchwolke steigt empor; ein Druck[S. 334] auf den Gummiball der Kamera, es knipst, die Apotheose ist gelungen — eine Priesterin ihres erfinderischen Geschlechts, so steht die schlanke Frau da, zu Füßen das Feuer des Herdes, den sie uns geschenkt; zur Seite die Erfindung, die sie für uns gemacht; im Hintergrunde das Heim, das sie uns errichtet!

Auch in Newala habe ich mir die Herstellung keramischer Erzeugnisse vorführen lassen. Technisch war das Verfahren besser, denn hier kennt man bereits die ersten Anfänge der Drehscheibe, die es im Tiefland anscheinend nicht gibt; wenigstens habe ich keine gesehen. Von der Herstellung einer Vertiefung zur Aufnahme des zu bildenden Gefäßes sieht die Künstlerin, eine furchtbar stumpfsinnige Makuafrau, ab; dafür rückt sie mit einer großen Topfscherbe an, die sie mit einer gewissen Wichtigkeit an der improvisierten Arbeitsstelle niedersetzt. Auf dieser Scherbe entwickelt sich alles weitere in ziemlich den gleichen Bahnen wie bei Salims Mutter, nur daß die Töpferin hier des mühseligen Herumlaufens um das Gefäß enthoben ist; in aller Bequemlichkeit kauert sie dabei und läßt Topf und Scherbe um sich selbst rotieren; es ist also der Anfang einer Maschine. Aber wollt ihr glauben, daß der Topf etwa dadurch regelmäßiger und schöner geworden sei? Freilich ist er schön rund und ganz ansehnlich geworden, aber alle die zahlreichen großen und kleinen Gefäße, die ich in den „rückständigen“ Gebieten gesehen und zum Teil auch gesammelt habe, sind es nicht minder. Wir modernen Menschen bilden uns immer ein, um Hervorragendes schaffen zu können, seien Präzisionsinstrumente nötig. Geht hin in die prähistorischen Museen und Sammlungen und seht euch die Töpfe, Urnen[S. 335] und Schalen unserer Vorfahren aus grauer Vorzeit an, dann werdet ihr sofort eines Besseren belehrt sein!
Heute ist fast die ganze Bevölkerung Deutsch-Ostafrikas in eingeführte Kattune gekleidet. Dem war nicht immer so; noch heute gibt es im Norden einige Gebiete, wo das gewalkte Tierfell als Bekleidungsstoff vorherrscht, im Nordwesten aber, östlich und nördlich vom Tanganyika, liegt eine Zone, wo Rindenstoffe auch heute noch nicht ganz verdrängt sind. Nur wenige Generationen mag es her sein, daß solche Rindenstoffe neben Fellschurzen auch im ganzen Süden das einzige Bekleidungsmaterial gewesen sind. Auch heute ist dieses leuchtend rote oder fahlgelbe Material noch massenhaft vorhanden; will man es aber sehen, so muß man schon in die Vorratsbehälter, auf die Trockengerüste und in die Hütten der Eingeborenen kriechen; dort führt es ein bescheideneres Dasein, nämlich nur noch als Packmaterial für besonders sorgsam zu behandelnde Sämereien und Früchte. Auch das Salz von Massassi wird in große Rindenstoffstücke geschlagen und in ihnen kunstgerecht für den Ferntransport verpackt.





Wo es irgend ging, habe ich auch die Technik der Herstellung dieses Stoffes studiert. Mit einem zwei bis drei Meter langen, schenkeldicken Knüppel kommt der bestellte schwarze Mann an; sonst trägt er weiter nichts als einen merkwürdig gestalteten Hammer und das übliche lange, scharfe und spitze Messer, das alle Männer und Knaben, ohne Scheide horribile dictu! — auf dem Kreuz im Gürtel tragen. Stumm läßt er sich vor mir nieder; mit zwei raschen Skalpierschnitten hat er im Abstand von zwei Meter den mitgebrachten Baum umzirkt, dann fährt er mit der Spitze des Messers auf dem Baum lang dahin. Mit sichtlicher Sorgfalt hebt er rings um den Stamm mit Hilfe des Messers die äußere Borke ab, so daß nach Verlauf einer guten Viertelstunde die erstrebte innere Schicht sich leuchtend zwischen den unberührt gebliebenen Stammenden heraushebt. Mit einiger Mühe und vieler Vorsicht löst er die Rinde an dem einen Ende ab, er öffnet den Zylinder;[S. 336] sodann steht er auf, ergreift den freigewordenen Rindensaum mit beiden Händen und zieht dem langen Knüppel langsam, aber mit Nachdruck das Fell über die Ohren. Ich erwarte, der so grausam Geschundene möchte achtlos beiseite geworfen werden; das geschieht aber nicht, sondern er wird belassen, wo er liegt. Für den Künstler beginnt nun die mühsame Arbeit des Säuberns; er schabt alle überflüssigen Borkenteile von der Außenseite des langen, schmalen Rohstoffes ab und unterzieht ihn auch auf der Innenseite[S. 337] einer sehr vorsichtigen Durchsicht nach Fehlstellen. Jetzt endlich geht’s an das Klopfen; auf einen Wink hat ihm ein Freund eine Schale mit Wasser zur Seite gestellt; mit diesem feuchtet der Künstler das ganze Stück ein, greift darauf nach seinem Hammer, legt das eine Ende des Stoffes auf die glatteste Stelle des entrindeten Baumes und hämmert langsam, aber stetig darauflos. Höchst einfach, denke ich, das würdest du sicher auch können; später aber werde ich anderer Meinung: das Klopfen ist doch eine Kunst, falls es nicht zu einem Zerklopfen werden soll. Um das zu verhüten, faltet der Künstler den Rohstoff mehrfach der Quere nach und bildet dergestalt eine mehrfache Lage, die dem Zerschlagen der Fasern entgegenwirken soll. Endlich ist der gewünschte Endzustand erzielt; entweder ergreift der Fundi allein den immer noch gefalteten Stoff an beiden Enden und ringt ihn tüchtig durch, oder er ruft einen Gehilfen herbei, der ihn bei dieser Schlußarbeit unterstützt. Das so entstandene Zeug ist lange nicht so fein und regelmäßig wie der berühmte Rindenstoff von Uganda, aber es ist immerhin schön weich und vor allen Dingen billig.
Jetzt sehe ich mir auch den Hammer an; mein Künstler verfügt über die einfachere, aber bessere Form: auf dem Hammerstiel steckt als wirksame Masse ein derber Holzkegel, dessen breite Basis, die Schlagfläche, kreuz und quer mit mehr oder minder derben Riefen versehen ist. Bei der ursprünglichen Form ist der Kegel ebenso gestaltet, aber er ruht in einem kunstvoll verflochtenen System von Baststreifen, die ihn an einem aufgespaltenen Bambusstab als Stiel befestigen. — Die völkerkundliche Erfahrung, daß alte Sitten und Gebräuche sich am längsten im Kult und im Kinderleben erhalten, finden wir auch bei diesem Rindenstoffe bestätigt; wie ich sehr bald erzählen werde, wird er noch während des Unyago getragen, nachdem er unter bestimmten Zeremonien höchst feierlich erzeugt worden ist; auch legt manche Mutter, wenn sie sonst nichts hat, ihrem Sprößling noch hie und da ein Rindenschürzchen an. Das sieht dann viel schöner und weit afrikanischer aus als der lächerliche Lappen aus Uleia.
[S. 338]
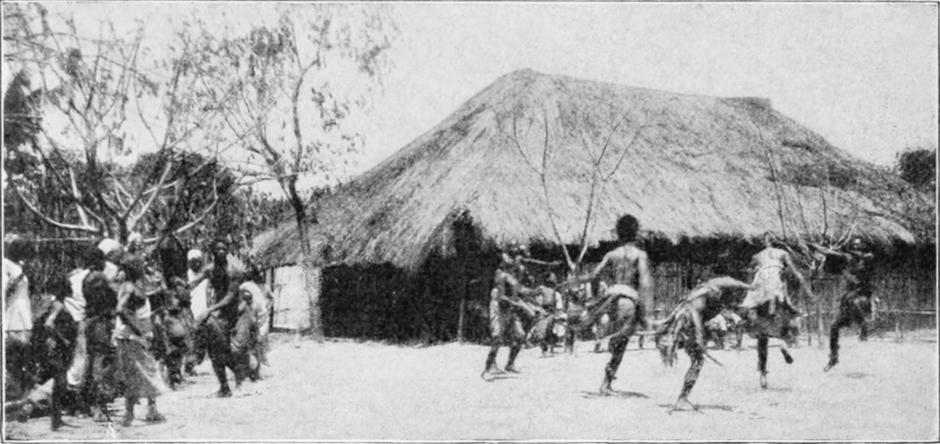
Newala, Anfang Oktober 1906.
Ein paar Tage lang hat es geschienen, als wolle unser deutscher Altweibersommer vom fernen Uleia aus uns hier oben einen Besuch abstatten, so frisch-kühl schien die Sonne auf Weiße und Schwarze hernieder, und so windstill war es um unsere Barasa. Jetzt aber umbraust wieder der altgewohnte eisige Novemberost die Boma von Newala, und geregnet hat es gerade am Michaelistage auch schon. Das muß wohl ein hierzulande allgemein verstandenes Signal für jung und alt gewesen sein, denn weder die unvermeidlichen Knaben belagern mich, noch kehren auch meine Gelehrten wieder. Erfreulicherweise habe ich die alten Herren im Laufe der letzten Wochen so auspressen können, daß ich schon jetzt, im unanfechtbaren Besitz einer Unsumme von Aufzeichnungen und Notizen, vollauf befriedigt von dannen pilgern könnte, hielten mich nicht die Sprachaufnahmen, in die ich mich nun einmal verbissen habe, noch für eine kurze Spanne zurück. Ganz[S. 339] unmöglich ist es, an dieser Stelle auch nur die knappste Skizze von dem zu geben, was ich, der nunmehr wissend Gewordene, von allen diesen mehr oder minder seltsamen Sitten und Gebräuchen in mein vor Glückseligkeit jauchzendes Gemüt aufgenommen habe. In amtlichen und nichtamtlichen Schriften, zu denen ich sicherlich die Muße manchen Semesters werde opfern müssen, ist der Platz für alle Einzelheiten; was ich hier bringen kann, darf und will, ist lediglich ein Hervorheben gerade dessen, was vermöge seiner Eigenart jeden Kulturmenschen fesseln kann und wohl auch wird.
Ein unbegrenztes Forschungsfeld sind die hiesigen Personennamen. Wo der Islam bereits Fuß gefaßt hat, herrscht auch die arabische Benennungsweise; da marschiert neben dem Makonde-Askari Saidi bin Mussa sein Kamerad vom Nyassasee Ali bin Pinga, und hinter dem Yaoträger Hamisi zieht Hassani aus Mkhutu seines Weges fürbaß. Bei den Binnenstämmen waltet als soziales Prinzip die Sippeneinteilung vor; daher tritt selbst noch zu dem Vornamen der zum Christentum Bekehrten der Name des Clans. Daudi (David) Machina nennt sich der schwarze Pastor von Chingulungulu, und Claudio Matola heißt der präsumtive Nachfolger Matolas I. und Matolas II. Über diese Namen des Innern gleich mehr.
Ebenso fesselnd wie die Namen selbst ist oftmals ihre Bedeutung; schon meine braven Träger haben mir in dieser Richtung manch fröhliche Minute verursacht; sie führen zum großen Teil auch gar zu drollige Bezeichnungen. Pesa mbili, Herr Zweipfennig in deutscher Währung, ist uns ebensowenig ein Fremder mehr wie seine Freunde Kofia tule, der lange Mann mit dem flachen Käppchen, Herr Kasi uleia, der Mann, der beim Europäer Arbeit nimmt, und Herr Mambo sasa, die „Sitte von heute“. Mambo sasa ist und bleibt für mich die lebendige Illustration zu meiner mitgenommenen Phonographenwalze aus der „Fledermaus“, die ihr „Das ist nun mal so Sitte“ wohl aus dieser Ideenassoziation heraus jetzt häufiger ertönen lassen muß als früher. Außer diesen Getreuen laufen unter[S. 340] meinen zwei Dutzend schwarzen Kameraden noch folgende Gentlemen herum: Herr Decke (Kinyamwesi: Bulingeti, verderbt aus dem englischen blanket); Herr Cigaretti (bedarf keines Kommentars); Herr Kamba uleia (keck, aber sehr frei übersetzt: du deutscher Strick); Herr Berg oder Hügel (Kilima), und die Herren Kompania und Kapella. Ins Seemännische fallen die Namen Maschua (Boot) und Meli (vom englischen mail, das Dampfboot); ins Arithmetische Herr Sechs (Sitta). Den würdigen Beschluß macht Mpenda kula, Herr Freßsack.
Den Namen der Binnenstämme fehlt der merkbare europäische Einschlag dieser Trägernamen, doch spaßig will uns auch hier mancher erscheinen. Ich bemerke dabei, daß diese Namen durchweg nicht die ersten sind, die ihren Träger zieren; wie sooft bei Naturvölkern, auch heute noch bei den Japanern, haben wir auch hier die Erscheinung, daß jeder einzelne im Anschluß an die erlangte und festlich begangene Mannbarkeit einen neuen Namen bekommt. Den hiesigen Eingeborenen ist die ursprüngliche Bedeutung dieses Wechsels nicht oder nicht mehr bekannt, doch geht man wohl nicht fehl in der Annahme, daß die neue Benennung auch einen neuen Menschen bedeutet; jede Erinnerung an den alten Adam ist damit ausgelöscht, der neue Mensch aber steht in ganz anderem verwandtschaftlichen Verhältnis zu seinen Angehörigen und Stammesgenossen als der frühere. Offiziell ist jeder erwachsene Yao, Makua, Makonde oder Matambwe berechtigt, sich als Pate anzubieten, doch erweckt mir die Mehrzahl der Namen den Eindruck, als seien sie in Wirklichkeit Spitznamen, die ihrem Träger gelegentlich aus dem Bekanntenkreis anfliegen; der Neger hat bekanntlich ein sehr feines Gefühl für die Schwächen und Blößen des anderen.
Chelikŏ́sue, Herr Ratte, ist uns von seinen Heldenliedern von Chingulungnlu her schon bekannt; zu ihm gehört der Namenklasse nach Chipembēre, Herr Nashorn. Dieser neigt zum Jähzorn wie jener Dickhäuter, daher sein Name. An die ursprüngliche Stammeszugehörigkeit, nämlich zu den Wandonde, erinnert der Name des alten Biervertilgers Akundonde. Der Sieger im Gefecht ist Chekamĕ́nya;[S. 341] Freude herrschte über die Geburt des Machīna; Makwenja rafft alles an sich; Chemduulăgá macht hingegen wenig aus sich, er ist die verkörperte Bescheidenheit. Ebenso ist Mkotima ein ruhiger Mann; Siliwindi ist nach dem gleichnamigen guten Sänger unter den Vögeln des Landes genannt; Mkokora endlich trägt den Schmutz mit den Händen weg.
Das sind Wayao-Männernamen. Von den Frauennamen dieses Stammes will ich nur folgende hervorheben: Frau Chemā́laga; sie ist ganz allein zurückgeblieben, alle ihre Angehörigen sind gestorben; Frau Chechelajēro, die es immer schwer hat; Frau Chetulāye, die schlecht lebt, und schließlich Chewaŏ́pe, sie ist dein.
Die Personennamen der übrigen Völker sind im großen ganzen desselben Charakters: Kunanyupu, Herr Gnu, ist ein alter Makua, der nach seiner eigenen Aussage in seiner Jugend viele Gnus erlegt hat; Nantiaka ist der Don Juan, der von einer zur andern flattert. Geistesverwandt ist Ntindinganya, der Spaßvogel, der anderen in die Schuhe schiebt, was er selber ausgeführt hat; Linyongonyo ist der Schwächling ohne Kraft, Nyopa aber der Ehrgeizige, der danach strebt, daß andere ihn fürchten; Madriga ist der Betrübte, der Hypochonder; Dambuala der Faule.
Unter den Frauen ist Aluenenge die Selbstbewußte; ihr Herr und Gebieter hat sich zwar noch ein zweites Weib genommen, aber bei der wird er, das weiß Aluenenge ganz bestimmt, nicht bleiben, sondern reuevoll zu ihr zurückkehren. Weit weniger glücklich ist Nantupuli dran; sie läuft in der Welt herum, bekommt aber nichts, weder einen Mann, noch sonst etwas. Wieder zur Kategorie der Unglücklichen gehören dann Atupimiri und Achinaga; jene besitzt einen Mann, der wenig seßhaft ist; immer ist er auswärts, nur von Zeit zu Zeit kommt er, um seine Frau zu „messen“, d. h. zu sehen, ob sie sich gut oder schlecht beträgt. Achinagas Mann aber ist stets krank und kann nicht arbeiten; so muß sie alles allein machen. Eine Pesa mbili gibt es auch unter den Makondefrauen; „früher stand ich hoch,“ so besagt[S. 342] der Name, „in der Wertschätzung der Männer, jetzt aber bin ich nur noch zwei Pesa wert; ich bin alt geworden.“ Schönheit steht eben auch beim Neger im Preise.
Ein sehr dankbares, aber auch recht schwierig zu beackerndes Forschungsfeld ist für mich allerorten die Feststellung der Gebräuche, die den einzelnen in seinem Dasein von der Wiege bis zum Grabe begleiten.
In der mütterlichen Hütte ist das kleine Negerkind, das noch gar nicht schwarz, sondern ebenso rosig aussieht wie unsere Neugeborenen, zur Welt gekommen; der Herr Vater ist weit vom Schuß; ihn haben die weisen Frauen beizeiten gehen heißen. Säuberlich wird das Baby gewaschen und in ein Stück neuen Rindenstoffes gewickelt. Dabei salbt man seine Ohren mit Öl, damit es hören soll; das Bändchen unter der Zunge aber löst man mit dem landesüblichen Rasiermesser, damit es sprechen lerne. Knaben werden wie überall gern gesehen; in bezug auf Mädchen verhalten sich die Stämme und, genau wie bei uns, auch die einzelnen Familien verschieden. In der Völkerkunde ist oft zu lesen, daß die Naturvölker die Geburt von Mädchen aus rein mammonistischen Gründen freudig begrüßten, brächten doch die erwachsenen Mädchen dem Elternpaar bei der Heirat den Kaufpreis ein. Bis zu einem gewissen Grade mögen derartige Momente auch hierzulande mitspielen, im allgemeinen aber sind Mädchen schon deswegen gern gesehen, weil sie der Mutter bei den mannigfachen Arbeiten in Haus und Feld frühzeitig an die Hand gehen können. Nach ihrer Verheiratung wird der Herr Schwiegersohn zudem zum treuesten, unentgeltlichen Diener des mütterlichen Hauses. Hier, im Lande der Exogamie, der Außenehe, siedelt nämlich die junge Frau nicht mit in das Heim des Ehemannes über, sie tritt auch nicht in seine Verwandtschaft hinein, sondern gerade umgekehrt: der Mann verläßt Vater und Mutter und zieht entweder direkt ins schwiegermütterliche Haus oder baut sich doch unmittelbar daneben an; in jedem Fall aber sorgt er, bis seine eigenen Familienumstände es anders bedingen,[S. 343] mit voller Kraft jahrelang für die Erhaltung des schwiegermütterlichen Anwesens; er besorgt die Aussaat und die Ernte, macht neue Felder urbar, kurz, er sieht der Schwiegermama jeden Wunsch an den Augen ab. Er trägt sie auf Händen.

O, wie habe ich mich geschämt, sooft das Gespräch sich mit diesem und so manchem anderen Punkt des hiesigen Volkstums befaßte. Sind das nun Wilde, oder sind wir es? Blitzschnell genieße ich rückschauend 20, 30 Jahrgänge der „Fliegenden“ und noch einiger anderer Witzblätter; unsere Bilanz wird immer schlechter, immer passiver. Ich mit meinem flüchtigen Durchstreifen des Landes kann es ja nicht wissen, aber Knudsen, dieser vollkommen Eingelebte, mit der Denk- und Handlungsweise der Leute vollkommen Vertraute, bestätigt mir, sooft ich will, daß nicht nur das Verhältnis vom Schwiegersohn zur Schwiegermutter als geradezu ideal zu bezeichnen ist, sondern[S. 344] daß auch sonst das Benehmen der Jugend dem Alter gegenüber das Prädikat „musterhaft“ bekommen muß. Wir Angehörigen der höchsten Kulturschicht, oder, nach bei uns allgemein geteilter Ansicht, der Kulturschicht schlechthin, verbringen unser halbes Leben in den Erziehungsanstalten der verschiedensten Arten und Grade: das Endergebnis legt uns dann die Statistik dar: 0,x% Analphabeten in diesem Staat, 0,y% in dem benachbarten Reich, z% weiter im Osten, gegen Halbasien zu. Wir stehen natürlich obenan, denn wir haben ja den geringsten Prozentsatz. Du lieber Gott, wer Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören, der höre und schaue, aus wie wenig ethischem Empfinden und wieviel Rüpelei sich die Lebensbetätigung gerade unserer Kulturnationen zusammensetzt. Ich werde mich hüten, gegen unseren Unterricht und gegen unsere Schule etwas zu sagen, ich bin ja selber eine Art Schulmeister, aber bedenklich muß es doch stimmen, sehen zu müssen, wie wurmstichig so viele unserer Früchte trotz aller auf sie verwandten Sorgfalt sind, und wie ethisch gesund dagegen das Volkstum dieser Barbaren uns entgegentritt. Und das alles lediglich auf Grund eines Unterrichts von ganzen drei oder vier Monaten, eines Unterrichts zudem durch Lehrer, die weder eine Schule durchlaufen, noch sonst studiert haben!
Zwillingen gegenüber verhalten sich die hiesigen Völkerschaften verschieden; bei den Yao werden sie mit ungeteilter Freude begrüßt, bei den Makonde hingegen sieht man in ihrer Geburt etwas Schreckliches, das man für die Zukunft mit Hilfe von allerlei Medizinen abzuwenden sucht. Doch auch hier sind die Eltern nicht grausam genug, die einmal Geborenen umzubringen; man läßt sie am Leben und behandelt sie genau wie bei den Yao, d. h. man kleidet sie stets ganz gleich. Würde man von diesem Grundsatz abweichen, so würde unfehlbar eins der beiden Kinder sterben, so sagen die Leute.

Das erste Lebensjahr verfließt dem kleinen Negerkind in innigster Gemeinschaft mit der Mutter. Sie und ihr Neugeborenes zeigen sich schon nach einem Wochenbett von nur wenigen Tagen auf einem[S. 345] ersten Ausgang dem Volke, das, nicht anders als bei uns, den neuen kleinen Weltbürger gebührend bewundert. Wie ein Klümpchen Unglück hockt es in einem großen, bunten Tuch, das den Oberkörper der Mutter fast ganz umschließt. Meist hängt der Sack für die Aufnahme des Kindes auf dem Rücken, fast ebenso häufig aber schwenkt die Mutter Sack und Baby auf eine der Hüften herüber. Naht sodann die Zeit der Nahrungsaufnahme für das Kind, so werden beide nach vorn befördert. Nichts macht auf mich so sehr den Eindruck des Armen und Primitiven als gerade diese Art der Kinderwartung: kein Wechsel der Wäsche bei Mutter und Kind, denn es ist kein Ersatz vorhanden; kein Trockenlegen, kein Einpudern, keine Windel, kein regelmäßiges Baden von den Tagen des Wochenbettes ab, keine Hygiene des Mundes. Dafür wundgefressene Körperstellen bei fast jedem Kinde, besonders in den Gelenkbeugen und der Analfalte; verheilende Schorfe, wo trotz der Vernachlässigung des Körpers die Natur den Sieg davonträgt; ziemlich allgemein tränende, trübe Augen infolge der ewigen Fliegenattacken; vereinzelt schließlich Schwämme und Pilze in so furchtbarem Maße, daß sie den Unglückswürmern direkt aus Nase und Mund herausquellen!
Ich bin vor einer halben Stunde ins Negerdorf gekommen; die Männer und Knaben sind nach zwei Minuten bereits zur Stelle gewesen, die Frauen kommen langsamer; die kleineren Mädchen bleiben merkwürdigerweise ganz aus. Ganz wie bei uns hat sich die Frauenwelt schleunigst zu einem dichten Klumpen zusammengeballt. Zunächst herrscht noch scheue Stille; kaum aber hat man sich an den Anblick des Weißen gewöhnt, da plappert es auch schon, selbst den riesigsten[S. 346] Lippenscheiben zum Trotz, in allen Tonarten. Mindestens die Hälfte aller Weiber ist babybehaftet, doch wie weit ist hier dieser Begriff zu dehnen! Wahre Riesen, von zwei, ja von vielleicht drei Jahren gar, räkeln sich auf den schmächtigen Hüften der immerhin zarten Mama herum, oder unternehmen einen mit furchtbarem Ungestüm durchgeführten Angriff auf den mütterlichen Born. Es scheint, als wenn gerade meine photographischen Apparate zu diesen Angriffen reizten: wie auf Verabredung schnellt die ganze kleine, schwarze Schar genau in dem Augenblick um die mütterlichen Hüfte herum, wo ich auf den Ball drücke. So weit ist dies alles ganz lustig und gibt zu vielen Heiterkeitsausbrüchen Anlaß; zu unbändiger Heiterkeit jedoch steigert sich diese Lust bei uns beiden schlechten Europäern, wenn bald hie, bald da die Mütter ganz plötzlich mit der Hand energisch am Oberschenkel entlang fahren und rasche Schleuderbewegungen vollführen. Das ist die Folge der Windellosigkeit, die sich hier geltend macht; auch ein kleines Negerkind ist von Hause aus nicht stubenrein! Wir Europäer haben gut lachen; verständiger, menschenfreundlicher und edler würde es sein, wenn Regierung und Mission sich verbünden würden, um, weniger durch ärztliche Tätigkeit, die immer nur lokal beschränkt sein kann, als durch eine im großen Maßstabe durchgeführte Erziehung der Mütter zu den einfachsten Grundregeln der Hygiene und Reinlichkeit diesen schauderhaften Zuständen ein Ende zu bereiten. Es gilt in erster Linie jener schrecklichen Kindersterblichkeit vorzubeugen, die nach allem, was ich sehe und höre, die Hauptursache für die geringe Volksvermehrung ist.
Die weitere Negerkindheit verläuft nicht viel anders als unsere eigene verlaufen ist; die kleinen Jungen rotten sich zu Trupps zusammen, die in Dorf und Pori ihre Spiele treiben; das kleine Mädchen aber fängt sehr bald an, die Mutter durch kleine Hilfeleistungen in Haus und Feld zu unterstützen.
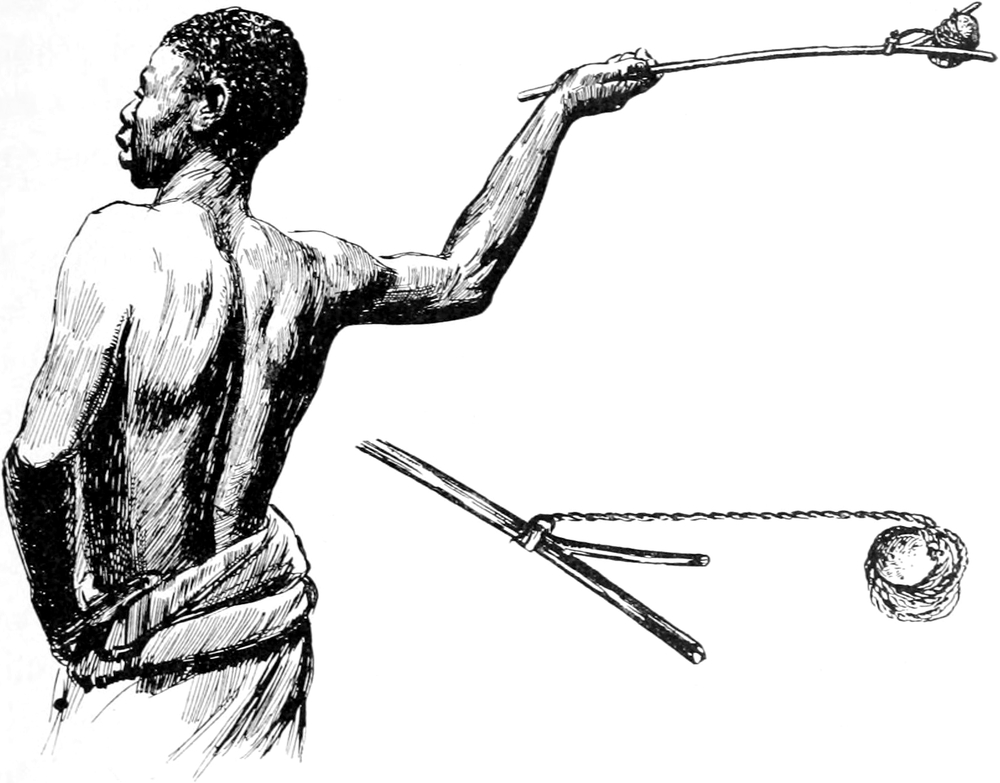
Mit außerordentlicher Beharrlichkeit bin ich, wo immer ich hier meine Sammeltätigkeit betrieben habe, auf die Zusammentragung aller[S. 347] im Lande vorkommenden Spiele und Spielsachen versessen gewesen. Mit dem Kinderspiel hat es eine eigene Bewandtnis; das Kind ist vom ersten Tage seines Daseins an überall dabei, wo etwas los ist; wiegt sich die Mutter im Reigentanz, das Baby im Tragsack macht jede Bewegung mit; sozusagen instinktiv lernt es auf diese Weise tanzen. Denn wenn es sich später auf die eigenen kleinen Füße stellt, macht es mit derselben Sicherheit mit, wie ein eben aus dem Ei geschlüpftes Rebhuhn seiner Nahrung nachgeht. Ob das Negerkind über diese Tanzvergnügungen hinaus eigentliche Gesellschaftsspiele besitzt, kann ich nicht sagen; gesehen habe ich bis jetzt nichts davon, man müßte sonst die Virtuosität im Händeklatschen dazu rechnen, das mit seinem ansprechenden Rhythmus und, fast möchte man sagen, seinem Melodienreichtum auch hier zu Hause ist. Sonst scheint jedes Kind auf sich selbst angewiesen zu sein, wenigstens was sein Spielzeug anbelangt. Für den Knaben ist zunächst Bogen und Pfeil unerläßlich; hätte ich alle diejenigen Kinderbogen aufkaufen wollen, die[S. 348] mir angeboten worden sind, es wäre eine kleine Schiffslast geworden. Den Charakter des Überbleibsels verleugnet die Waffe gleichwohl auch hier in Afrika nicht, ihre Beschränkung auf das Kind läßt sich vielmehr vollkommen in Parallele mit unserem Flitzbogen bringen; auch sie ist heute kein ernsthaftes Kriegsgerät mehr, sondern vorwaltend Spielzeug und höchstens Jagdgerät. Dem entspricht es vollständig, wenn die Kunst des Bogenschießens bei den Erwachsenen ebenso schlecht ist wie bei den Kleinen, und umgekehrt. Wo das Gewehr einmal seinen Einzug gehalten hat, erfreuen sich primitivere Waffen keiner Wertschätzung mehr.
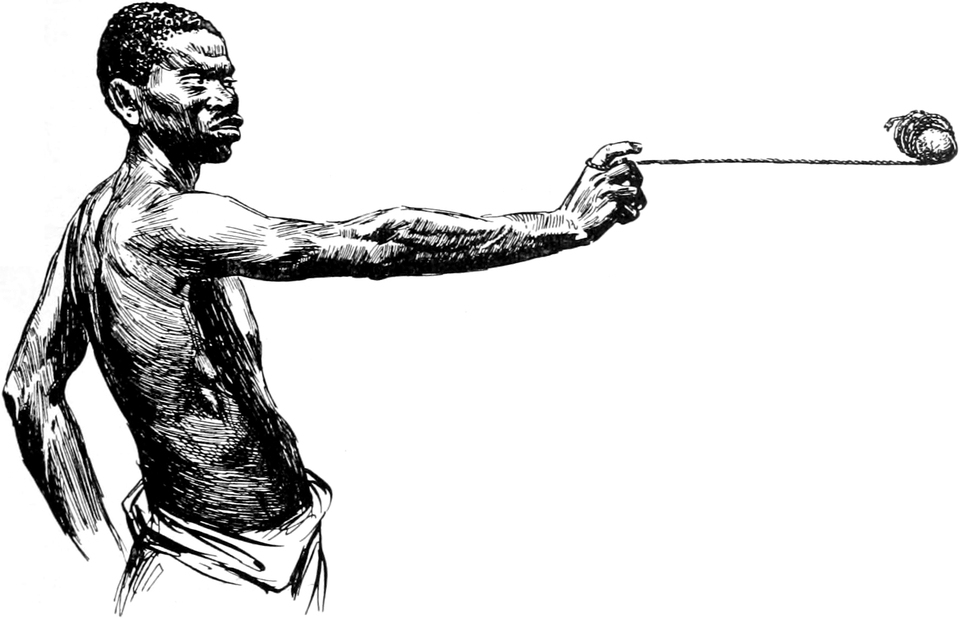
Das Zusammenbringen einer ethnographischen Sammlung ist hierzulande nicht leicht; die Leute bequemen sich erst mehr infolge meiner sehr entschiedenen Haltung als im Hinblick auf meine Hellersäcke zur Einlieferung von allerlei Krimskrams; um wertvollere Besitzkategorien zu erhalten, wie die größeren Stücke des Hausrats, Masken und andere Kunstwerke, muß ich sogar häufig zu dem kleinen Gewaltmittel greifen, den betreffenden Dorf-Jumben für die Ablieferung der Stücke moralisch verantwortlich zu machen. Und dabei bekommen die Leute jedes Stück gut bezahlt. Wie außerordentlich schwierig aber erst das Zusammentragen gerade der Spielsachen ist, davon macht man sich zu Hause gar keinen Begriff. Ich habe folgende Erklärung dafür. Käme z. B. ein japanischer Ethnograph im Herbst nach Deutschland, so würde es ihm ein Leichtes sein, eine ungeheuere Sammlung von Kinderdrachen anzulegen; den Kreisel aber, um irgendein anderes unserer typischen Kinderspielzeuge herauszugreifen, würde er zweifellos erst auf seine bestimmte Nachfrage hin bekommen und registrieren können. Ganz so ist es auch hier; jedes Ding hat seine Zeit, und vor allem jedes Spielding. Ich habe nach dieser Erkenntnis überall kurzen Prozeß gemacht und einfach vor versammeltem Volk ein ganzes Kolleg über alle Spielsachen der Menschheit gehalten: „Habt ihr dies und habt ihr das, so bringt’s mal schleunigst her.“ In vielen Fällen reicht weder die Sprache noch der Dolmetscher aus,[S. 349] dann muß die Geste das fehlende Wort ersetzen. Mit welch verblüffendem Erfolg habe ich eines Tags in Chingulungulu erlebt, wo auf meine kühne Schleuderbewegung hin Salim Matola, der Vielgewandte, nach kurzer Zeit mit zwei merkwürdigen Dingen erschien, die sich auf Grund des von ihm sofort vorgeführten Gebrauchs als ein veritabler Wurfstock und als eine Wurfschlinge, als ein Amentum, herausstellten. Ich habe nur selten so das Gefühl eines vollen Erfolges gehabt, wie in diesem Augenblick; Wurfstock und Wurfschlinge im ethnographisch so öden Osten von Ostafrika, wer hätte das je ahnen können! Jener ist ein Gerät, das keinen anderen Zweck verfolgt, als den Unterarm beim Speer- oder Steinwurf zu verlängern, er stellt sich also, physikalisch gesprochen, als die Verlängerung eines Hebelarms dar. Seinen Hauptverbreitungsbezirk hat der Wurfstock in Australien, in einigen Teilen der westlichen Südsee, bei den Hyperboräern und hie und da in Amerika; der Neger hatte nach unserer bisherigen Kenntnis diese Erfindung nicht gemacht. Die Wurfschlinge verfolgt genau denselben Zweck der Verlängerung des Hebels, nur daß Speer oder Stein bei ihr nicht mit dem Einsatzhaken des Stockes oder Brettes fortgeschleudert werden, sondern mittels einer Schnur, die auf der Zeigefingerwurzel befestigt wird, während sich das freie Ende um das Wurfobjekt schlingt. Wirft der Krieger den Arm nach vorn, so entfernt sich die Waffe vermöge der Fliehkraft von der Hand, rollt[S. 350] dabei aus der Schnurumwicklung heraus und saust mit großer Anfangsgeschwindigkeit davon.


Wo solche Altertümer vorkommen, so habe ich damals gedacht, da wird auch manches andere noch zu finden sein. Diese Erwartung hat sich tatsächlich auch erfüllt, indessen habe ich doch vorher noch einen wahren Kampf mit dem Überfluß an einem anderen Spielzeug durchfechten müssen. Eines Tages fiel in dem erwähnten Kolleg die Geste des Peitschens über die Erde hin; diesmal war sie richtig verstanden worden, denn von da an hat mich die Negerjugend mit Kreiseln förmlich überschüttet. Nicht weniger als vier Arten sind hier im Gange: eine genau unserem europäischen Kegelkreisel entsprechende, die auch, wie unser Kreisel, mit der Peitsche angetrieben wird; eine andere, wo auf einen kurzen, derben Holzstift als Rotationsachse ein rundes oder quadratisches Stück Flaschenkürbis geschoben ist; eine dritte, wo unter diese fünfmarkstückgroße Scheibe noch eine kleinere geschoben ist, um den Schwerpunkt zu erhöhen; schließlich eine sehr komplizierte Maschine, die in der Wirkung vollständig unserem Singkreisel entspricht. Nr. 2 und 3 bedürfen keiner Peitsche, werden vielmehr mit Daumen und Mittelfinger angetrieben, Nr. 4 hingegen benötigt eines Abzugsrahmens in Gestalt eines der Länge nach durchbohrten Stückes von einem ausgesogenen[S. 351] Maiskolben, durch den die Abzugsschnur schnell zurückgezogen wird. Wie so vieles andere, wird dem jungen Neger im übrigen auch dieses Kreiseln nicht ganz leicht gemacht, da der weiche, sandige Boden das Spiel in hohem Maße erschwert; gleichwohl sind die kleinen Kerle wahre Künstler auf dem Gebiet.

Ganz unselbständig ist die Jugend auf dem Gebiete der Musik; ob sie auf der „Sese“, dem geigenartigen Monochord, fiedelt, oder die „Ulimba“, die afrikanische Universalklimper, mißhandelt, jenes kastenartige Gerät, auf dessen Oberfläche sieben hölzerne oder eiserne Tasten angebracht sind, die mit den Fingerspitzen geschlagen werden; ob sie das Mgoromondo, jenes vorsintflutliche Xylophon, bei dem die Tasten auf einem Strohlager ruhen, mit flinken Stäbchen hämmert, oder das „Lugombo“, jenes weit über Ost- und Südafrika verbreitete Bogeninstrument, bei dem die Sehne den durch einen Flaschenkürbis als Resonanz verstärkten Ton gibt, stets sind diese Instrumente mehr oder minder plumpe Nachahmungen des Instrumentariums der Großen. Selbständig ist nur die „Natura“, ein Waldteufel. Dieser besteht aus einem der Quere nach halbierten Flaschenkürbis oder einer halben Baobabfrucht, die mit feiner Tierhaut trommelartig überspannt ist. Von der Mitte der Membran geht ein Grashalm durch das Gefäß, aus dem er weiterhin noch weit nach unten[S. 352] hängt. Ohne Unterlaß fahren die kleinen Schlingel mit angefeuchtetem Daumen und Zeigefinger an dem Halm hernieder; vor den furchtbaren Tönen aber ergreifen selbst meine sonst nicht nervösen Träger die Flucht!
Die Jugend hat nicht nur die Fähigkeit, alte Kulturreste Jahrtausende hindurch zu bewahren, sondern auch den Vorzug, für Fremdes, Neues empfänglicher zu sein als das Alter.
In ihrer Hütte sitzt Akalingēne, die Makuafrau. Ihr Name besagt, daß sie den anderen Frauen des Stammes nicht gleich ist; sie ist viel kräftiger und runder, mit einem Wort viel schöner als die anderen. Das heißt, so war es einmal, damals, als sie noch die runden, braunen Glieder in jugendlicher Lust zur Ngoma wiegte und als sich die Blicke ihrer hübschen, braunen Augen über dem von Monat zu Monat wachsenden Pelele hinweg immer häufiger mit denen des jungen Mitaba trafen. Das ist nun lange her; ihre Formen sind nicht mehr rund und schwellend, die Brust hängt welk herab, eine Folge der vielen Sprößlinge und unausgesetzter Arbeit; auch das Pelele steht nicht mehr keck und stolz in die Weite, sondern legt sich über den Mund wie ein Vorhängeschloß. Akalingēne ist nicht allein; ihr gegenüber am lustig flackernden Herdfeuer kauert ein junges Ding, ihre Tochter; von allen den vielen Mädchen, die sie Mitaba geboren, ist es die einzig Überlebende; die anderen sind schon in früher Jugend dahingerafft worden; die Söhne aber haben längst die mütterliche Hütte verlassen, haben sich ein Weib genommen und sind zu diesem in ferne Gegenden gezogen. Auch Mitaba weilt nicht mehr unter den Lebenden. Sein Name bedeutete nicht umsonst „der Seßhafte“; er war gesetzt und ruhig und baute seinen Mais und seine Hirse an. Nur einmal hat ihn das den Makua eigene Jagdfieber gepackt; da ist er mitgezogen mit den anderen und nicht wieder gekommen; das angeschossene, wütend gewordene Rüsseltier, der Elefant, hat ihn, den Ungeschickten, Ungelenken, angenommen, den vor Schreck Erstarrten in die Höhe geworfen und dann zertrampelt. Nun ist[S. 353] Chimlipa die Freude ihrer Augen und der Trost ihres Alters, ihr junger Schwiegersohn nämlich, der die Tochter erst vor kurzem gefreit. Beide Eheleute zählen noch nicht viele Lenze, und beide sind erst vor wenig Jahren in die Zahl der Erwachsenen aufgenommen worden.
Chimlipa ist ein braver Bursche; noch zuvorkommender als die Schwiegersöhne ihrer Freundinnen sieht er Akalingene alle Wünsche von den Augen ab; nur etwas wild und unternehmungslustig ist er, und das beunruhigt sie heute mehr als je; mit einem Dutzend gleichgesinnter Altersgenossen — wer miteinander das Unyago durchlaufen hat, bleibt untereinander befreundet sein Leben lang — ist er gestern früh noch vor Tagesanbruch auf die Elefantenjagd gezogen, und noch ist keine Kunde von dem Ausgang des gefährlichen Unternehmens eingegangen. Das Abendgericht, ein heute besonders schmackhaft zubereiteter Ugali, ist längst übergar und nur noch schwer zu halten. Immer unruhiger, doch in beharrlichem Schweigen, schauen die beiden Frauen nach der hermetisch verschlossenen Tür; gut verschlossen muß sie sein, so will es der Brauch der Makua, sonst widerfährt dem Jäger ein Unglück, auch sprechen dürfen die Frauen aus dem gleichen Grunde[S. 354] nur das Allernotwendigste. Rrrrrrrrrr bum, ein kurzer, rascher Wirbel von der Hüttenwand her, wo ein Gerät von merkwürdiger Form mit den üblichen Bastschnüren an den rohen Pfählen befestigt ist. Wie elektrisiert sind beide emporgesprungen, schon hat Akalingene ihr scheibenverziertes Ohr in unmittelbare Nähe jenes rätselhaften Gegenstandes gebracht, ein freudiges Grinsen verlängert ihren welken Mund bis fast an beide Ohren, selbst das sonst so konsequent herniederhängende Pelele fällt in seine Jugendgewohnheit zurück und richtet sich so freudig zitternd nach oben, daß der verbogene Oberkiefer und der Zaun der einst so schönen, weißen Zähne in seiner heutigen ganzen Ruinenhaftigkeit der aufgeregt danebenstehenden Tochter im flackernden Dämmerlicht des engen Hüttenraumes entgegenstarrt. Doch schon ändert sich die Szene; Akalingene hat den glatt rasierten, langen, schmalen Kopf gedreht und spricht mit einem Eifer und einer Zungenfertigkeit, die bei der Größe ihres Oberlippeneinsatzes selbst die Tochter erstaunen macht, nun ihrerseits in den Apparat hinein. Endlich aber versiegt auch dieser Redestrom, ein kurzes „bass, Schluß“ — hoch aufatmend wendet sich die Mutter der Tochter zu.


Erst jetzt, im Zwiegespräch der beiden, wird uns Lauschern an der Wand des Rätsels Lösung: Chimlipa hat über Verlauf und glücklichen Ausgang des beschwerlichen Jagdzuges auf dem neuesten Wege Bericht erstattet; er hat dazu den „Sim“ benutzt, wie es die Küstenleute nennen, eine feine Schnur, die in jener kleinen Trommel an der Wand anfängt und weithin durch das schweigende Pori sein Haus mit vielen Dörfern im ganzen weiten Rovumalande verbindet. Es ist aber auch zu drollig: hält man, wenn jenes kurze Trommelzeichen ertönt ist, das Ohr an die feine Haut, die Chimlipa einem Litotwe, jenem kaninchengroßen Nagetier mit dem unglaublich langen Rüssel, entnommen und über die kleine Trommel gespannt hat, dann kann man ganz klar und vernehmlich die Stimme des braven Schwiegersohnes vernehmen und sogar seine Worte verstehen! Diese waren heute so fröhlich und so stolz, hatte der junge Jäger doch seinen[S. 355] ersten großen Elefanten mit mächtigen Stoßzähnen erlegt, daß Akalingene nicht anders konnte: sie mußte ihm eine lange Glückwunschrede halten. Auch er hat sie verstanden, wie seine letzten Worte bezeugten. Die großen Zähne werden aber auch viel Geld einbringen beim Bwana kubwa unten in Lindi, und dann wird Chimlipa ihnen beiden, der Schwiegermutter und der jungen hübschen Frau, der das Pelele so reizend steht, viel schönes, buntes Zeug mitbringen; und schöne, schwere, dicke, massive Messingringe wird er beim Fundi kaufen, und ihre Haare wird er mit schönen, bunten Strohkämmen schmücken. Wird das ein Leben werden!
Hätte ich die Gestaltungsgabe eines Jules Verne und die Phantasie eines Dichters, so möchte mich dieses kleine Stimmungsbild leicht zu weiteren Ausblicken und Träumen verleiten können; so bin ich aber ein nüchtern und real denkender Museumsmann und ein ernsthafter Professor noch dazu, und dem wird die Rückkehr in die rauhe Wirklichkeit nicht schwer. Die Telephonszene könnte sich, wie die Dinge liegen, sehr wohl einmal auf Afrikas Boden abspielen, denn im wesentlichen, wenn auch nur embryonenhaft, sind die Vorbedingungen erfüllt: die Neger hier haben das Telephon, und ich besitze sogar zwei wundernette Exemplare in meiner Sammlung. Der Kampf um eine der Grundfragen der ganzen Völkerkunde überhaupt, ob die auffälligen Übereinstimmungen im Kulturbesitz der Menschheit an räumlich ganz unabhängigen Erdstellen auf einer gleichen psychischen und intellektuellen Veranlagung beruhen, oder ob sie auf Entlehnung von einem Verbreitungsbezirk zum andern zurückzuführen sind, ist bezüglich unseres technisch so hochstehenden Fernsprechers wohl gegenstandslos; kein Mensch wird annehmen, daß der Makua- oder Yaojunge die Sprechmaschine unabhängig von Philipp Reis und Alexander Graham Bell, oder wohl gar noch vor ihnen beiden erfunden hätte, hier liegt ganz unzweideutig Entlehnung vor. Doch auch wie die Negerjugend sich mit dieser Entlehnung abgefunden hat, ist nicht ohne kulturhistorisches Interesse.
[S. 356]
Denken Sie sich zwei Miniaturtrommeln, wie ihre großen Vorbilder natürlich schön geschnitzt; beide mit sehr seiner Tierhaut überspannt; in deren Mitte ein feines Loch, in dem Loch eine ebenso feine Schnur, durch einen Knoten auf der Innenseite am Durchgleiten durch die Membran gehindert. Zweifelnd habe ich mir das Ding angeschaut; es ernsthaft zu nehmen, ist mir zunächst gar nicht in den Sinn gekommen. Da endlich einmal eine freie Viertelstunde; ich drücke Knudsen das eine Trommelchen in die Hand und jage ihn davon, bis die wohl 100 Meter lange Schnur straff gespannt ist; ich halte die Membran ans Ohr: „Guten Tag, Herr Professor, hören Sie was?“ höre ich es auch schon klar und vernehmlich aus der kleinen Wundertrommel herausklingen. Also das Ding geht wirklich, fehlt also nur, daß wir die Geschichte ausbauen und uns keck und kühn mit der Küste und dem Kulturzentrum Lindi selbst verbinden! —
Ein für das Negerleben so wichtiger Zeitabschnitt, wie ihn das Unyago mit allen seinen Leiden und Freuden, seinem Spiel und Tanz darstellt, kann ganz naturgemäß nicht ohne Einwirkung auf die Gewohnheiten der Jugend schon vor diesem Lebensabschnitt bleiben. So bin ich denn auch in den Besitz von Ipiviflöten gekommen, die sich in den Händen noch sehr kleiner Knirpse befanden. Aber was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten, und wer nachher in der Daggara schöne Melodien flöten will, der übt sich schon die Jahre vorher. Auch die Kakalle, jene langen, in Ringeln schwarz und weiß gefärbten Stäbe mit ihrer kleinen Trophäe von aufgesteckter Hohlfrucht und wallendem Federbusch an der Spitze, sind mir mehr als einmal von Knaben überbracht worden, die offenkundig noch nicht das Unyago passiert hatten; beide Attribute der fast und der ganz vollendeten Mannbarkeit sind demnach also auch Spielzeuge. Für die Knaben ist dies nicht weiter verwunderlich, denn vor ihnen hat der Neger keine Geheimnisse; bei den Festen sowohl in Akuchikomu wie in Niuchi und Mangupa trieb sich stets eine ganze Schar kleiner, mit Schmutz und Asche überzogener Wichte herum. Seltsamerweise[S. 357] jedoch befanden sich keine halbwüchsigen Mädchen dabei; vor diesen scheint man alles, was auf die Mannbarkeitsfeste und ihre Geheimnisse Bezug hat, ängstlich zu verbergen; erst hier in meinem langen Newalaaufenthalt mit seinen offenen, freien Beziehungen zwischen allen Stämmen und mir und allen Altersklassen untereinander ist es mir möglich geworden, solche junge Dinger zu Gesicht und auf die Platte zu bekommen. Die Erziehung scheint sich viel mehr innerhalb der Wände des Hauses und des Gehöftraumes zu vollziehen, als wir anzunehmen geneigt sind. Auch bei den Hunderten von Besuchen, die ich Eingeborenengehöften gemacht habe, ist es mir nur selten vergönnt gewesen, die kleineren Haustöchter von Angesicht zu Angesicht zu sehen; in der Regel konnte ich gerade nur noch wahrnehmen, wie die schmale Figur sich mit großer Behendigkeit durch die Hintertür entfernte.
Wie das kleine Negermädchen in Wirklichkeit aufwächst und ob es die unsagbar glückliche Jugend unserer kleinen Lieblinge auch nur in abgeschwächtem Maße zu kosten bekommt, kann ich unter diesen Umständen nicht sagen; es spricht nicht viel dafür. Fraglos liebt der Neger sein Kind aus jenem angeborenen Triebe heraus, der allen Eltern eigen ist; er nährt es und schützt es, wo immer es schutzbedürftig ist; er freut sich über sein Gedeihen und ist traurig über sein Siechtum und seinen Tod. Noch immer sehe ich Matola, wie er, dem an sich schon ein etwas melancholischer Gesichtsausdruck eigen ist, eines Tages mit tieftrauriger und doch sichtbar ängstlicher Miene höchst eigenhändig ein kleines Mädchen von 5 bis 6 Jahren herantrug. Es war nicht einmal sein eigen Kind, sondern nur eine Verwandte, doch bat er mich so eindringlich, wie es ihm nur möglich war, der Kleinen meine Hilfe angedeihen zu lassen. Das konnte ich zu meinem aufrichtigen Bedauern in diesem Falle nicht; der Unglücklichen hatte eine bösartige Gangräne die ganze Vorderhälfte des einen Unterschenkels weggefressen, so daß die Bänder bloßlagen und selbst die Knochen sich schon bogen. Ich habe Matola damals eine sehr eindringliche Rede gehalten, ob er denn ein ebensolcher Schensi[S. 358] sei wie seine Leute; diese gingen an ihrem eigenen Stumpfsinn zugrunde, er aber sei doch der Akide und ein kluger Mann dazu, und er wisse doch ganz genau, daß in Lindi deutsche Medizinmänner nicht nur vorhanden seien, sondern daß sie auch selbst solche Wunden heilten, wenn ihnen die Kranken gebracht würden; flugs solle er also das kleine Fräulein hinunterschicken; täte er es nicht, so würde das Kind unfehlbar sterben wie alle seine älteren Geschwister auch.
Zwischen Zweifel und Hoffnung schwankend, hat Matola mich an jenem Nachmittag erst lange angeschaut; dann hat er nach meinen Worten gehandelt. Und er hat recht daran getan, denn wie ich höre, ist die Kleine auf dem besten Wege zur Besserung. Aber erstaunlich und befremdlich ist und bleibt es, wie weit selbst ein so einsichtiger Mann wie der Herrscher von Chingulungulu den Krankheitsprozeß erst hat fortschreiten lassen, bevor er sich ernsthaft nach Hilfe umsah. Und nun gar erst ein Hinterwäldler, der mich hier oben jüngst konsultiert hat. Der Bursche erschien unmittelbar nach meinem Einzuge; sein Kind sei krank, er wolle Daua haben.
„Was hat dein Kind?“
„Eine Wunde am Fuß.“
„Aber Mensch,“ sage ich darauf, „ich kann dir doch keine Daua mitgeben, die verstehst du doch gar nicht aufzulegen, bring dein Kind her; wo wohnst du?“
„Mbali, weit, Herr“, tönt es mit merklicher Dehnung zurück.
„Wie weit?“
„Nun, zwei Stunden etwa.“
„So, du Schensi, das nennst du weit; wenn es zum Pombetrinken ginge, dann würden dir selbst 20 Stunden noch karibu sana sein. Marsch, scher dich weg, und morgen früh um 8 Uhr bist du hier!“ Wer nicht gekommen ist, weder um 8 Uhr noch auch später, das ist dieser edle Kindervater aus dem Makondebusch gewesen. Erst am fünfzehnten Tage nach jener Vorkonsultation erscheint ganz unvermutet eine von einem 5- bis 6jährigen Mädchen begleitete[S. 359] Männergestalt; ich denke gar nicht mehr an den kecken Burschen von dazumal, erinnere mich jedoch sofort der Begegnung, als das Kind, aller angeborenen Scheu zum Trotz, mir seinen Fuß entgegenhält.

Himmel, was muß ich sehen! Der ganze Fuß eine einzige, von Makondedreck und -sand blutig verklebte Masse. Ohne Verzug gehen Stamburi, mein bewährter Lazarettgehilfe, und ich an die Reinigung des Gliedes; als es endlich bloßliegt, zeigt sich, daß der ganze Ballen bis auf die Knochen weggefressen ist; ob durch Sandflohwirkungen allein oder durch eine Summe anderer Umstände, kann ich als Laie nicht entscheiden. Endlich werfe ich einen Blick auf den Papa; wie hypnotisiert starrt der auf eine Antilopenkeule, die Nils Knudsen für die morgige Hauptmahlzeit gerade über meinen Arbeitstisch gehängt hat. Ich rufe den Edlen in die Wirklichkeit zurück, lasse ihm durch Moritz den weichsten Teil einer Wildschweinshaut überreichen und befehle ihm, einen Schuh oder doch eine Sandale, wie sie im Lande durchaus nicht unbekannt sind, daraus zu machen; denn das müsse er doch wohl selber sehen, daß das Kind mit dem neuen Verbande nicht in den schmutzigen Sand patschen könne; sein Messer habe[S. 360] er bei sich, er solle gleich an die Arbeit gehen! Wir beiden Medizinmänner versenken uns von neuem in die Behandlung der wirklich furchtbaren Verletzung; nach einiger Zeit ist der Verband so kunstgerecht, wie es uns möglich ist, angelegt; ein suchender Blick nach dem Vater: dieser hat sich jetzt förmlich in die Keule hineingefressen, so stier glotzt er auf das blutige Stück Fleisch. Es ist doch wirklich gut, wenn die Nilpferdpeitsche in solchen Fällen nicht allzuweit entfernt ist. Noch eine Viertelstunde später, und der dicht umwickelte Fuß des Kindes steckte wohlgeborgen in einem ganz zweckentsprechenden Schweinslederpantoffel. Aber gehört und gesehen habe ich von dem Gentleman niemals wieder etwas; auch gedankt hat er mir nicht, weder für die Behandlung — noch für die Prügel.
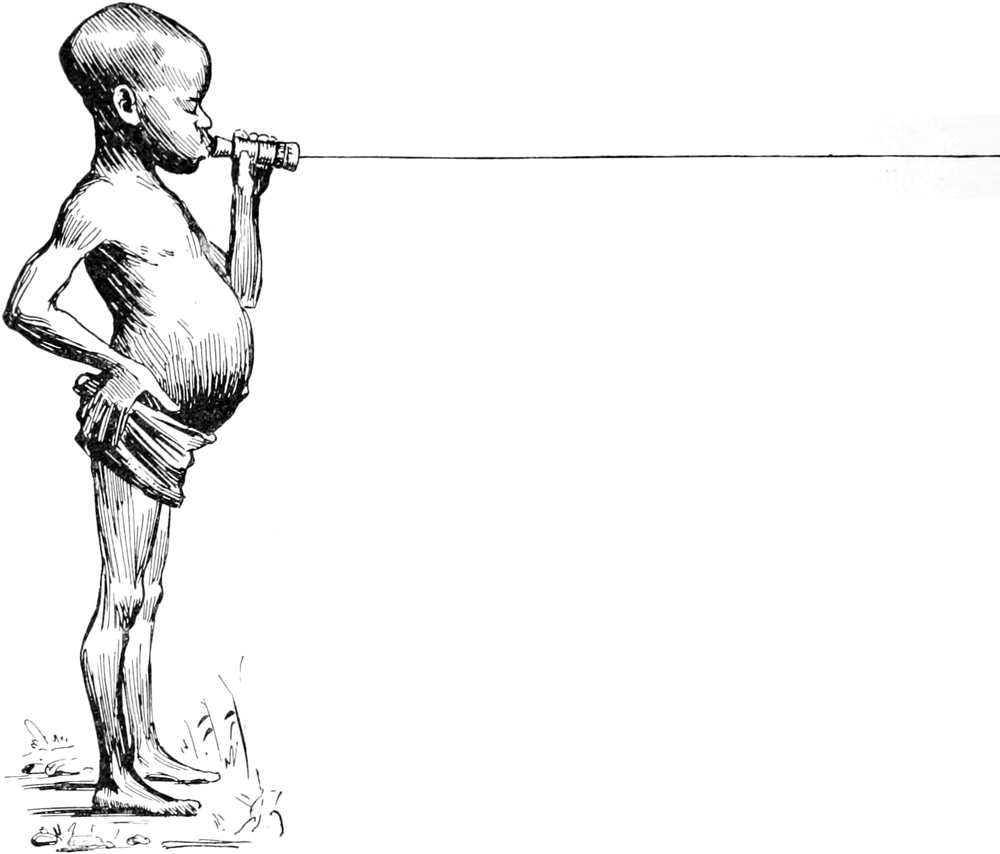


Knabe und Mädchen sind 8 oder 9, oder auch 10 Jahre alt geworden, ohne daß etwas Bemerkenswertes von außen in ihr Leben eingegriffen hätte. Da beschließt der Konvent der Männer, der nach der Beendigung der Ernte die große Pfeilerhalle der Barasa tagtäglich füllt, daß das Unyago in diesem Jahre hier im Dorfe gefeiert werden soll. Nachdem alle anderen Distrikte in den letzten Jahren die Lasten des Festes auf sich genommen haben, ist es Ehrenpflicht, jetzt hierher einzuladen. Dem Beschluß folgt sehr bald die Ausführung; der Mond ist stark im Abnehmen, und vor dem Neumond noch muß das Fest im Gange sein. Dieses Unyago besitzt in seinem ersten Teil bei allen Völkern des Gebietes ganz gleiche Züge: die Männer errichten auf einem in der Nähe des Festdorfes[S. 361] gelegenen, möglichst freien Platz einen mehr oder minder ausgedehnten Ring von einfachen Strohhütten. Auf diesem Platze spielt sich das Eingangs- wie auch das Schlußfest ab; die Hütten sind die gegebenen Wohn- und Schlafräume für die Mannbarkeitskandidaten. Ein ganz ausgezeichnet erhaltener Festplatz mit allem Zubehör war jener Kreis von 50 Meter Durchmesser, den ich bei meinem Besuch des Echiputu von Akuchikomu aufnehmen konnte; die halbverkohlten Reste einer ebensolchen Lisakassa, wie das Hüttensystem im Kiyao heißt, waren als Erinnerung an ein früheres, frohes Fest diesseits Akundonde am Wege zu sehen.
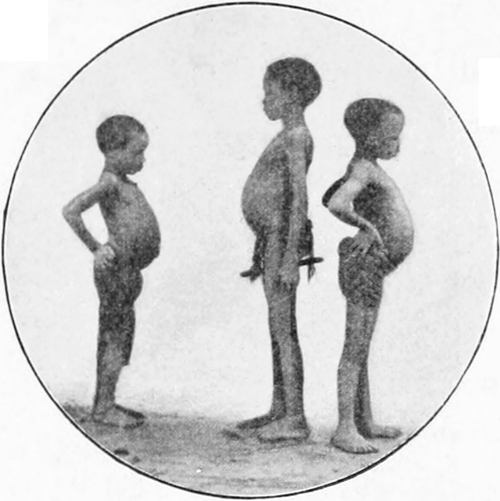
Es liegt in der Natur der ganzen Veranstaltung, daß beim Unyago Knabe wie Mädchen sich vorwiegend passiv verhalten. Sie sitzen tatenlos, stumm und ohne sich zu rühren jedes in seiner Hütte, während sich in der ersten Nacht des Festes die Erwachsenen zu Schmaus und Trunk in wildem Masewetanz bewegen. Die Knaben werden am nächsten Tage, jeder von seinem Mentor geleitet, unter der Aufsicht eines Oberleiters in den Wald geführt. Dort schlafen sie eine Nacht[S. 362] ohne jeden Schutz; nur am nächsten Tage dürfen sie sich eine kurze Spanne Zeit einmal selbst betätigen; dann gilt es nämlich, im Verein mit ihren Anamungwi, den Lehrern, die Daggara zu bauen. Aber kaum ist die luftige Hütte im tiefsten Pori vollendet, so ist auch schon die alte Sachlage wieder hergestellt; einer nach dem anderen wird in jenem Häuschen auf ein sehr primitives Ruhebett von Hirsehalmen gelegt; mit scharfem Schnitt vollführt der Wamidjira die Operation; wochenlang liegen darauf die kleinen Patienten in langer Reihe da, ohne in den langwierigen Heilungsprozeß irgendwie eingreifen zu können. Erst wenn die Wunde verheilt ist und der Unterricht in den Sexualien und der Moral mit allen Kräften eingesetzt hat, gewinnen auch die Wari, wie die Knaben jetzt heißen, mehr und mehr das Recht, am öffentlichen Leben teilzunehmen; die kleinen Kerle werden übermütig und vollführen manchen tollen Streich. Wehe der Frau oder dem Mädchen, das sich, der Lage der Daggara unbewußt, in diese Waldregion verirrt: wie eine Schar übermütiger Kobolde stürzt sich die Schar der Knaben auf die Unglückliche, neckt sie, fesselt sie und mißhandelt sie wohl gar. Nach Volksgesetz haben die Wari das Recht dazu, denn ihr Aufenthaltsort im Walde soll jeder weiblichen Person gänzlich unbekannt bleiben. Mit dem Hinausziehen in das Pori ist der junge Sohn für die Mutter gestorben; wenn er wiederkehrt, wird er ein neuer Mensch sein mit neuem Namen: an das ehemalige Verwandtschaftsverhältnis erinnert nichts mehr.
In welchen Bahnen sich der Unterricht hier in der Daggara bewegt, habe ich bereits früher zu schildern versucht; der bierehrliche[S. 363] Akundonde und sein trinkfester Minister sind unstreitig die zuverlässigsten Gewährsmänner in bezug auf alle diese Weistümer. Es bleibt ewig schade, daß der überraschend schnell erzielte „Anschluß“ der beiden mich um den Schluß der Rede an die Wari gebracht hat; doch zur Kennzeichnung der hier herrschenden Unterrichtsprinzipien genügt ja auch jenes mitgeteilte Bruchstück.

Für die Knaben erreicht das Lupanda seinen Höhepunkt erst mit dem Schlußfest. Die Vorbereitungen dazu sind auf beiden Seiten groß: im Walde werden die Wari von ihren Mentoren durch Rasieren des Kopfes, Bad, Neueinkleidung und Salben mit Öl erst wieder in einen menschenwürdigen Zustand versetzt, im Festdorf aber beginnen die Mütter bereits lange vor dem festgesetzten Termin, große Mengen Bier zu brauen und noch größere Haufen von Festgerichten vorzubereiten. Und ist der große Tag endlich gekommen, dann zieht es heran; hei, wie glänzen der glattrasierte Kopf, das Gesicht und der Nacken in der strahlenden Tropensonne vom triefenden Öl, wie stolz schreiten die kleinen Männer in ihren neuen Prunkgewändern einher, und mit[S. 364] welch sicherem Takt schwingen sie in der Rechten die Kakalle, jene uns bekannten Rasselstäbe! Rechts und links hat sich die Mauer der erwartungsfrohen Erwachsenen aufgebaut. Immer lauter, immer gellender durchzittert der schwirrende Frauentriller den weiten Festplatz; dort setzt auch schon die Trommelkapelle mit ihren aufregenden Takten ein; aus rauhen Männerkehlen erschallen die ersten Takte eines Ngomenliedes, kurz alles entwickelt sich herrlich, urecht afrikanisch.
Die Neger sind Menschen wie wir anderen auch, ihr Tun und Trachten ist demnach auch ebenso vielfachen Veränderungen unterworfen wie anderswo. Von meinem mehr als einmonatigen Newalaaufenthalt habe ich einen unverhältnismäßig großen Teil auf die Festlegung des typischen Verlaufs aller dieser Feste verwandt. Das ist eine Heidenarbeit gewesen; wollte ich ganz klug sein und bestellte mir meine Gelehrten nach Stämmen geordnet, so durfte ich sicher sein, daß die paar alten Herren wenig oder gar nichts sagten; des Negers Intellekt scheint sich nur dann betätigen zu können, wenn er im Kreise vieler Männer durch scharfe Rede und Gegenrede gereizt und geweckt wird. So habe ich denn stets von neuem auf mein ursprüngliches Verfahren zurückgreifen müssen, den gesamten Senat der Wissenden, rund 15 alte Herren, Yao, Makua, Makonde bunt durcheinander, zu meinen Füßen zu versammeln. Dies hat mir zwar insofern geholfen, als nunmehr stets eine rege Diskussion entstand, doch wie schwer ist es mir geworden, nun das eine Volkstum vom anderen scharf zu trennen! Dennoch ist mir die Aufgabe, wie ich sagen zu dürfen glaube, mit viel Glück und einigem Geschick soweit gelungen, daß nunmehr wenigstens eine Art Leitfaden über diese Dinge gegeben ist. Die sicher bestehenden kleinen Lücken auszufüllen und die zweifellos vorhandenen Ungenauigkeiten zu berichtigen, überlasse ich getrost meinen Nachfolgern.
Noch eins: in seinem Gesamtumfang und für alle drei genannten Völkerschaften durchgeführt, nimmt das Studium der Mannbarkeitsfeste[S. 365] in meinen Aufzeichnungen einen solchen Raum ein, daß ich mir ihre Wiedergabe hier versagen muß; sie würde ganze Druckbogen für sich allein beanspruchen. Auch noch zwei andere Momente treten herzu. Was ich von dem Unyago mit eigenen Augen gesehen, habe ich unverkürzt wiedererzählt, mit jener Milieustimmung gleichzeitig, die nur das eigene Erleben hervorzuzaubern vermag. Aber jene Szenen in Akuchikomu, Niuchi und Mangupa sind nur winzige Teile aus dem ungeheuer umfangreichen Festkalender, wie ihn das Mädchen-Unyago in Wirklichkeit darstellt; über den ganzen übrigen großen Rest vermag ich nur das zu berichten, was ich meinen Gewährsleuten verdanke. Nun aber bringt jedes Referat leicht das Odium des Trocknen und Langweiligen mit sich, und langweilig möchte ich um keinen Preis werden; lieber verweise ich jeden, den solche Sachen im einzelnen interessieren, auf das Werk, das ich vertrags- und pflichtgemäß über alle meine Taten hier im schwarzen Erdteil und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse für das Kolonialamt zu schreiben habe.
Das letzte Moment liegt auf einem andern Gebiet. Der Neger ist in bezug auf sein Geschlechtsleben noch nicht im mindesten angekränkelt; alles was sich auf das Verhältnis zwischen den beiden Geschlechtern bezieht, ist ihm etwas ganz Natürliches, über das die Leute unter sich eine völlig freie Unterhaltung führen; höchstens daß man dem rassefremden Weißen gegenüber einige Zurückhaltung zeigt. Nun ist der sexuelle Einschlag beim Neger unstreitig sehr groß, ungleich größer als bei uns; es hieße zuviel gesagt, sein ganzes Dichten und Trachten drehe sich um diesen Punkt, aber ein sehr großer Teil entfällt ganz ohne Zweifel auf ihn. Dies tritt in offenkundigster Weise nicht nur im Unyago selbst, sondern auch in der mir gewordenen Darstellung zutage; es geht dort sehr natürlich zu. Wie die Dinge bei uns als Folge der bei uns beliebten Erziehung nun einmal liegen, ist für solch „heikle“ Sachen gerade noch in der allerstrengsten wissenschaftlichen Darstellung Platz; für jeden andern Zweck muß man sich ihre Wiedergabe versagen. Um es nochmals zu betonen, nicht[S. 366] aus Rücksicht auf den Gegenstand selbst, sondern lediglich auf das irregeleitete Gefühl des Publikums. Traurig, aber wahr!
Von allen Völkerschaften des Südens von Deutsch-Ostafrika scheinen die Yao nicht nur die fortschrittlichsten, sondern auch die phantasielosesten, nüchternsten zu sein; ihre Mannbarkeitsfeste sind tatsächlich sehr einfache Formalitäten gegenüber denen der Makua und Makonde. Bei diesen geht es nicht ohne eine gewisse Theatralik ab; die Makua pflanzen mitten auf den Festplatz einen vielgegabelten Baumast von ganz bestimmten Eigenschaften. Er ist von den Männern unter Absingung eines Liedes aus dem Pori geholt worden; in langem Zuge wird er in den Festhüttenring getragen. Dort steht schon der Leiter des Festes in der Pose eines Oberpriesters. Unter seinen Händen muß ein Huhn sein Leben lassen; in eine bereitgehaltene Schale fließt dessen Blut. In einer andern Schale wird Holzkohle zu Pulver gerieben, in einer dritten Schale roter Ton gleichfalls zerstoßen; rot-schwarz-rot wird mit allen drei Ingredienzien sodann jener vielgegabelte Baumast geringelt. An einer Stelle haben inzwischen Männer ein Loch gegraben; in dieses legt man ein Amulett aus zusammengebundenen Baumrindenstücken, füllt das Loch wieder zu und wirft über ihm einen kleinen Hügel auf. Auf diesen pflanzt man jenen Lupanda genannten Baumast. Und noch ein anderer Hügel wird aufgeworfen; er wie auch jener erste waren in dem Hüttenring von Akundonde noch sehr wohl zu erkennen. Dieser andere Hügel ist der Platz für den vornehmsten der Unyagoknaben. Um diesen herum gruppieren sich die anderen, minder vornehmen; alle aber sitzen dabei auf Baumstümpfen, die, wenn auch nur einiger Schönheitssinn bei dem Festleiter vorwaltet, genau in der Form jener beiden konzentrischen Kreise angeordnet werden, wie ich sie bei Chingulungulu im Pori sah. „Der Cromlech der Tropen!“ ist es mir damals durch den Sinn gefahren, als ich vor dieser typischen „Steinsetzung“ stand, und auch heute noch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß zwischen unseren vorgeschichtlichen Steinsetzungen und diesem System[S. 367] von Baumstümpfen eine Ähnlichkeit nicht bloß der Form nach besteht, sondern daß die Verwandtschaft sich vielleicht sogar auf die Zwecke erstreckt. Wenn ein großer Teil unserer neolithischen Megalithen wirklich Kult- und Versammlungszwecken gedient hat, so ist nicht einzusehen, warum nicht auch unsere Altvordern auf diesen ehrwürdigen Steinen Platz genommen haben sollten; auch der Neger würde auf Holzsitze verzichten, wenn ihm hierzulande Stein zur Verfügung stände.
Wäre ich ein Phantast, so könnte ich heute mit leichter Mühe den Nachweis führen, daß die Makonde Feueranbeter seien! Kaum haben die Männer ihr Likumbi gebaut, d. h. eine Hütte von der Art, wie wir sie in Mangupa kennen gelernt haben, so zerstreuen sich allesamt im Busch, um Medizin zu holen. Am Abend desselbigen Tages geben sie die gesammelten Wurzeln einem alten Weibe zum Zerstampfen im Mörser. Den erhaltenen Brei streicht der Mŭnchirắ, der Oberpriester, nunmehr fünf bis sechs Männern tupfenweise auf den Arm; dann sitzt man tatenlos bis in die Mitte der Nacht. Jetzt beginnt der Munchira zu trommeln, unheimlich dröhnt der dumpfe Ton des Instruments durch die dunkle Tropennacht. Alles strömt aus den Hütten zusammen, groß und klein; man schießt und tanzt ohne Unterbrechung, bis zum nächsten Nachmittag; dann findet die Verteilung der Geschenke untereinander und an die Mentoren der Knaben statt. Darauf große Festrede des Munchira: die sechs Männer seien geweiht; wenn sie es sich einfallen ließen, zu stehlen oder zu rauben oder sich mit den Frauen der anderen einzulassen, so dürfe ihnen niemand etwas tun, die Männer seien sakrosankt. Die sechs aber verpflichtet er, von nun ab drei Monate lang alle Mitternacht die Trommel zu schlagen.
Sind die drei Monate herum, so beginnt ein reges Leben im Dorf; Männer gehen in das Pori, um trocknes Holz zu sammeln, abends tragen sie es unter vollkommenem Stillschweigen auf den Festplatz nahe der Likumbihütte; die Frauen aber haben während[S. 368] der Zeit ungeheure Mengen von Pombe bereitet; auch diese findet ihren Weg zur Likumbi. In dieser Hütte steht ein Deckelkorb, Chihēro mit Namen, klein und rund; in ihm ist Medizin. In diesen Chihero und auf die Medizin spuckt jeder der Brennholzsammler ein weniges von der Festpombe. Neben dem Chihero aber steht die Alte, welche die Medizin im Mörser zerstampft hat; diese hebt den Chihero nunmehr auf ihren Kopf, ergreift das Ende einer langen, eigens für das Fest gekauften Zeugbahn mit den Händen und verläßt feierlichen Schrittes die Hütte, das Zeug hinter sich schleifend. Schnell ergreift es der erste der Brennholzsucher, damit es den Boden nicht berühre; ein zweiter folgt seinem Tun, desgleichen ein dritter und vierter. Schließlich schwebt das langgestreckte Stoffstück über der Erde dahin wie von Pagen getragen. Vorne neben der Frau schreitet der Munchira. Man umzieht die Festhütte. Ist der Umzug vollendet, so nimmt der Munchira den Anfang der Zeugbahn und wickelt ihn um den Chihero. Diesen hält er jetzt an das rechte Ohr; ein kurzes Verweilen; er setzt ihn auf die Schulter, wiederum einen Augenblick lang; der Korb wandert auf die Hüfte, aufs Knie, endlich auf die Außenseite des Fußknöchels. Zum Schluß nimmt der Würdige Zeug samt Chihero als wohlverdientes Honorar an sich.

Und wieder ist es Nacht; im schwachen Licht der letzten Mondsichel ist der Umriß des großen Holzstoßes noch eben zu erkennen. Mitternacht ist um etwa eine Stunde vorbei, da erhebt sich aus dem Kreise der in Schlafmatten gewickelten Gestalten eine lange, hagere Figur. Unhörbar schleicht sie auf den Holzstoß zu, ein Feuerchen blitzt auf, um alsbald auch schon wieder zu verschwinden. Doch bald knistert es von neuem; größer und größer wird die Flamme, von ihrem Erzeuger mit rhythmischem Fächerschwung angefacht. Jetzt erkennen wir die Gestalt, es ist der Munchira. Schon nach wenigen Minuten ist der ganze, große Stoß ein einziges Flammenmeer; zitternd huschen seine Reflexe über die glänzenden Gesichter der das Feuer im Kreis umstehenden Männer. Nun hat das Feuer seinen Höhepunkt[S. 369] erreicht. Eilenden Schrittes umkreist es der Munchira; das Gesicht zum Feuer gewandt, läßt er die folgenden Worte dem Munde entströmen: „Laß die Wunden der Knaben schnell und schmerzlos heilen, den Häuptling aber, der diesmal das Likumbi feiert, laß recht viel Freude an den Knaben erleben.“ Dabei bindet er einen weißen Lappen an eine Stange und fächelt das Feuer mit großen Schlägen; die Männer aber umstehen das verglimmende Feuer bis zum hellen Morgen.
Das Feuer als Mittelpunkt einer für das gesamte soziale Leben so einschneidenden Veranstaltung, wie sie die Feier der Pubertät bei diesen Völkern des Südens darstellt, ist meines Wissens etwas im Völkerleben Afrikas ganz Alleinstehendes und Vereinzeltes. Liegt hier ein wirklicher Feuerkult vor, oder ist Rundgang und Ansprache auch nur noch ein letztes, unbewußtes Überlebsel einer solchen uralten Verehrung des lohenden Elementes? Ich weiß es nicht und bin, offen gestanden, auch ganz außerstande, diese Frage ihrer Beantwortung näher zu bringen; von der Hand weisen darf man die Möglichkeit einer ehemaligen Feueranbetung beim Neger a priori nicht, dazu wissen wir noch viel zu wenig von seiner Kulturentwicklung. Daß noch manche ethnologische Überraschung zu erwarten ist, dafür sind ja meine eigenen reichen Ergebnisse der beste Beleg.
Beim männlichen Geschlecht ist die Hinübernahme aus dem Kindesalter in die Klasse der vollberechtigten Männer eine zwar langdauernde Periode, dabei jedoch ein einziger, in sich geschlossener Übergang; eine Erinnerung an die gemeinsam verlebte Fest- und Leidenszeit bleibt den Männern fernerhin lediglich in einer selbstgewählten, freien Organisation, die man passend mit dem Namen Altersklassen bezeichnet: die einzelnen Unyagojahrgänge halten unter sich zusammen, bis der Tod die einzelnen scheidet. Doch dieses Zusammenhalten muß man sich ins Afrikanische übersetzt denken; es ist kein Verein und kein Klub und keine Verbindung; die alten Freunde wohnen lediglich beieinander, wenn auf der Reise einer in des andern Dorf kommt; sonst nichts.[S. 370] Geheimbünde spielen hier im Osten bewußt nicht mehr in das Wesen der Altersklassen hinein, ganz im Gegensatz zu Westafrika, wo beides Hand in Hand geht, sich gegenseitig genetisch bedingt und wo beides dann seinen äußeren Ausdruck findet in großen Geheimbundsfesten mit Maskentänzen und andern geheimnisvollen, auf das Erschrecken der männlichen Nichtmitglieder des Bundes und der Frauen gerichteten Zutaten. Hier auf dem Makondeplateau treten gegenwärtig alle drei Erscheinungen: die Altersklassen, die Feste und die Maskentänze nur in sehr lockerem Zusammenhang miteinander auf; gleichwohl spricht alles dafür, daß der Maskentanz der Makonde von heute ursprünglich ebenso der Ausfluß eines längst vergessenen Geheimbundwesens gewesen ist wie die ganz analogen Erscheinungen der Neger von Kamerun, Oberguinea und Loango. Auf diesem Gebiete der afrikanischen Völkerkunde wird noch manche harte Nuß zu knacken sein.
Das Unyago des jungen Mädchens ist eine wahre Stufenleiter von Kursen. Ich betone absichtlich das Wort Kursus, denn tatsächlich besteht hier nichts, was an einen chirurgischen Eingriff erinnert, mit nur einer einzigen Ausnahme, bei den Makuamädchen nämlich. Eine allen Stämmen gemeinsame Einrichtung ist es, daß auch jedes Mädchen beizeiten ihre Führerin durch das Unyago bekommt, eine Freundin gleichzeitig für das ganze Leben. Unter der Leitung dieser älteren Frauen und Mädchen macht die Schar der Novizen zunächst einen Lehrgang durch, der inhaltlich ganz dem der Knaben entspricht: die Kinder werden rückhaltlos über alle Geschlechtsverhältnisse aufgeklärt und müssen alles lernen, was sich auf das spätere Eheleben bezieht; dazu müssen sie auch lernen, was die Sitte im Verkehr mit den Stammesgenossen und vor allem mit den Familienmitgliedern vorschreibt. Das ist bei Yao, Makonde und Matambwe einstweilen alles; für die Makua tritt noch ein anderes hinzu: bei ihnen erfolgt wirklich eine Art körperlicher Eingriff. Ich habe es zunächst nicht glauben wollen, bis ich mich schließlich durch mehrfachen Augenschein habe überzeugen können: ganz systematisch müssen die heranwachsenden Mädchen[S. 371] die labia minora verlängern bis zur Größe von 7 bis 8 und mehr Zentimetern. Der Endzweck der ganzen Maßnahme ist erotischer Natur. Auch bei den andern Stämmen ist nach meinen Gewährsmännern diese merkwürdige Sitte im Schwange, doch ist es mir bisher noch nicht gelungen, sie bei Anhörigen von ihnen zu Gesicht zu bekommen. Schon bei den Makuafrauen war dies schwer genug; erst durch die geschickte Ausnutzung der Lage habe ich Erfolg gehabt. In Newala verbüßten ein paar Frauen eine Art Schuldhaft; ihre Männer waren die Hüttensteuer schuldig geblieben, die nun von den Frauen abgearbeitet wurde. Ich erbot mich, die wenigen Rupien in bar zu erlegen gegen das Recht, die beiden Individuen „im Naturzustande“ photographieren zu dürfen. Zunächst gingen beide unter Lachen auf den Handel ein, später aber wurden sie schamhaft; ich habe sie schließlich noch im frühen Morgennebel in unserer dunkeln Barasa auf die Platte bannen müssen.
Eröffnungs- und Schlußfest begleiten auch diesen ersten Unyagokursus der Mädchen. Daß es dabei ebenfalls hoch hergeht, habe ich an allen drei Orten, wo ich das Chiputu oder Echiputu durch meine Gegenwart zu verherrlichen Gelegenheit gehabt habe, persönlich verfolgen können. Der Durst ist bei dem vielen Tanzen erklärlich!
Knabe und Mädchen werden nun allmählich heiratsfähig; ich habe mich immer wieder bemüht, das Heiratsalter für beide Geschlechter wenigstens annähernd festzustellen, es ist mir jedoch nicht recht gelungen. Die Individuen selbst sind, wenn man sie nach ihrem Alter fragt, stets ungeheuer erstaunt über eine solche Frage — wie soll ich wissen, wie alt ich bin? will der Blick, mit dem sie den Frager messen, bedeuten —, den Angehörigen aber ist das Alter der Familienglieder ganz gleichgültig. Im allgemeinen wird sehr früh geheiratet; der beste Beleg dafür sind die noch recht jungen Mütter, die sich in jeder größeren Volksversammlung vorfinden, blutjunge Dinger, meist nicht viel weiter entwickelt als unsere Konfirmandinnen. Nach Matola ist früher die Massanjeheirat sehr häufig gewesen; bei[S. 372] ihr wurden schon ganz junge Kinder von 5 bis 7 Jahren miteinander verbunden; man baute ihnen Hütten, in denen sie wohnen mußten. Ab und zu soll diese Einrichtung auch heute noch vorkommen. Nach demselben Gewährsmann herrscht sodann allgemein der Brauch, daß, wenn eine Frau geboren hat, während ihre Nachbarin dem freudigen Ereignis erst noch entgegensieht, jene erste sagt: „Ich habe einen Sohn; bekommst du eine Tochter, so sollen die beiden einander heiraten“, oder aber: „Ich habe eine Tochter, bekommst du einen Sohn, so sollen die beiden einander heiraten.“ Dies geschieht denn auch.
Der Neger ist ein Bauer, nicht nur seinem Berufe nach, sondern auch, wenn er auf die Freite zu gehen sich anschickt; auf keinem anderen Gebiet ist die Gesinnungsverwandtschaft mit unserem Landvolk tatsächlich so verblüffend wie gerade bei dem wichtigen Geschäfte der Werbung. Um es kurz auszudrücken: der verliebte Negerjüngling ist zu schüchtern, um durch eine kühne Tat sein Glück selbst zu schmieden, er benötigt dazu eines Freiwerbers; ganz wie unsere ländlichen Heiratskandidaten auch. Die gegebene Persönlichkeit für dieses Amt ist der eigene Vater; dieser macht unter irgendeinem Vorwand bei den Eltern der präsumtiven Braut seinen Besuch und bringt im Laufe der Unterhaltung das Gespräch auf die Heiratspläne seines Sprößlings. Geht die Gegenpartei auf die Angelegenheit ein, so ist sie auch bald zu einem befriedigenden Abschluß geführt, sofern nämlich auch die Maid einverstanden ist. Die jungen Mädchen sind in Wirklichkeit durchaus nicht in dem Maße bloß Sache, wie wir anzunehmen geneigt sein möchten, sondern sie wollen sehr wohl um ihre Zustimmung angegangen sein, und mancher schöne Heiratsplan zerschlägt sich lediglich aus dem Grunde, weil die junge Dame einen andern liebt. Auch in dieser Beziehung besteht also nicht der mindeste Unterschied zwischen Weiß und Schwarz. Selbstverständlich sind nicht alle Negermädchen Heldinnen des Willlens und der Standhaftigkeit; so manche läßt sich überreden, statt des heimlich geliebten jungen Stammesgenossen einen ihr gleichgültigen alten Herrn zu nehmen; dann läuft sie jedoch, wie das auch anderswo[S. 373] vorkommen soll, Gefahr, von den Gespielen aufgezogen zu werden. Der „junge“ alte Ehemann aber darf ziemlich sicher sein, daß nicht er es allein ist, der die Gunst seiner jungen Frau genießt.
Die Heirat ist ein Geschäft, so denkt der Neger, ganz im Sinne seiner sonstigen Psyche; der Kontrakt gilt denn auch erst in dem Moment als abgeschlossen, wo die beiderseitigen Väter sich über die Höhe des vom Bräutigam zu zahlenden Brautgeschenkes geeinigt haben. Die Leute hier im Süden sind arm, sie haben weder große Herden breitstirniger Rinder, noch auch blökendes Kleinvieh, der ganze Brautkauf, wenn das Wort überhaupt eine Berechtigung hätte, besteht demnach lediglich in der Überreichung einer nicht einmal großen Menge Zeugstoffes.
Ethnographisch viel anmutender als die soeben skizzierte Yaowerbung ist das Verfahren bei Makonde und Makua. Bei diesen treten zwar zunächst auch erst die beiden Väter einander näher, doch sind sie im Grunde genommen nur Vorpostenlinie; die eigentliche Hauptschlacht wird nachher von den Müttern geschlagen, denen entweder ihr ältester Bruder oder aber alle Brüder kräftig Sekundantendienste leisten. Aus dem hier noch in voller Blüte stehenden Mutter- oder Neffenrecht heraus ist die Zuziehung gerade dieser Elemente auch ganz erklärlich.
Von der Standhaftigkeit junger Negermädchen weiß übrigens Nils Knudsen eine nette, kleine Geschichte zu erzählen, in deren Mittelpunkt er sogar selbst als Held steht. In seiner langjährigen Vereinsamung auf Luisenfelde und im Verfolg seines vollkommenen Aufgehens im Volkstum der Wayao hatte sich der blonde Nils einstens auch ein schwarzes Weib genommen. Noch jetzt, nach Jahren, rühmte Knudsen die Tugenden dieser Chipiniträgerin; hübsch sei sie gewesen und häuslich und wirtschaftlich auch, einen ganz ausgezeichneten Ugali habe sie gemacht, und was es an Hausfrauentugenden im Busch noch mehr gibt. Da habe es das Schicksal einstmals gewollt, daß er, seiner Jagdleidenschaft frönend, an den Rovuma[S. 374] gezogen sei; schon nach wenigen Tagen sei er aber heimgekehrt. Müde und abgespannt, mit dem breiten, pendelnden Seemannsschritt, den Nils sich noch aus seiner jäh abgebrochenen Schiffsjungenzeit bewahrt hat, schreitet er seiner primitiven Behausung im Angesicht des stolzen Herrenhauses zu; alles ist still, nichts rührt sich diesmal, im Gegensatz zu sonst, wo das schwarze Weibchen mit dem verschämten Lächeln, wie es eben nur der jungen Negermaid eigen ist, dem blonden Herrn und Gebieter freudig entgegenschritt. Immer noch ahnungslos betritt der Jäger die Küche, den gewohnten Aufenthaltsort der stets Fleißigen; sie ist leer; ebenso das Schlafgemach; desgleichen der Wohnraum mit seiner mehr als dürftigen Ausstattung. Deren Hauptstück ist, wie in jedem afrikanischen Haushalt, der Tisch; auf ihn fallen unwillkürlich die Blicke des Suchenden, und hier findet er endlich auch ein Lebenszeichen und zugleich die Aufklärung über das Vorgefallene. Ein wirres Knäuel ist es, von derber Bastschnur, aber sie ist bis zum Übermaß verknotet. Nils Knudsen hat später die Knoten gezählt; ihrer siebzig sind es gewesen; die Bedeutung des Ganzen war nach den Erklärungen der Stammesweisen: „Siehe, mich haben meine Verwandten von dannen geführt; sie sehen es nicht gern, daß ich mit dem weißen Mann zusammenlebe; ich soll einen schwarzen Mann heiraten, der weit drüben jenseits des Rovuma wohnt. Aber selbst wenn ich so viele Jahre alt werden sollte, wie der Faden Knoten zeigt, ich nehme den schwarzen Mann nicht, sondern bleibe dir, dem Weißen, treu.“ So lautete Nils Knudsens Erzählung; teils mit Rührung, teils mit dem Stolz umworbener Männer schloß er daran die fernere Mitteilung, daß das Mädchen seinen Schwur tatsächlich halte; es säße weit im Innern von Portugiesisch-Ostafrika, ganz in der Nähe des ihm bestimmten Mannes, doch selbst der härteste Druck seiner Verwandten sei nicht imstande, seinen starken Sinn zu beugen. — „Die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn!“
Sehr nüchtern ist die Negerhochzeit; fast könnte man sagen, sie existiert gar nicht. Verlobung und Hochzeit, wenn man so sagen[S. 375] darf, fallen zeitlich zusammen, denn sobald der Heiratskandidat die Zustimmung der maßgebenden Faktoren erlangt hat, besteht keinerlei Hindernis mehr für das Zusammenziehen des Pärchens; höchstens, daß erst eine neue Wohnhütte für die jungen Leute errichtet werden muß. Und wenn diese bezogen ist, dann beginnt jener für das Empfinden von uns schlechten Europäern so seltsame Schwiegermutterdienst, von dem ich früher bereits gesprochen und geschwärmt habe. Kommt, laßt uns in uns gehen, auf daß wir uns bessern! Dann würden wir doch in einer Beziehung die Kulturhöhe des Negers erklimmen!
Nun aber setzt das Kapitel der gegenseitigen Heiratsmöglichkeit ein. Wer darf einander ehelichen, und wem ist es durch altgeheiligten Brauch verboten? Nicht einmal bei uns Weißen ist diese Frage belanglos, um wieviel weniger aber bei Leuten, die sich in sozialer Hinsicht den Urzuständen der Gesellschaft noch ein gut Teil näher befinden als wir demokratisierten Vertreter der sogenannten Vollkultur. Gehört es für die Weisen eines australischen Stammes zu den höchsten Problemen der Sozialwissenschaft, einwandfrei und fehlerlos auszurechnen, welche Maid aus der näheren oder weiteren Umgebung gerade der Jüngling A des Stammes heiraten darf, und welche für den Jüngling B in Frage kommen kann, so ist es auch für die Heiratslustigen am mittleren Rovuma nicht belanglos, wohin ihre Neigung fällt.
Es ist am Spätnachmittag; in der Barasa von Newala kauern 15 schwarze Männer würdigen Alters, wie schon Wochen hindurch, auf der großen Matte; von Zeit zu Zeit erhebt sich einer der Alten mühselig, verläßt mit steifgewordenen Beinen den Raum, kommt aber stets nach kurzer Zeit wieder. Die Halle ist heiß, ein übler Dunst liegt über der Versammlung, so daß der Europäer im gelben Khakianzug, der so eifrig an seinem Klapptisch schreibt, sich wieder und wieder an die schmerzende Stirn greift. Die Versammlung ist sichtlich müde, sie hat aber heute auch ein gar zu schwieriges Arbeitsfeld betreten. Stunde um Stunde habe ich, denn ich bin der Mann[S. 376] mit den Kopfschmerzen, erst Nils Knudsen die Grundzüge der menschlichen Ehegebräuche, der verschiedenen Stammesaufteilungen, des Totemismus, des Vater- und des Mutterrechts, kurz einer ganzen Reihe von Punkten aus der Soziologie klarzumachen versucht, mit nur sehr mäßigem Erfolg, wie ich mich bei jeder meiner Fragen überzeugen muß. Jetzt gilt es, im Bunde mit Sefu, dem sonst so Gewandten, und dem blonden Norweger, der sich noch immer nicht von seinen Darmstörungen erholen kann, aus den 15 Stammesweisen über alle diese Sachen herauszuholen, was zu holen ist. Von allen den kleinen Mißerfolgen bin ich schon ganz wild geworden, wild und müde zugleich, so daß ich nur eben noch mit einiger Mühe eine Frage in die Gelehrtenrepublik zu schleudern vermag.
„Nun, alter Dambwala, du bequemer Mann, du hast einen Sohn, nicht wahr?“
„Jawohl, Herr.“
„Und du Nantiāka, alter Don Juan, du hast eine Tochter, nicht wahr?“
„Jawohl, Herr.“
„Schön, kann denn nun dein Sohn, Dambwala, hier die Tochter von Nantiāka heiraten?“
„Nein.“
„Und warum nicht?“ Ich muß wirklich sehr müde und abgespannt sein, denn selbst die verwunderte Bestimmtheit, mit der das „nein“ herauskommt, erweckt in mir keine sonderlich erwartungsvollen Gefühle. Ich horche erst auf, als in der nun erfolgenden Begründung jenes „nein“ das Wort Litaua an mein Ohr schlägt. „Nini litaua? Was ist Litaua?“ frage ich jetzt, schon völlig ermuntert und aufgefrischt. „Nun, Litaua ist Litaua.“ Langes Schauri; auch die schwarzen Intelligenzen, die gleich uns Weißen schon halb eingedöst waren, sind wieder zu geistiger Rührigkeit erwacht; Kimakonde, Kiyao und Imakuani, alle drei Sprachen tönen wie im Kaffeekränzchen durcheinander. Endlich ist die Definition gefunden; in die Fachsprache[S. 377] übersetzt, lautet sie: die Litaua ist der mutterrechtliche, exogamische Geschlechtsverband, der alle diejenigen umfaßt, die von einer Urmutter abstammen; es erbt nicht der Sohn des Vaters, sondern einer der Söhne der Schwestern, und der junge Makonde nimmt sein Weib nicht aus der eigenen Litaua, sondern er sucht sie sich in einer der vielen andern Mataua. Bei den Makua sei das gerade so, dort aber hieße die Litaua Nihimmu.
Den Abend dieses Tages — es ist der 21. September gewesen — habe ich mit dem Gefühl durchlebt, auf einen der erfolgreichsten Abschnitte meiner ganzen Afrikareise herabblicken zu können; um ihn zu feiern, haben Knudsen und ich statt der einen Flasche Bier, die wir uns sonst ehrlich teilten, uns diesmal deren zwei geleistet.
„Bier? Ja, woher habt ihr denn auf einmal Bier?“ Jedes Volk hat seine Sitten, jedes Volk hat seinen Trank, so möchte ich dichten, gleichzeitig indes hinzufügen, auch jeder Örtlichkeit ist ihr besonderes Getränk angepaßt. Im heißen Tiefland Bier? Brrr! Aber hier oben, den Wolken nahe und im kühlen Novemberost der Abende, hei, da wäre ein Becher deutschen Bieres wohl angebracht. Wie eine Eingebung ist mir vor Wochen der Gedanke durch den Kopf gefahren; gerade trifft es sich, daß ein Dutzend Lasten ethnographischer Sammelstücke nach Lindi hinunter müssen. Schon am nächsten Morgen schreiten zwölf starke Männer eiligen Schrittes gegen Nordosten der fernen Küste zu; wenn sie sich nicht aufhalten, werden sie in zwei Wochen wieder zurück sein. In allen früheren Fällen ist mir der voraussichtliche Termin der Rückkehr meiner Boten ziemlich gleichgültig gewesen; diesmal haben wir beiden Weißen, ehrlich gestanden, die Tage gezählt, und als sich an einem Sonntagvormittag weit draußen im Busch das unverkennbare Getöse von Wanyamwesiträgern, die dem Endpunkt ihrer Reise zueilen, vernehmen ließ, da sind wir der großen Kiste entgegengeeilt, die für uns so viel Schönes und Langentbehrtes barg, nicht bloß schweren, deutschen Porter von Daressalam, sondern vor allem die so lang vermißte Milch, die uns beiden[S. 378] gegenwärtig stark abgemagerten Einsiedlern mehr als alles andere nottut.
An jenem für mich denkwürdigen Nachmittage indessen hatte ich durchaus keine Muße, an die materiellen Genüsse zu denken.
„Also dein Sohn, Freund Dambwala, kann Nantiakas Tochter nicht heiraten, weil ihr derselben Litaua angehört; wie heißt denn deine Litaua?“
„Waniuchi.“
„Und wo wohnt ihr?“
„In und um Niuchi.“
„Und du, Kumidachi,“ wende ich mich an einen andern, mit einer funkelnagelneuen, buntbestickten Jumbenmütze bekleideten Alten, „welcher Litaua gehörst du an?“
„Nanyanga“, tönt es prompt zurück. Blitzschnell ist der Name niedergeschrieben; schon ruht mein Auge fragend auf dem nächsten der Weisen. Der weiß jetzt schon, worum es sich handelt, denn er ist einer von den klügsten. „Wamhuīdia“, kommt es von seinen Lippen.
Aber so darf ich nicht weiter arbeiten; was ist ein Name? Schall und Rauch; auch die Bedeutung muß ich kennen. Schon von meinen Namenstudien her weiß ich, wie gern die Neger sich mit etymologischen Erklärungen befassen; es bedarf auch hier nur eines kleinen Anstoßes, um der Nennung des Litauanamens sofort die Bedeutung des Wortes folgen zu lassen. Das Wort „Waniuchi“ habe ich mir selbst als „die Leute von Niuchi“ übersetzt; in den hiesigen Bantusprachen bedeutet ja das Präfix wa nichts anderes; doch die Übersetzung genügt den schwarzen Philologen nicht, niuchi heiße die Biene, und die Waniuchi seien Leute, die den Honig dieser Bienen in den Bäumen suchten; die Nanyanga aber, das seien die Flötenbläser im Kriege, nanyanga sei die Makondeflöte. Die Wamhuidia endlich hätten ihren Namen von ihren kriegerischen Vorfahren; diese hätten fortwährend Krieg geführt und alles niedergeschlagen; der Sippenname käme her vom Verbum muhidia, niederschlagen.
[S. 379]
Die alten Herren haben an jenem Nachmittag trotz ihrer starken Müdigkeit viel länger ausharren müssen als sonst; ich hatte Blut geleckt und habe sie ausgesogen, bis ihr armes, des angestrengten Denkens so ungewohntes Gehirn um Sonnenuntergang schließlich völlig versagte. Doch einen Extra-Bakschisch hat es gegeben als Lohn für die aufopferungsvolle Hilfe bei dem schwierigen Kapitel. Selbst Moritz, der Finanzminister, hatte heute nicht seinen gewöhnlichen melancholischen Hängemund, sondern verzog sein braunes Negergesicht zu einem freundlichen Grinsen, als er nach Feierabend hinging, um den Gelehrten das funkelnagelneue Silberstück in die Hand zu drücken. Seitdem habe ich das Sippenwesen mit aller Ausdauer zu ergründen versucht, und ich muß gestehen, ich weiß nicht, worüber ich mehr staunen soll: über die soziale Differenzierung der Stämme unter sich, ihren Zerfall in ungezählte Mataua und Dihimmu (Plural von Nihimmu), oder über die Tatsache, daß, wie ich annehmen muß, keiner meiner Vorgänger auf dem hiesigen Beobachtungsfelde auf diese Einrichtung aufmerksam geworden ist. Ich wundere mich in der Tat über diesen Punkt, aber wenn ich es mir überlege, habe ich doch kaum Anlaß dazu; zunächst bin doch auch ich monatelang im Lande umhergezogen, ohne von jenem Sippenwesen das Geringste zu ahnen; sodann aber ist es lediglich Zufall, daß in jenem denkwürdigen Schauri vom 21. September die Antwort gerade in der geschilderten Form fiel. Glück muß der Mensch haben, der Forschungsreisende aber viel Glück!
Es bedarf keines Hinweises, daß ich nach jener folgenschweren Entdeckung auch sofort wieder auf das Yaoproblem zurückgekommen bin. Als von meinen Makua- und Makondemännern ein Sippenname nach dem andern mitsamt den schönsten Erläuterungen mir ins Notizbuch diktiert wurde, sprach Nils Knudsen das große Wort: „Ja, so was haben die Yao auch.“ Zehn Minuten später waren bereits schnellfüßige Boten unterwegs, um unten aus der Ebene von Wayaomännern heraufzuholen, was irgendwie auf einige Intelligenz Anspruch machen durfte. Sie sind auch alle gekommen,[S. 380] die Entbotenen: Susa und Daudi und Massanjara und wie sie heißen. Leicht war das Examen auch jetzt noch nicht, weder für mich, noch für die Auspressungsobjekte, aber ich habe nach redlichem Mühen doch noch so viel herausbekommen, um sagen zu können: „Nils hat wirklich recht, auch die Yao haben so etwas“, ja bei ihnen ließ sich sogar unschwer eine Doppeleinteilung in der Art feststellen, daß über den exogamischen mutterrechtlichen Sippen noch eine Einteilung in große Gruppen besteht, die von jener feineren Einteilung ganz unabhängig sind.
Von den großen Gruppen des Yaovolkes, das heute über einen außerordentlich großen Teil Ostafrikas verteilt ist, indem es vom Schirwasee im Süden bis fast vor die Tore von Lindi im Norden reicht, kennen wir die folgenden: die Amakāle in der Region der Rovumaquellen; die Achinamatāka oder Wamwembe bei Mataka zwischen dem Rovuma und dem Ludjende; die Amassaninga, ursprünglich am Südende des Nyassasees; die Achinamakanjīra oder Amachinga am oberen Ludjende; die Mangoche in der Nachbarschaft von Blantyre. Die Angabe der Wohnsitze dieser großen Gruppen, wie sie hier erfolgt ist, hat heute nur noch einen historischen Wert. Durch die von mir früher schon geschilderte, ganz allmählich erfolgte Abwanderung großer Volksteile sind die alten Gruppengrenzen längst verwischt und kartographisch heute gar nicht mehr festlegbar. Auch die Makosyo (Plural von lukosyo, die Sippe) lassen sich kartographisch unmöglich festlegen, weder hier noch bei den andern Völkern; einzelne dieser Geschlechtsverbände haben wohl ein bestimmtes Verbreitungszentrum, im allgemeinen aber herrscht im Kleinen dasselbe Durcheinander wie im Großen.
Ich habe nicht aus Neugier so zäh nach der Bedeutung der Sippennamen geforscht, sondern hauptsächlich aus folgendem Grunde. In der menschlichen Urgesellschaft ist kaum etwas so auffallend wie die weitverbreitete Einrichtung des Totemismus. Das Wort Totem kommt aus Nordamerika und bedeutet ursprünglich den Namenszug[S. 381] wackerer Irokesenhäuptlinge, mit dem sie ihre Verträge mit dem Blaßgesicht unterzeichneten. Dies geschah nicht in der Form schlanker Schriftzüge, sondern in der einer ungefügen Zeichnung, die eben das Totem darstellte, das Stammestier, von dem die Sippe des Unterzeichners ihre Abstammung herleitete. Bei den amerikanischen Indianern hat man diesen Totemismus, wie man die Erscheinung in der Völkerkunde nennt, im weitesten Maße verbreitet vorgefunden und auch zuerst gründlich studiert, später hat man indes festgestellt, daß der gleiche Totemismus auch anderswo in trefflichster Ausbildung vorhanden ist; in Australien, anscheinend auch in Melanesien, in ausgeprägtester Weise sodann bei sämtlichen alten Völkerschichten in Vorderindien, und sonst noch hie und da. In den meisten Fällen leiten die Sippen ihre Herkunft von einem Tier ab. Dieses gilt dann als heilig und unverletzlich und darf meist nicht gejagt und gegessen werden, ja in vereinzelten Fällen gilt es sogar als die höchste Ehrung und das größte Glück für den Menschen, von dem Totemtier seinerseits gefressen zu werden! Auch kleine, ungefährliche Tiere, Insekten und dergleichen, werden als Totem gewählt, desgleichen auch Pflanzen; wo sollten z. B. bei den unzähligen Totems in Südindien die erforderlichen großen Tiere herkommen? Ich kann hier nicht die ganze, lange Reihe der von mir gesammelten Sippennamen für alle drei Völker aufzählen, sondern muß auch für diesen Teil meiner Ergebnisse auf die amtliche Publikation hinweisen. Aber interessant ist es mir doch gewesen, zu sehen, daß zwar kein den Eingeborenen bewußter Totemismus mehr besteht, daß aber doch mancher kleine Zug an sein früheres Vorhandensein erinnert. Diese Züge im einzelnen nachzuweisen, wird eine hübsche Aufgabe späterer Untersuchungen sein.
Von der Art der Sippennamen hier nur einige Beispiele.
Matola wie auch sein Vetter, unser gemeinsamer Freund Pastor Daudi, gehören der Lukosyo der Achemtinga an, gleichzeitig aber auch zu der großen Gruppe der Amachinga. Das Präfix che- (auch ku-) hat die Bedeutung Herr oder Frau; Chemtinga aber ist nach[S. 382] Daudi ein großer Yaohäuptling in der Region des oberen Ludjende gewesen.
Im Gebiet des bärtigen Susa sitzen die Masimbo. Diese haben ihren Namen von den Fallgruben (Kiyao: lisimbo, Plural: masimbo), in denen ihre Vorfahren das Wild fingen. Bei Mwiti sitzen die Amiraji. Ihren Namen führen die Angehörigen dieser Sippe auf die Art ihrer ursprünglichen Wohnsitze zurück; diese hätten in bambusreichen Gebieten gelegen (mlasi, der Bambus). Eine Yaosippe sind auch die Achingalla; sie leiten ihren Namen von der Ngalla her, einer Muschel im Rovuma und seinen Nebenflüssen, deren Schale noch heute als Eßlöffel gebraucht wird; den Namen aber hat die Sippe deswegen, weil sich die Urväter vorwiegend von dem Tier selbst genährt haben.
In die gleiche Kategorie wie die Achingalla gehört die Makuasippe der Wamhōle; ihre Vorfahren haben sich vom mhole, dem wilden Maniok, einer auch noch heute in Zeiten der Not gegessenen Waldwurzel, genährt. Die Makondesippe der Nambunga führt ihren Namen auf den Genuß der Bambusfrüchte, nambunga, seitens ihrer Vorfahren zurück; die Wantanda hatten vordem die Gewohnheit, das Fleisch des erlegten Tieres in lange Streifen (nantanda) zu schneiden. Die Wamunga sind Reispflanzer; die Voreltern der Alamande haben sich von einer kleinen Heuschrecke dieses Namens genährt; die Wutende schließlich sind Leute, die im ganzen Lande berühmt sind wegen einer Eigenschaft, die wir gerade beim Neger so wenig vermuten: weil sie immer und unausgesetzt arbeiten (kutenda), heißen sie Wutende.
In das Eherecht dieser Sippen sich hineinzudenken, ist selbst im kühlen Uleia nicht ganz leicht. Hier im tropischen Afrika mit seinem ewigen Wechsel von heiß und kalt ist es eine für mich schier unlösbare Aufgabe, den Ausführungen des alten Mponda, meines Hauptprofessors für bürgerliches Recht, zu folgen. Es geht uns doch auch gar zu sehr gegen den Strich, wenn man folgendes zu hören bekommt: Ist der Makondeknabe beschnitten, so kehrt er nicht in das[S. 383] Elternhaus zurück, sondern verbleibt bei seinem Oheim mütterlicherseits. Dort hat er weiter nichts zu tun, als heranzuwachsen und gleichzeitig das Heranwachsen seiner Basen zu erwarten. Ist aber der Onkel nicht im glücklichen Besitz von Töchtern, so wartet der geduldige Neffe zunächst deren Geburt ab; ist diese erfolgt, so geht das Warten noch lustig weiter. Das heißt, müßig darf der junge Mann in seiner „Pension“ nicht sein, sondern er muß tüchtig arbeiten, einem Jakob gleich, der um Rahel sieben lange Jahre diente. Endlich ist das Ziel erreicht, die Base ist groß und heiratsfähig; dann geht der mittlerweile recht verständig gewordene Heiratskandidat hin, erwirbt um eine Rupie Zeug, gibt dies dem Oheim und führt die Braut heim. Wegziehen darf er auch jetzt noch nicht, sondern er verbleibt in der Nähe des Oheims und dient ihm gleichsam als Höriger weiter. Nun bekommt er selbst Familienzuwachs, sagen wir einen Sohn. Nach Mponda muß dieser Sohn wiederum eine Base heiraten, und zwar die Tochter der Schwester seines Vaters. In Mpondas lapidare Worte gekleidet, lautet dieses Gesetz folgendermaßen: „Habe ich eine Schwester, und die hat eine Tochter, ich aber habe einen Sohn, so kann dieser Sohn jenes Mädchen heiraten; habe ich aber einen Bruder, und der hat eine Tochter, ich aber habe einen Sohn, so kann dieser Junge seine Base nicht heiraten, denn sie ist numbŭ́we, seine Schwester.“
Wir haben das junge Mädchen verlassen in dem Augenblick, wo es, dem Chiputu mit seinen monatelangen Formalitäten und Festen entronnen, in die Zahl der Wissenden aufgenommen worden ist. Nach einigen meiner Gewährsmänner soll die Verheiratung des Kindes sehr bald nach diesem Zeitraum erfolgen, jedenfalls noch vor dem Zeitpunkt, mit dem wir in Europa die Mannbarkeit beginnen lassen, vor der ersten Menstruation. Ob dem so ist, kann ich nicht kontrollieren; uns interessiert an dieser Stelle auch weit mehr die weitere Behandlung des jungen Weibes selbst, um so mehr, als diese Behandlung wieder Parallelen in einer ganzen Reihe von Gebieten der Erde besitzt. Genau wie an der ganzen Küste von Unterguinea, in Loango, am Gabun[S. 384] und Ogowé, sodann in verschiedenen Teilen Melanesiens, wird das Mädchen auch hier für einige Tage in eine besondere Hütte gebracht, wo es vollkommen allein bleibt; die Freundinnen kommen zwar an die Hütte heran, sie trillern und tanzen, daß es eine Art hat, halten sich aber sonst fern. Dafür beginnen jetzt die Mutter, die Lehrerin und die anderen weisen Frauen einen sehr eindringlichen Kursus von Verhaltungsmaßregeln: fern müsse sie sich von jedem halten, auch auf Reinlichkeit sehen, müsse baden und sich waschen, aber vor allem mit niemandem zusammenkommen. Dies wird immer und immer wiederholt; dabei wird ohne Unterlaß gegessen, gesungen und getanzt.
Auch bei der ersten Schwangerschaft der jungen Frau werden verschiedene Feste gefeiert. Im Grunde genommen sind diese jedoch nur der angenehme Rahmen für einen Haufen von Verhaltungsmaßregeln und Verboten, die wieder aus dem Munde der älteren Frauen auf das mehr oder minder ahnungslose junge Wesen herniederregnen. Im fünften Monat rasiert man ihr zunächst den Kopf; nach einem weiteren Monat rüsten die Frauen für sich selbst ein Fest, für die Schwangere aber röstet man Mais und zerstampft ihn, nachdem man die Körner im Wasser hat quellen lassen; den entstandenen Brei schmiert man der jungen Frau auf den Kopf. Jetzt geht der Ehemann in den Busch, mit ihm eine nahe Verwandte seiner Frau. Der Mann schickt sich an, in der uns bekannten Weise Rindenstoff herzustellen, die Verwandte aber entkleidet sich bis auf einen ganz kleinen Schurz. Und sitzt dann der Mann über seinem Baum und hämmert auf den werdenden Stoff, so singt das Mädchen im Takt dazu: „Nalishā́nira wozēwa neakutĕnde.“ Den fertigen Stoff bestickt man mit Perlen, dann hängt ihn die Lehrerin ihrem Schützling als Amulett um den Hals; mare ndēmbo heißt dieser Talisman, mare ndembo heißt von jetzt ab auch die Schwangere.

Der nächste Morgen versammelt wieder alle Leute zu Tanz, Gesang und Händeklatschen; darein mischt sich natürlich der unvermeidliche hohe Frauentriller, ohne den keine frohe Stimmung, kein freudiges[S. 385] Geschehnis denkbar ist. Doch nicht alle nehmen an dieser Freudigkeit teil; von der Menge abgesondert, umstehen die weisen Frauen und die Lehrerin das junge Weib.
„Du darfst nicht,“ so erschallt es aus dem zahnlosen Munde einer der Alten, „auf den Matten anderer Leute sitzen, denn das würde dir und dem Kinde, das du erwartest, schaden, du würdest eine Frühgeburt haben.“
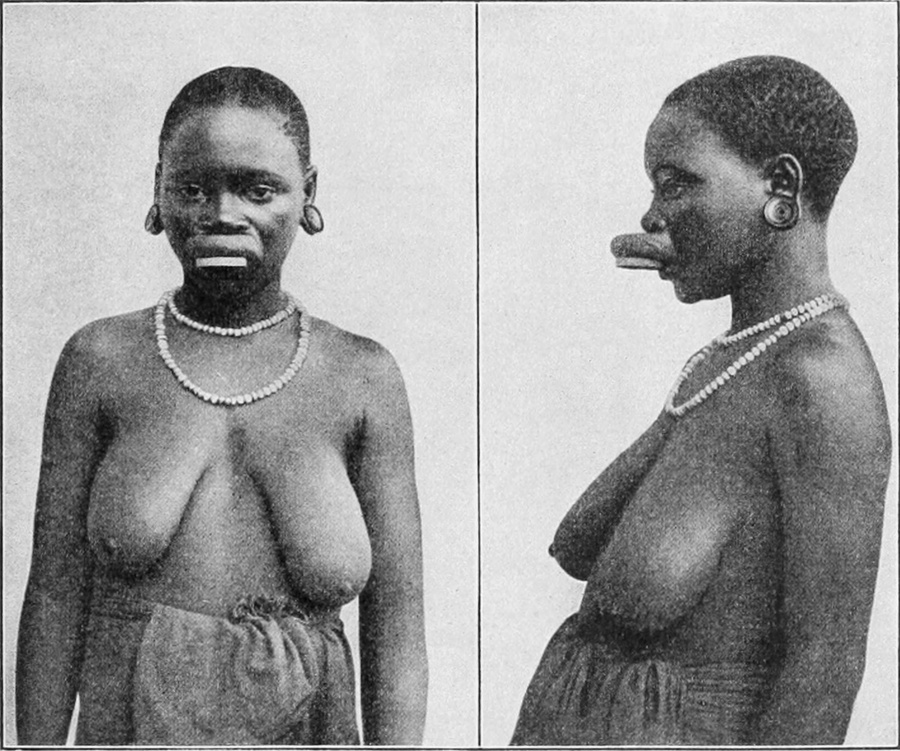
„Du darfst nicht,“ tönt es hinter dem Holzblock hervor, der den Mund der nächsten Sprecherin in riesiger Ausdehnung überdeckt, „du darfst nicht mit Freunden und Freundinnen verkehren, auch das würde deinem Kinde schaden.“
„Du darfst von jetzt ab nur noch wenig ausgehen,“ rät ihr die dritte, „zeige dich möglichst nur deinem Mann allein, denn sonst möchte dein Kind später einem anderen ähnlich sehen. Wenn du aber einmal ausgehst,“ fährt dieselbe Beraterin fort, „dann mußt du allen[S. 386] Leuten weit ausweichen, denn schon der Dunst dieser Leute möchte deinem Kinde schaden.“
Es steckt ungemein viel in diesen Warnungen und Verhaltungsmaßregeln. Uns Europäern ganz geläufig ist die Furcht vor dem Versehen; die Schwangere darf nichts Schreckhaftes sehen und soll auch sonst möglichst keine andere Physiognomie als die des eigenen Mannes auf sich wirken lassen. In allen übrigen Vorschriften kehrt das wieder, was man vielleicht Analogiezauber nennen könnte: schon die Möglichkeit, in den Dunstkreis von Leuten zu geraten, die vorher geschlechtlich miteinander verkehrt haben, bringt das werdende Menschenkind in Gefahr.
Aber damit noch nicht genug; jetzt folgt erst die Hauptsache.
„Du darfst fortan keine Eier mehr essen,“ beginnt eine babybehaftete jüngere Frau mit glattrasiertem Langschädel, „denn sonst wird dein Kind keine Haare bekommen.“
„Iß auch kein Affenfleisch,“ pappelt auch schon eine andere mit zitterndem Pelele dazwischen, „denn sonst wird dein Kind auch so albern wie ein Affe.“
„Iß auch nicht, was vom Vortage in deinem Kochtopf übrig geblieben ist, denn sonst wird dein Kind krank“, fällt die dritte ein.
Jetzt wendet sich die Belehrung wieder einer anderen Richtung zu: „Gehst du in die Schambe oder zum Brunnen, und es grüßt dich jemand, so danke ihm nicht, und sage ihm auch nicht Lebewohl, denn sonst würdest du lange auf die Geburt deines Kindes warten müssen“, rät ihr eine ganz Alte mit sicher sehr viel Erfahrung; eine Jüngere aber fällt wiederum ein: „Wenn dir etwas daran liegt, daß dein Kind ein ordentliches, dichtes Kraushaar bekommt, so höre fortan auf, deine Schamhaare zu rasieren.“ Das ist nämlich sonst allgemeine Sitte im Lande, ebenso wie ja auch der Kopf gern völlig glatt getragen wird. Den Schluß des ganzen inhaltreichen Kollegs, das im Gegensatz zu unserem Hochschulbetrieb von vielen Dozenten, oder, der beim Neger bereits gelösten Frauenfrage entsprechend,[S. 387] von vielen Dozentinnen auf nur eine einzige unglückselige Hörerin herniedergeplappert worden ist, macht die sehr ernsthaft ausgesprochene Warnung, einstweilen unter keinen Umständen mit anderen Männern zu verkehren, denn dann würde sie unfehlbar sterben; wenn aber ihr Mann sich etwa vergäße und ein anderes Mädchen berühre, dann würde sie abortieren und hinterher sterben; sie solle also gut zu ihrem Manne sein und ihm schönen Ugali kochen.
Damit ist endlich das letzte Wort gesprochen. In dem unnachahmlichen, eigentümlich drehenden Gang der Negerin, der sich nicht mit Worten beschreiben läßt, eilen die Beraterinnen, so schnell es ihre Würde zuläßt, auf den Festplatz zu den übrigen. L-l-l-l-l-l-l-l-l schwirrt im gleichen Augenblick auch schon der bekannte hohe Trillerton durch die Luft; die Trommeln, von nerviger Männerfaust geschlagen, setzen von neuem ein; eine gewaltige Staubwolke erhebt sich über dem Ganzen, alles ist in Bewegung und voll echter, des sonstigen Elends gänzlich unbewußter Negerlust. Nur eine sitzt stumm und still dabei, die junge Frau; ihr ist die Teilnahme an diesem Fest gänzlich untersagt, dem soeben empfangenen Lehrkanon zufolge. Ihre braunen Augen, die verdienten, schön genannt zu werden, störte nicht das unreine, von gelblichbraunen Flecken durchsetzte Weiß den Eindruck, schauen sinnend auf ein und denselben Punkt; ob sie wohl der schweren Stunde gedenkt, der sie in wenigen Monaten entgegensieht? Das alte Bibelwort: „Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären“ gilt ja auch für die schwarze Rasse. Aber gleichwohl, ich für meine Person glaube nicht, daß das junge Ding in solche Fernen vorausschaut; dies liegt an sich schon nicht im Wesen der Jugend, die Zukunft Afrikas aber hat erst recht keine Veranlassung, mit Sorgen in die Zukunft zu schauen. O du glückliche Negerrasse, wie beneidenswert bist du in deiner Fähigkeit, nur dem Heute zu leben und dem Morgen seine Sorgen ganz und ungeteilt allein zu überlassen! Heute ist heut, das ist deine Devise.
Newala, 10. Oktober 1906.
„Morgen muß ich fort von hier und muß Abschied nehmen.“ Africa non cantat, habe ich immer geglaubt. Der unmusikalische Nils ist niemals über die Anfangsworte seiner nordischen Nationalhymne hinausgekommen, während ich, und zwar stets nur beim Anblick von Mambo sasa, lediglich das Thema: „Das ist nun mal so Sitte“ aus der „Fledermaus“ flötend habe variieren können. Doch heute, nach so vielen Wochen Newala, da habe auch ich mich endlich zu einem wirklichen deutschen Kantus emporzuschwingen vermocht. Die Stimme war von dem langen Schweigen doch etwas eingerostet.
A propos Fledermaus. Ich muß auch in bezug auf sie einer Art Ahnung gefolgt sein, indem ich in Berlin meinen fünf Dutzend unbespielten phonographischen Aufnahmewalzen ein ferneres halbes Dutzend bespielte beifügte, mit denen ich den grimmen Sinn der afrikanischen[S. 389] Wilden zu besänftigen gedachte. An der Auswahl dieser sechs Musikstücke bin ich gänzlich unschuldig, ich habe sie derselben Verkäuferin überlassen, die mir die Zusammenstellung des übrigen phonographischen Instrumentariums besorgt hat. Ob die betreffende junge Dame eine genaue Kennerin der Negerpsyche gewesen ist, oder worauf sie sonst ihre Auswahl gegründet hat, ich weiß es nicht, Tatsache aber ist es, daß zwar nicht alle sechs, wohl aber die größere Hälfte dieser Walzen ungeheuer gefällt. Ein amerikanischer Marsch macht mit Recht keinerlei Eindruck; auch ein Liederpotpourri fesselt mein schwarzes Publikum nur wenig; es scheint sich nichts dabei denken zu können. Dann folgen in dem Programm, dessen Aufstellung ich stets Nils Knudsen überlasse, schon damit er endlich einmal mit dem Phonographen umzugehen lernt, „Die beiden kleinen Finken“. Verständnisvoll leuchtet da und dort ein Augenpaar auf, wenn das Vogelgezwitscher anhebt, und blitzende Gebisse zeigen sich hinter der brusthohen Lehmwand, die den Innenraum unserer Barasa von dem Außengang abschließt. Und dann kommt „Der Specht“. Mit tiefem Bierbaß hallt es aus dem Trichter heraus: „Der Spächt, Xylophonsolo des Herrn Müller, Original-Columbiawalze.“ Mit förmlich aufgerichteten Ohren, fast fieberhaft erregt, beugt sich die ganze schwarze Gesellschaft über den Rand; nur die Alten, Erfahrenen, die schon an der Küste gewesen sind und daher das Recht haben, blasiert zu erscheinen, markieren ein verständnisvolles Lachen. Doch dieses Lachen verstummt, sobald die wirklich reinen, von keinem Nebengeräusch entstellten Töne meines Apparates die unverkennbaren Laute gerade des Xylophons aufs treffendste vortäuschen. Man merkt, die Leute haben doch etwas Gehör und empfinden die Harmonie der Töne vielleicht so wohltuend wie wir. Und zudem: diese Töne sind ihnen ja durchaus nichts Fremdes, denn das Mgoromondo, das uns bereits bekannte Strohxylophon, hat genau die gleiche Klangfarbe. So strahlt denn auch, wenn zum Schluß das Klopfduett einsetzt, alles an den Leuten: die Augen, die Zähne, das ganze Gesicht, ja der ganze Kerl, denn immer enger haben sie sich[S. 390] aufeinandergepreßt, und kühl ist es zur Stunde gerade auch nicht. „Die Schmiede im Walde“ bringt kaum eine Steigerung des negroiden Lustgefühls; sichtlich ist dieses Gefühl außerordentlich groß und ganz allgemein, aber der Schmied ist ihnen ja etwas Alltägliches, und den Hammertakt mit seinem Rhythmus kennen sie so gut wie wir. Doch nun das Bravourstück. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß, wenn ein Weißer in langer Abgeschlossenheit und unter Wilden von der Höhe des Kulturmenschen mehr oder minder herabsinkt, das Bestreben, wieder emporzuklimmen, sich zuerst auf musikalischem Gebiet geltend macht. Nils Knudsen kann die „Fledermaus“ siebzehnmal hintereinander hören und hat immer noch nicht genug; das sei wahre, echte Musik, meint er, und zieht den Apparat von neuem auf. Auch den Schwarzen gefallen die kecken, frischen Weisen außerordentlich, und wenn es nun gar die Stimmung des Augenblicks will, daß ich mich zu ein paar Polka- oder Walzertakten hinreißen lasse und mit meinen 180 Pfund, einer Elfe gleich, um den Phonographentisch schwebe, dann ist das Entzücken der Hörer unbeschreiblich. Das ist dann aber auch der richtige Augenblick, wo ich in den Stand gesetzt werde, den Spieß umzudrehen und nunmehr die Herren Schwarzen als Akteure auftreten zu lassen. Die hiesigen Eingeborenen sind in dieser Richtung verwünscht unzugänglich; schon die Männer sind nur in der auf solche Weise herbeigeführten Ekstase vor den Trichter zu bringen, von den Frauen ganz zu schweigen; diese sind wie der Wind davon, wenn man sie einmal haben will.
Auch die Männer sind mir hier oben in Newala einmal eine Zeitlang weggeblieben. Ich saß schon ziemlich tief in meinen Sprachaufnahmen, in die ich mich in den letzten Wochen immer mehr verrannt habe, so daß mir meine wachsende Vereinsamung zunächst nicht auffiel. Erst als Knudsen und ich kaum noch etwas anderes zu Gesicht bekamen als die Gestalten meiner drei Sprachmenschen, des Akiden Sefu, des Yaolehrers Akuchigombo, zu deutsch: Herr Zahnbürste, und seines Adjunkten, des Makualehrers Namalowe, zu[S. 391] deutsch: Herr Echo, da wurde es mir immer klarer, daß ein mir einstweilen noch verborgener Umstand die Ursache für dieses „Geschnittenwerden“ seitens der Eingeborenen sein müsse. Weder Sefu noch die beiden Lehrer konnten oder wollten uns aufklären. Herr Echo war erst seit kurzer Zeit am Ort, um unter der Leitung seines älteren Kollegen in die Geheimnisse der englischen Missionspädagogik eingeführt zu werden; er war somit entschuldigt. Aber daß auch die beiden anderen auf meine Anfragen ewig nur die gleiche Antwort „si jui, ich weiß nicht“ hatten, erboste mich doch sehr. Indessen auch ihnen gegenüber mußte ich mir sagen: sie sind landfremd, Sefu ist Küstenmann und ist als Akide ganz wie bei uns wahrscheinlich mehr gefürchtet als beliebt, Herr Zahnbürste aber gilt schon auf Grund seines hohen Bildungsgrades als außerhalb der Menge stehend; er hat Sansibar gesehen, hat also sozusagen studiert und schwebt als Lehrer der Missionsjugend hoch über dem gemeinen Volk der Analphabeten. Diese Missionsschule bildet nebst einer verrosteten Brunnenröhre und einer kleinen Kirchenglocke, die nach Landessitte hoch oben aus dem ersten besten Baum ihren hellen Ton über das afrikanische Pori erschallen läßt, die letzte Erinnerung an die alte, blühende Missionsstation Neu-Newala.
Erst vor wenigen Tagen ist uns die Aufklärung über unsere Vereinsamung geworden; Knudsen hat das Nähere aus dem Munde eines alten Freundes aus dem Tieflande erfahren. Die Aufklärung lautet für uns Europäer wundersam genug, ist aber echt afrikanisch. Danach gelte ich gegenwärtig in den Augen der Eingeborenen weit und breit als großer Zauberer.
„Habt ihr’s nicht gesehen,“ so spricht nach dem Bericht jenes schwarzen Zwischenträgers ein mir dem Namen nach einstweilen noch unbekanntes Individuum zu seinen Landsleuten, „habt ihr es nicht gesehen, wie der weiße Mann euch eurer Kleider beraubt und wie er euch zu völlig nackten Menschen macht? Ich weiß es ganz genau; wenn er unter sein großes schwarzes Tuch kriecht, dann geschieht dieser Zauber. Ihr steht da, mit euren Kleidern angetan,[S. 392] doch wenn der weiße Mann dann am nächsten Tage, nachdem er am Abend stundenlang in seinem Zelt gestanden und mit viel Daua hantiert hat, seine Bilauri, seine Gläser, ordnet, dann seid ihr auf diesen Platten ganz nackend. Und wenn ihr unklug genug seid, euch vor die andere Maschine zu stellen, dann nimmt der weiße Mann euch sogar eure Stimme. Er ist ein großer Zauberer, und seine Medizinen sind stärker als selbst unser Chissangu. Wir haben Krieg gemacht gegen die Wadachi, gegen die Deutschen, aber was sind wir für Toren gewesen, gegen dieses Volk zu fechten; denn dieser weiße Mann ist auch ein Deutscher!“
So also spiegeln sich im Geist der unberührtern Buschbevölkerung unsere doch wirklich recht harmlosen ethnographischen Arbeitsapparate wider. Ich gestehe gern, daß die Komik meiner Situation und meiner Rolle einstweilen weit das Ärgerliche meiner sonstigen Lage übertraf, und herzlich haben wir beiden weißen Männer erst einmal über den ganzen Fall gelacht. Daß der Phonograph den Leuten mehr oder weniger unheimlich gewesen war, kam mir erst jetzt zum Bewußtsein; der Apparat hatte stets so gestanden, daß die Zuschauer nur den Trichter und die glatte Vorderseite sehen konnten; die rotierende Walze war ihnen stets unsichtbar geblieben. Die Leute hatten wohl gesehen, daß Knudsen oder ich irgendeine Manipulation vorgenommen hatten, aber welcher Art der ganze Vorgang war, davon hatte sich keiner ein Bild machen können. Daher denn wohl auch die Steigerung des Unerklärlichen zum Unheimlichen und meine Beförderung zum stimmenraubenden Zauberer. Rühmend will ich übrigens an dieser Stelle des edlen Susa erwähnen; er hat einmal, aber doch auch erst, nachdem ich den Zauber auf andere Weise gebrochen hatte, einen günstigen Augenblick benutzt, ist um den Apparat herumgegangen und hat die rotierende Walze gesehen. Seitdem ist für diesen intelligenten Mann und für den einsichtigern Teil seines Anhangs der Phonograph eine ebenso harmlose Maschine wie alles andere auch, was der weiße Mann aus dem fernen Uleia ins Land bringt.
[S. 393]
In bezug auf meinen Entkleidungszauber habe ich selbst sehr energisch eingegriffen. Durch sehr wirkungsvollen Zuspruch haben wir ein paar schwarze Männer und Weiber vor die Kamera gestellt, haben sie getypt und das Verfahren bis zur fertigen Ausichtspostkarte durchgeführt. „Nun, seid ihr etwa nackt auf dem Bilde hier, oder habt ihr eure Kleider an? Und sind das nicht dieselben Kleider wie ihr sie dort an euren schwarzen Leibern tragt?“ Halb ängstlich, halb verblüfft ob des nie Gesehenen haben Männlein und Fräulein das Wunder des Bildes angestaunt; dann sind sie alle mit ihren Konterfeis davongezogen, nachdem sie noch die ernsthafte Weisung mit auf den Weg bekommen hatten, nun aber auch jedermann zu sagen, daß der weiße Mann durchaus kein Zauberer sei und daß er keinen Schwarzen seiner Kleidung beraube, sondern daß die Leute auf den Bildern genau so angezogen seien wie in Wirklichkeit! Das hat denn auch geholfen, und heute strömt das Volk genau so vertrauensvoll herzu wie in den ersten Wochen.
Im Grunde genommen könnten die Leute sich dieses Kommen ersparen, denn ich brauche sie nicht mehr; was sie mir an ethnographischen Dingen bringen, ist das gleiche wie das schon hundertmal in meinem Besitz Befindliche; beim Photographieren aber springt auch nichts Besonderes heraus, denn es ist immer derselbe Typ, dieselbe Narbenverzierung, derselbe Lippenpflock. So paßt es ganz gut, daß ich den größten Teil meiner Zeit den Sprachaufnahmen widmen kann, den kleineren Rest aber der zwanglosen Beschäftigung mit volkskundlichen Dingen, wie sie sich bei Ausflügen in die Umgebung in der Regel ganz von selbst ergeben.
Vor ein paar Tagen habe ich das größte Wunder in diesem an Seltsamkeiten reichen Lande erlebt. Seit Wochen schon hatte Herr Echo von einer Sitte der Makuamädchen gesprochen, nach der diese unter der Zunge wie in einem Nest einen ganzen Haufen Kieselsteine trügen. Ich habe den Mann stets ausgelacht, mit bezeichnender Gebärde nach der Stirn. Vorgestern nun sitzen wir fünf Sprachforscher[S. 394] wieder beisammen und quälen uns in heißem Bemühen mit einigen besonders schwierigen Formen des Kiyao ab; dabei ist der Makua überflüssig, er erbittet sich Urlaub und verläßt die Barasa. Wir anderen denken kaum noch an ihn; plötzlich ein Geräusch nahender Schritte, eine schlanke Mädchengestalt wird zwischen Mattenwand und Lehmbrüstung sichtbar, unmittelbar dahinter die des schwarzen Lehrers; scheu, aber doch mit verschämtem Lächeln steht im gleichen Augenblick auch schon das junge, hübsche Ding vor uns. „Hapa namangāhlu, Bwana, hier sind die Mundsteine, Herr“, mit triumphierender Miene deutet Nawalowe auf den von einem erst mäßig großen Oberlippenpflock „verschönten“ Mund des jungen Mädchens. Wir sind alle erregt aufgesprungen. Sefu, Nawalowe und Akuchigombo reden gleichzeitig auf sie ein; widerwillig führt sie schließlich die Hand zum Munde, und siehe da, groß wie der Kern einer Haselnuß liegt im nächsten Augenblick ein fast wasserklarer, glattgeschliffener, eiförmiger Kiesel auf der flachen Hand. Ein zweiter folgt, ein dritter, ein vierter, wie ein Triumphator schaut Nawalowe zu mir herüber; ich aber stehe vor Staunen stumm. Ist es ein Trugbild, oder mogelt der gute Schulmeister? Schon ist ein fünfter Stein aus seinem rosigen Behälter herausgeholt, ein sechster folgt noch hinterdrein; endlich, nach dem siebenten und achten, scheint das Nest leer zu sein. Ich habe in jenem Augenblick tatsächlich einer gewissen Schonungspause bedurft, um mich von meinem maßlosen Erstaunen zu erholen, dann erst bin ich fähig gewesen, die Erklärungen meiner drei Gelehrten mit Ruhe in Empfang zu nehmen. Danach sind diese namangahlu genannten Steine Kiesel, wie man sie hier in den Ablagerungen wohl aller Flüsse findet; besonders klar und schön sollen die aus dem Rovuma sein, und sonach gilt es als eine Art Ehrensache für jeden verliebten Jüngling, solche Quarze von dort mitzubringen und sie der Geliebten zu verehren. Zu Perlenkolliers und à jour-Fassungen ist man am Rovuma und auf dem Makondeplateau noch nicht vorgeschritten, Taschen sind ebenfalls ein unbekannter Luxus, bleibt also[S. 395] als Behälter lediglich die untere Mundhöhle. So reime wenigstens ich mir die mehr als seltsame Tragart dieser Steine zusammen. Der Sinn der Sitte ist nach jenen Gewährsleuten der eines Treuegelübdes; die Steine sind also sozusagen ein ins Afrikanische übersetzter Verlobungsring, nur daß im Gegensatz zu so mancher jungen deutschen Braut, die ach! gar zu gern mit dem neuen, funkelnden Reif am Goldfinger kokettiert, diese Steine von niemand gesehen werden dürfen als vom Geliebten selbst. Mein erster, instinktiver Mogelverdacht ist übrigens, wie ich wohl annehmen darf, unbegründet; ich habe seither auf eigene Faust Studien in dieser Richtung angestellt und bei mehreren jungen Makuaweibern die Steine vorgefunden; die Sitte ist also bestätigt. Es gibt doch wirklich keine Verrücktheit, deren unser menschliches Geschlecht nicht fähig wäre! —
Das Klima Newalas ist im Laufe der Wochen immer schlechter geworden; nach einer kurzen Zeit wunderschönen mitteldeutschen Herbstwetters wälzt sich jetzt allmorgendlich der Nebel bis gegen 8½ Uhr über die Boma hin, am Abend aber braust der Ost eisiger denn sonst. Wir beiden Weißen kommen dabei nicht aus einem leichten Katarrh heraus, und schlecht geht es unseren Leuten. Anzuziehen haben sie nicht viel, die Träger haben nicht einmal Stoffe zum Wechseln; auch der Speisezettel der Ärmsten läßt immer mehr zu wünschen übrig. Zu alledem das nichts weniger als einwandfreie Wasser, kurz, es nimmt mich nicht wunder, wenn die Krankenliste von Woche zu Woche gewachsen ist. Von überall her ertönen die Beweise schwerer Bronchialkatarrhe; fast vermeine ich mich in die Zeiten von Ewerbecks Husterkompagnie zurückversetzt; doch auch Dysenteriefälle sind nicht selten, und ebensowenig Geschlechtskrankheiten. Die meisten der Patienten haben Vertrauen zu ihrem weißen Herrn, sie kommen freiwillig und nehmen mit Todesverachtung jede Art von Daua, die ihnen in den Mund gestopft wird. Meine Krieger muß ich militärärztlich behandeln, indem ich sie von Zeit zu Zeit behufs körperlicher Revision antreten lasse. Nebenher geht, wie das bei dem Charakter des[S. 396] Negers nicht anders zu erwarten ist, ganz allgemein die Behandlung à la Schensi. Mein Liebling Mambo sasa erfreut sich einer doppelseitigen Epididymitis; eine Hochlagerung der betreffenden Körperteile allein imponiert weder ihm noch seinen vielen Freunden. Diese schweifen vielmehr durch Wald und Busch, um für den Kranken eine spinatartige Medizin zusammenzusuchen, die sie ihm unermüdlich in dicker Schicht auflegen. Machen nun Knudsen und ich unsere kleinen Bummel auf irgendeine der von Newala auslaufenden Barrabarra hinaus, so stoßen wir sicherlich von Zeit zu Zeit dort, wo zwei Wege sich gabeln oder sich kreuzen, auf seltsame Gebilde. Mit merklicher Sorgfalt ist der Boden von Laub, Ästen und ähnlichen Dingen gesäubert; inmitten der reinen Fläche aber hat eine unbekannte Hand mit schneeig weißem Mehl einen Zauberkreis gezogen, etwa einen Fuß im Durchmesser und nie ganz regelmäßig; im Kreise selbst sind Mehltupfen in besonderem System angebracht, in Dreier- oder Viererreihen, mehr oder minder regelmäßig.
Über Zweck und Bedeutung dieser Figuren, die mir schon an meinen früheren Aufenthaltsorten mehr als einmal aufgestoßen waren, habe ich erst im Laufe der Zeit Aufklärung erhalten. Man versteht diese Art der Therapie nur, wenn man die gesamten Anschauungen des Negers über das Leben nach dem Tode und das Walten überirdischer Mächte in Betracht zieht. Mit dem leiblichen Tod hört nach dem Negerglauben das menschliche Leben keineswegs auf; zwar der Körper wird verscharrt und verwest, die Seele aber lebt weiter, und zwar an derselben Örtlichkeit, wo sie sich früher betätigt hat. Ihr bevorzugter Wohnsitz sind markante Bäume. Die Religion der Völker dieses Südens ist denn auch ein ausgeprägter Baumkultus insofern, als die Neger zu den verstorbenen Ahnen opfern und beten, indem sie Speise und Trank am Fuße solcher Bäume niederlegen und ihre Worte inbrünstig an die Krone des Baumes selbst richten.

Der Msollobaum (Kimakonde: Mhollo) ist es, dem hier die Rolle des Göttersitzes zuteil wird. Zu ihm geht der pater familias, wenn in[S. 397] seiner Familie Krankheit wütet; dorthin lenkt er seine Schritte, wenn er vor einer großen Reise steht; dort kann man ihn finden am Vorabend vor dem Abmarsch in den Krieg. Er ist nicht mit leeren Händen gekommen: mit bunten Stoffen ziert er den Stamm des Baumes, so daß dieser mit all dem Flitterkram, den andere Hilfesuchende bereits an ihm befestigt haben, mehr originell als schön aussieht. Mit Baumblättern säubert er den Boden um den Stamm des Baumes herum und streut Mehl auf ihn; in einen Krug gießt er stärkende Pombe. Das sind die freiwillig gespendeten Gaben des Lebenden. Nun aber ist dieser ein Mensch und ein Neger noch dazu; ohne Gegenleistung des Toten geht es also nicht ab: „Ich habe dir Zeug geopfert und Mehl und Pombe gebracht; du, Ahne, weißt, wir wollen jetzt Krieg machen gegen die bösen Mavia; morgen marschieren wir ab; sorge du dafür, daß mich keine Kugel trifft, kein Pfeilschuß und kein[S. 398] Speerwurf.“ Im Abendwinde rauscht der Baum, beruhigt zieht der Gläubige von dannen.
Doch die Seelen wohnen nicht immer im Msollobaum. Ruhelos schweifen sie meist durch Feld und Wald; genau wie vordem, als sie noch in Fleisch und Blut einherwandelten, bevorzugen sie natürlich die Hauptwege. Dort und besonders da, wo mehrere Straßen zusammenstoßen, sind sie am leichtesten zu treffen, dort ist ihr Schutz am sichersten zu erlangen. Aus dieser Gedankenfolge heraus erkläre wenigstens ich es mir, daß das Mehlopfer an den obenbezeichneten Punkten stattfindet. Die Kranken sehen die Möglichkeit einer Besserung lediglich oder doch vorwaltend in der Hilfe, die ihnen von den mit höheren Kräften ausgestatteten Seelen der Ahnen zuteil werden kann. Was liegt also näher, als diesen Seelen dort zu opfern, wo sie vermutlich am häufigsten vorbeischweben, an den Kreuzwegen und an den Weggabelungen. Das ist die Auffassung meiner Gewährsleute, der auch ich mich anschließen möchte; sie hat viel Wahrscheinliches für sich, wenngleich auch zuzugeben ist, daß jenen Mehlfiguren ein anderes Motiv zugrunde liegen kann.
Im innigen Zusammenhang mit dem Baumkultus scheint mir das Anpflanzen besonderer Bäume an den Gräbern zu stehen. Im Tieflande, besonders bei den Yao, sind mir solche Bäume nicht aufgefallen, hier oben auf dem Plateau finde ich sie ganz allgemein. An frischen Gräbern sind es junge, schlanke Stämme; an anderen Stellen, die nur noch im Gedächtnis der Alten als Ruheplatz eines Toten weiterleben, ragen ganz ungeheuere Bäume, mächtige Stämme mit gewaltigen Kronen, 20 Meter und noch weit mehr in die blaue Luft empor. Gerade die nächste Umgebung der Boma von Newala erhält durch eine ganze Anzahl solcher alten Grabbäume an mehr als einer Stelle ein ganz stimmungsvolles Aussehen. Der Baum ist der Kamumabaum; er wird stets zu Häupten des Toten eingepflanzt.
Ob die Seele nach dem Glauben der Eingeborenen zeitweilig auch in diesen Grabbäumen ihren Sitz hat, habe ich bisher nicht zu[S. 399] ergründen vermocht; außerordentlich schwer ist es, über den Verbleib der Seele überhaupt etwas Bestimmteres zu erfahren. Die Yao haben in dieser Richtung ganz versagt, die Makua aber sagen: „Der Schatten des Menschen geht zu Gott, Gott aber wohnt da oben.“ Was der Schatten aber da oben macht und wie es ihm ergeht, das wissen auch sie nicht.
Gruselig und schreckhaft sind nach alledem, was mir zu Ohren gekommen ist, die Gespenstergeschichten der hiesigen Neger; ich will eine von ihnen erzählen.
Yao und Makua haben ein Gespenst mit Namen Itondōsha oder Ndondosha, wie es im Kiyao heißt. Hat der Zauberer ein Kind getötet — wie bei allen Naturvölkern, so ist auch beim Neger der Tod nie etwas Natürliches, sondern stets die Folge des zauberischen Eingriffs eines andern —, so holt dieser Zauberer das Kind aus dem Grabe heraus, macht es wieder lebendig und schneidet ihm die Beine in den Kniegelenken ab. Die abgeschnittenen Gliedmaßen wirft der Zauberer weg, das so verkürzte und verstümmelte Kind aber stellt er heimlich irgendwo hin. Nun kommen die Menschen von allen Seiten und bringen dem Itondosha Ugali, Pombe, Früchte und Zeug. Geschieht dies regelmäßig und in ausreichendem Maße, so hört man nichts weiter von dem Gespenst; vergessen jedoch die Leute seiner im Laufe der Zeit, so beginnt es plötzlich laut und unheimlich zu schreien. Dann erschrecken die Leute und bringen dem Itondosha von neuem ihre Gaben dar.
Mein Forscherglück will es, daß ich ganz zufällig auch in den Besitz eines Liedes gekommen bin, dessen Inhalt sich um dieses Itondosha rankt. Von den wenigen Individuen, die ich hier in Newala vor meinen Trichter habe bannen können, zeichnete sich lediglich ein Makuajüngling durch seine große Bereitwilligkeit aus, das Wagestück zu unternehmen und vor die unheimliche Maschine zu treten. Dieses Entgegenkommen war, wie sich sehr bald herausstellte, sogar weit größer als seine Sangeskunst; doch das hat nichts verschlagen, sein wissenschaftliches Verdienst bleibt dem Braven doch.
[S. 400]
Der junge Mann hat soeben, nach den üblichen Vorproben, mit bedeutendem Stimmaufwand sein erstes Lied in meinen Trichter hineingebrüllt. Jetzt gilt es, den Text des Liedes festzulegen; mit gespitztem Bleistift sitze ich auf meiner bewährten großen Kiste und beginne das Verhör.
„Dein Name?“
„Änestehīu“, erschallt es prompt und mit sichtbarem Stolz zurück.
„Änestehiu?“ lautet meine erstaunte Gegenfrage.
„Jawohl, Änestehiu.“
„Aber Rafiki, mein Freund, Änestehiu, das klingt doch gar nicht wie ein Makuaname.“
„Mimi Christ, ich bin ein Christ“, fast beleidigt, daß ich das nicht gleich gemerkt habe, hat mir der Junge das stolze Wort entgegengeworfen. Das ändert die Sachlage allerdings; ich denke einige Zeit nach, endlich habe ich es: Anastasio heißt er, das ist sein Taufname; der würdige englische Reverend hat das Wort nicht deutsch oder italienisch ausgesprochen, sondern, wie es Old England liebt, rein englisch, also Änästäsio. Nun fällt das „s“ im Kimakonde ganz aus und auch im Kimakua wird es, soweit ich bis heute ersehen kann, häufig durch ein „h“ vertreten, kurz aus Anastasio ist auf gut Kimakua Änestehiu geworden. Das Lied aber heißt folgendermaßen:
„Nach Massassi bin ich gegangen, bin noch einmal nach Massassi gegangen. Abends hörte ich Geschrei; ich drehte mich um und ich sah das Itondosha. ‚Mein Vetter Cheluka (rief ich), gib mir Gewehr und Zündhütchen und eine Kugel.‘ ‚Lade du selbst‘ (flüstert der Vetter). ‚Komm mit und laß uns verfolgen das Itondosha, es ist durch ein Loch in der Seitenwand hinters Haus gegangen.‘ Mein Bruder (Vetter) dreht sich um und sagt: ‚Es hat die Beine steif geradeaus gestreckt wie ein Kinnbart.‘ Es saß (setzte sich), wir aber bemühten uns zu zähmen das Itondosha, das Mädchen von Ilulu. Älo, ja, so ist es.“

[S. 401]
Auf harmlosere Bahnen hat mich heute ein Makondealter mit einer kleinen Gabe zurückgeführt. Wir hatten uns über die Zeitrechnung der hiesigen Völker unterhalten, und dabei war herausgekommen, daß sie in dieser Beziehung noch ebenso rückständig sind wie in der Bezeichnung der Tageszeit selbst, jedoch auch ebenso praktisch. Die Knotenschrift ist eine geistige Errungenschaft, die von der Menschheit zu den verschiedensten Zeiten und an den verschiedensten Orten gemacht worden ist; sie ist nicht nur in dem berühmten Quippu der Peruaner verkörpert, sondern ist in der Südsee nachgewiesen worden und auch in Westafrika. Hier auf dem Makondeplateau wird sie noch heutigestags frisch und fröhlich geübt; denn die Zahl der Kinder, die in den deutschen Regierungsschulen von Lindi und Mikindani das Schreiben mit der Feder erlernen, ist noch sehr gering. Mit artiger Gebärde überreicht mir der Makondemann eine etwa fußlange Bastschnur; 11 Knoten sind darin, in genau gleichen Abständen geschürzt.
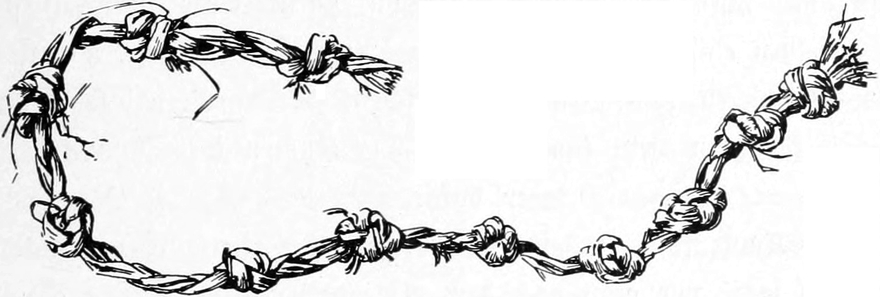
„Das ist ein Reisekalender“, setzt mir der bisherige Besitzer durch Sefus Vermittelung auseinander; „will ich meine Reise antreten, so sage ich zu meiner Frau: Dieser Knoten (dabei tupft er auf den ersten) ist heute, da breche ich auf; morgen (ein Tupf auf den zweiten Knoten) bin ich unterwegs; auch den dritten und vierten marschiere ich noch; hier aber (ein energischer Griff an Knoten Nr. 5), da komme ich ans Ziel. Dort bleibe ich den sechsten Tag, am siebenten aber trete ich den Rückmarsch an. Der dauert diesen siebenten Tag und[S. 402] den achten und den neunten; am zehnten aber, da mußt du aufpassen, Frau, vergiß ja nicht, an jedem Tage einen Knoten zu lösen; an diesem zehnten Tage, da mußt du Essen für mich machen, denn siehe, hier am elften, da werde ich zurückkommen.“
Also hier ebenfalls wieder ein Überlebsel, eine Erinnerung an eine Kulturstufe, die auch unsere Vorfahren vor langer Zeit einmal durchlebt haben werden. Vor langer Zeit? Ist denn unser Knoten im Taschentuch etwas wesentlich anderes als jene 11 Knoten in der afrikanischen Bastschnur? Die Menschheit ist nicht nur ideenarm in dem Sinn, daß ihre Erfindungen über die ganze Erde hin sich stets auf dieselben einfachen Grundgedanken zurückführen lassen, sie ist bei allem technischen und geistigen Fortschritt doch auch selbst in ihren höchsten Gliedern recht konservativ. Der Knoten im Schnupftuch ist nur einer unter vielen Belegen dafür.
Das Knotensystem scheint im übrigen auch hier durchaus nicht so simpel zu sein, wie man nach dem Kalenderbeispiel vielleicht glauben möchte. Soeben legt mir ein anderer Makondemann ein ganzes Bündel von Knotenschnüren auf den Tisch; das rühre vom Jumben Soundso her, der könne nicht behalten, wer von seinen Dorfleuten schon die Hüttensteuer bezahlt habe und wer nicht, da helfe er sich in dieser Weise, und es gehe mit dem Verfahren ganz gut.
Doch damit sei es genug der Einzelheiten aus dem unerschöpflichen Schatz des höheren und niederen Volkstums. Angesichts dieser schier unübersehbaren Fülle von Erscheinungen, wie sie sich mir drunten im Tiefland und nun seit fünf Wochen hier oben auf der Kante des Makondehochlandes Tag für Tag aufgedrängt haben, komme ich mehr und mehr, auch auf Grund meiner eigenen Forscherpraxis — aus den Schätzen unserer ethnographischen Museen und der völkerkundlichen Literatur weiß ich dies schon lange —, zu der Überzeugung, daß kaum ein Ausdruck so verfehlt und falsch ist wie der Ausdruck Naturvölker. Freilich sie alle, die Indianer und die Eskimo und die Hyperboräer und die Neger und viele Süd- und Südostasiaten, die Mehrzahl der[S. 403] Malaien, die Ozeanier und die Australier, sie alle leben zweifellos inniger in und mit der sie umgebenden Natur als wir, die wir uns lediglich von Kultur umgeben wähnen. Aber hat in Wirklichkeit jede einzelne dieser von uns so hochmütig über die Achsel angesehenen Menschheitsgruppen nicht auch Kultur, und zwar genau so ihre eigene Kultur wie wir die unsere? Setzt sich, um gleich beim Nächstliegenden zu bleiben, das materielle und das geistige Leben meiner Neger hier im Stromgebiet des Rovuma nicht auch aus tausend und tausend Einzelzügen zusammen, die untereinander nicht viel weniger differenziert sind als unsere eigenen Lebensbetätigungen? Allerdings, dem Neger bringt sein Hackbau, bringt seine Technik nicht jene Summe von Lebensannehmlichkeiten, wie sie der wohlsituierte Weiße von heute für sich in Anspruch nimmt; aber leben manche Teile der Landbevölkerung selbst im deutschen Vaterlande denn nicht ebenso schlecht und vielleicht noch schlechter als diese Barbaren, denen freilich das schreckliche Odium anhaftet, nicht einmal ihren Namen schreiben zu können! Ich bin wahrlich sehr weit davon entfernt, diese sogenannten Naturvölker mit allem ihrem Tun und Lassen durch eine rosige Brille zu betrachten; aber wenn ich in Betracht ziehe, daß die ungeheuren Errungenschaften, wie sie die Erfindung der Buchdruckerkunst, das Zeitalter der großen Entdeckungen und die Reformation im Gefolge gehabt haben, doch allem unserm Hochmut zum Trotz in Wirklichkeit nur einem geringen Bruchteil der weißen Rasse, gleichsam einer nicht einmal lückenlosen Schicht, veredelnd in Fleisch und Blut übergegangen sind, dann komme ich immer wieder auf meine Ansicht zurück: nein, wir sind durchaus nicht die alleinigen Pächter der Kultur. —
Du aber, Newala, mit deinem brausenden Abendsturm, deinen kühlen Morgenstunden, deinen Sandflöhen und deinem so lehrreichen Völkergemisch, lebe wohl! Die langen Wochen meines Verweilens in deinem Palisadenzaun haben mir Arbeit über Arbeit gebracht, Tag für Tag rund das Doppelte an Zeit von dem, was unsere demokratischen Apostel im hetzenden und gehetzten fernen Uleia für den[S. 404] vierten Stand erträumen, erhoffen und fordern; und gerade darum bist du mir lieb und wert geworden. Ohne Fleiß kein Preis! Morgen beim grauenden Tag heißt es dich verlassen. Ob mir hier auf den Höhen dieses merkwürdigen geologischen Gebildes, Makondeplateau genannt, noch viel zu tun bleiben wird, ich weiß es nicht und ich ahne es nicht, doch auch die Zukunft soll mich zu jeder Forscherarbeit gerüstet finden.
[S. 405]

Am Rovuma, 23. Oktober 1906
etwa 39° 40′ östl. Länge.
Von den mehr als 700 Meter Seehöhe Newalas habe ich mich auf höchstens 60 Meter erniedrigt, dafür aber lasse ich statt der 24 bis 25 Grad Mittagstemperatur dort auf dem hohen Westrande des Makondeplateaus deren augenblicklich 36 über mich ergehen. Es ist schrecklich heiß hier in dem baumartigen Gestrüpp, in dem wir notgedrungen unser Lager haben aufschlagen müssen; und das trotz der unmittelbaren Nähe der Fluten meines alten Freundes, des großen Rovuma. Wie hatte mir sein breites Bett so oft zu dem Plateaurande von Nchichira heraufgewinkt, nach Süden in gerader Linie abgeschlossen durch die gewaltige, keilförmige, glitzernde Fläche des großen Nangadisees, rechts, mehr nach Südwesten zu, flankiert von dem kleineren Lidedesee. Doch ich muß wohl auch hier chronologisch verfahren, um verstanden zu werden.
[S. 406]
Der frühe Morgen des 11. Oktober war ebenso neblig, rauh und kalt wie alle seine Vorgänger, doch in unseren Augen glich er ihnen nicht im mindesten. Das Schauspiel der ausgelassensten Freude, wie es mir meine Leute beim Aufbruch von Chingulungulu geboten hatten, wiederholte sich hier in womöglich noch gesteigertem Grade; Newala war für die armen Kerle ja in der Tat alles andere als ein Kapua gewesen. Selbst Pesa mbili II., ein sonst sehr behäbiger, wohlbeleibter Manyema, ist ganz schlank geworden. Als ich ihn gestern fragte: „Tumbo lako wapi? Wo ist dein Bauch?“, da antwortete er mit traurigem Blick auf die Stelle verflossener Herrlichkeit: „Tumbo limekwenda, bwana, fort ist er gegangen, der Bauch, Herr.“ Tumbo limekwenda kann übrigens auch ich sagen, desgleichen Freund Knudsen; unsere Khakigewänder schlottern nur so um unser kärgliches Gebein.
Für meine weiteren Makondestudien konnte lediglich Mahuta in Frage kommen. Mahuta ist nicht nur der politische Mittelpunkt des ganzen Hochlandes, in dem hier als oberster Verwaltungsbeamter der Wali residiert, sondern auch geographisch ist es für meine Zwecke äußerst dienlich gelegen. Straßen führen von hier nach allen Richtungen, ich kann also leicht zu allen Eingeborenen gelangen, oder, was bequemer und besser sein wird, die Schwarzen werden zu mir kommen können. Doch einstweilen winkte mir ein anderes Ziel: der Südrand des Plateaus mit einer Enklave von Wangoni.
Über diese Wangoni hatte ich bereits seit Lindi das Mannigfaltigste zu hören bekommen; selbstverständlich sollten sie Brüder und Stammesgenossen der gleichnamigen Kaffernvölker oben am Ostufer des Nyassa sein. Sie seien bei einem der vielen Raubzüge, durch welche diese Kaffernvölker, sei es unter dem Namen der Masitu oder Mafiti oder Magwangwara oder Wamatschonde oder Wangoni, seit den 1860er Jahren den ganzen Süden von Deutsch-Ostafrika zu einer mehr oder minder menschenleeren Wüste umgestaltet haben, durch den tapfern Gegenangriff der Yao unter Matola I. vom Haupttrupp abgesprengt[S. 407] und in den Bezirk von Nchichira auf der Südkante des Makondeplateaus verschlagen worden. Nils Knudsen wußte sogar noch viel mehr; prachtvolle große Kriegergestalten seien es, die in jeder Beziehung himmelhoch über ihren gegenwärtigen Nachbarn und selbst noch über seinen geliebten Wayao ständen. Und wenn ich endlich einmal wirklich geschlossene Dörfer sehen wolle, Haus an Haus, mit schönen Straßen dazwischen, dann müsse ich nach Nchichira gehen. „Werde ich auch, aber Sie gehen natürlich mit.“ Das hat sich der brave Nils nicht zweimal sagen lassen; Rovuma und Elefantenjagd sind für ihn zwei untrennbare Begriffe; ich glaube, er würde stracks bis zum mittleren Kongo laufen, wenn ihm einer sagte, dort stehe ein großzahniger Elefant. Aber er schießt auch gut, trotz seiner recht klapprigen Donnerbüchsen.
Also erst Nchichira und die Wangoni, dann, als Nachtisch zum ganzen Forschungsdiner, noch einige Wochen Mahuta. Damit, denke ich, wird es genug sein des grausamen Spiels; schon jetzt bekomme ich ab und zu gelinde Anwandlungen von wissenschaftlicher Übersättigung, und ich fürchte, wenn es mit dem Zuströmen neuer Eindrücke so weiter geht, wird meine Aufnahmefähigkeit eines schönen Tages doch einmal versagen.
Unser Weg von Newala bis Nchichira hat uns über Mahuta geführt. War das ein bequemes Marschieren! Hätte ich nicht mein bewährtes altes Maultier gehabt, ich hätte mir tatsächlich ein Fahrrad wünschen mögen; selbst ein Auto hätte auf diesen Wegen ungehindert fahren können. Kein steiler Berg und kein schroff eingerissenes Erosionstal; dafür eine sanft und fast unmerklich nach Osten abfallende Ebene, in ihrer ganzen Ausdehnung von dichtem Busch bestanden; aus diesem die ausgedehnten Felder der fleißigen Makonde ausgespart; für den Wanderer endlich aufs beste zugerichtet breite, manchmal kilometerlang schnurgerade gehauene Straßen. Auch hier haben die Makonde diese breiten Barrabarra keineswegs aus eigenem Interesse an einem verbesserten Verkehrswesen hergerichtet, es hat[S. 408] vielmehr auch in diesem Teil des Landes eines sehr starken Druckes von Lindi aus bedurft; aber dafür entsprechen nun diese Wege bei einer Breite, die fast überall einer Sektion, stellenweise sogar einem Halbzuge das Marschieren gestattet, jedem strategischen Zwecke. Nur der lockere tiefe Sand ist geeignet, die Freuden des Wanderns herabzumindern; er findet sich Gott sei Dank nicht überall, sondern nur an den tiefergelegenen Stellen des Weges, wohin er von der Höhe herabgeflossen ist; dort ist er schier unergründlich.
Doch die Freude über den endlichen Ortswechsel würde auch größere Hindernisse überwinden als diese Bagatelle. Der Busch ist grün, die Sonne hat soeben den Nebel siegreich niedergekämpft und strahlt nun mit einer Freundlichkeit auf Schwarz und Weiß hernieder, daß die Träger gar nicht anders können, sie müssen singen. Und nun heben sie an mit ihren schönen alten Wanyamwesiliedern, die uns sooft schon über manche kleine Mißstimmung hinweggeholfen haben, und auch mit neukomponierten, die ich heute zum erstenmal höre. Sie sind noch viel schöner als der alte Bestand.
Nur eine einzige größere Ansiedelung liegt am Wege zwischen Newala und Mahuta; es ist der Ort Hendereras, eines alten klumpfüßigen Makondejumben. In seiner ganzen Häßlichkeit hat er anscheinend selbst meinen Trägern imponiert, wenigstens hat ihn mir einer unter ihnen wenige Tage später, aufs getreueste abkonterfeit, im Skizzenbuch überbracht. Der Ort Hendereras ist ein auffallend groß angelegter Weiler; der Platz, um den sich die Hütten scharen, könnte gut einer deutschen Kompagnie als Exerzierplatz dienen; mein einsames Dutzend tapferer Krieger nimmt sich auf ihm jedenfalls recht spärlich aus.
Die Boma von Mahuta kündigt sich schon von weitem durch ihren Palisadenzaun und ein außergewöhnlich weites Schußfeld an. Wald und Busch treten in der Tat nirgends näher als ein paar hundert Meter an die Befestigung heran. Vor deren kaum mannsbreitem Eingangspförtchen sehe ich schon von weitem die gesamte Heeresmacht des Wali aufmarschiert: fünf Baharia, schwarze Kerle in[S. 409] khakigelben Matrosenkostümen, die sich krampfhaft bemühen, unter der Leitung ihres baumlangen Kommandeurs in leidliche Richtung zu kommen. Der Wali ist nicht zu sehen; er ist an der Küste, heißt es. Der Kommandeur brüllt gerade: „Das Gewehr über!“, da bin ich boshaft genug, von der Richtung auf die Boma abzubiegen und rechts einzuschwenken; einige hundert Meter seitlich hinter der Boma sehe ich nämlich das Haus, das längst nach mir genannt worden ist und in dem ich doch nun pflichtschuldigst Quartier nehmen muß. „Das Haus zum weggebliebenen Professor“ ist es, ein Bau, den Herr Ewerbeck in Voraussicht unseres gemeinsamen Wirkens in Mahuta dort bereits vor Monaten für uns beide hat ausführen lassen. Der Erbauer ist damals zum festgesetzten Einweihungstermin pünktlich zugegen gewesen, den Gast hatte jedoch die Völkerkunde Chingulungulus wie mit eisernen Klammern festgehalten. Halb betrübt, halb ärgerlich hat Freund Ewerbeck die Taufe des Hauses mit jenem Namen allein vollzogen, und dann ist auch er abmarschiert. Kaum haben die fünf Matrosen meine Absicht gemerkt, hei, wie fliegen die nackten Füße auch schon davon! Ich bin in scharfem Trabe hinterhergeritten, aber gleichwohl erfolgt das „Achtung, präsentiert das Gewehr! Augen links!“ doch noch vollkommen rechtzeitig. Ja, fix sind sie, die schwarzen Jungens!
Das „Haus zum weggebliebenen Professor“ liegt wunderschön; steht man auf seiner Barasa oder seiner Freitreppe, so öffnet sich eine gähnende, tiefe Schlucht unmittelbar zu unseren Füßen. Ein stolzer, grüner Hochwald zur Linken und zur Rechten — an Steilabhänge wagen sich die Makonde mit ihrem Raubbau nicht heran —, ganz hinten aber, dort, wo die wohl 20 Kilometer lange Schlucht durch zwei in scharfer Linie vorspringende Plateaunasen abgeschlossen wird, ein hellgrauer Streif mit silbernem Bande darin. Das ist der Rovuma. Hinter ihm ein großer glänzender Spiegel: der Lidedesee, und hinter diesem in dunklen, mattgrünen Konturen die ebene Fläche des Maviaplateaus. Nach so viel monotonem Makondehochland ist Mahuta landschaftlich eine wahre Erquickung.
[S. 410]
Schon am nächsten Tage geht es weiter. Stunde um Stunde marschiert die lang auseinandergezogene Karawane zwischen den grünen Wänden des Busches dahin. Dieser ändert jetzt sein Aussehen beträchtlich: er wird an Höhe geringer, an die Stelle der schrecklichen Dornen treten in wucherndem Übermaß Pflanzenformen, die mich an unseren Teufelszwirn erinnern. Die Sonne steigt immer höher, der Engpaß des Weges wird immer glühender, der Sand des Bodens immer feiner und tiefer. Endlich ist Nchichira erreicht; es ist eine Boma wie Massassi, Newala und Mahuta auch: ein von arm- bis beinstarken Palisaden umzäunter, quadratischer Raum von rund 100 Meter Seitenlänge, in dem das Haus des Akiden steht, und wo auch die übrigen Elemente einer untergeordneten deutschen Verwaltungsstelle wohnen. In den langen Monaten haben meine Leute eine glänzende Übung im Auf- und Abbauen des Lagers bekommen. Eins, zwei, drei steht mein Zelt; ebenso schnell sind wir auch schon unter der niedrigen Barasa eingerichtet. Sie ist ebensowenig komfortabel wie unsere früheren Wohnpaläste, aber so ein festes Strohdach ist mir doch tausendmal lieber als die Notwendigkeit, im heißen Zelt wohnen zu müssen, oder als der Aufenthalt unter einer frisch gebauten Banda mit ihrer Unsumme gräßlichsten Ungeziefers. In solchen Neubauten regnet es Insekten ohne Unterlaß aus dem frischen Stroh auf Kopf und Körper, in Schüssel und Teller herunter.
Die zwölf Tage Nchichira sind mir wie im Traum vergangen. Nicht, daß ich wirklich geträumt hätte, dazu hat mir das auch hier vorhandene Übermaß von Arbeit keine Muße gelassen. Gerade weil ich unter der Wucht der Eindrücke noch nicht recht zur Besinnung gekommen bin, das reiche Mahl sozusagen noch nicht verdaut habe, erscheint mir die ganze Zeit wie ein wirrer Traum. Seine Einzelheiten kann und will ich hier nicht schildern; nur das Markanteste sei hervorgehoben.
Vom Heldentum der Wangoni keine Spur, die Kerle sind durchaus nicht anders gestaltet und sicherlich nicht besser geartet als[S. 411] irgendeine andere Gruppe im Reigen der hiesigen Völker; ja, wenn ich’s ehrlich gestehen soll, so fallen sie physisch sogar noch ab. Und krank sind auch viele. Welch schreckliches Bild bot sich mir eines Tages dar, als ich der Fährte einer Riesenschlange folgte, wie ich vermeinte. So etwa mag die von einem Python in den Sand gezogene Spur aussehen. Ich trete um ein Haus herum: ein Skelett hockt vor mir; keine Spur Fleisch, kein Muskel am ganzen Körper des kranken Mannes, dem ein kleiner Junge mitleidig forthilft. Ububa heißt die Krankheit; die Fährte aber rührt von der Fortbewegungsart des Unglücklichen her; er ist auf dem Gesäß hierhergezogen worden.

Von wirklich stattlicher Größe ist nur der alte Makachu, der Jumbe des gleichnamigen benachbarten Dorfes und gleichzeitig der Chef der einen der beiden Sippen, in welche diese Wangoni zerfallen. Ich habe Makachu gemessen, er ist 181 Zentimeter hoch; wenn er bei diesem[S. 412] Höhenmaß einherschreitet wie Saul, so zeigt das, wie kläglich die ganze übrige Gesellschaft bezüglich ihrer Körperhöhe ausgestattet sein muß. In der Tat, ganz ausgemergelt infolge ständiger Unterernährung schleppen sich die alten Männer des Stammes zum Schauri herbei, und auch der Nachwuchs verspricht wenig. Nein, das sind keine Kaffern, habe ich mir schon beim Einzuge gesagt, und seitdem habe ich es auf die mannigfaltigste Weise bestätigt gefunden.
Zunächst Siedelungs- und Bauart; nicht ein Zug Südafrikanisches in ihr. Die weitgedehnten Dörfer, durch die man die letzten Stunden des Weges von Mahuta her marschiert, sie gleichen aufs genaueste den Dörfern im Tiefland westlich des Plateaus, höchstens, daß die Felder hier besser gepflegt erscheinen und auch von Hause aus besser urbar gemacht worden sind. Es ist aber auch ein ander Ding, einen derben Waldbestand niederzulegen als hier oben das bißchen Busch zu verbrennen.
Auch in Einzelheiten des Baues kein Unterschied; das Hütteninnere genau so unordentlich wild mit Vorratsbehältern, Töpfen und Rindengefäßen, mit schwelendem Herdklotz und mit Bettstellen ausgestattet wie in Mchauru oder Akundonde; die Außenwände aber genau so mit kindlichen Malereien überklext wie auch sonst überall im Lande.
Und dann erst die Sprache und die Geschichte dieser Volksgruppe. Unter meiner Mustertruppe von Trägern befindet sich in Gestalt des edlen Mambo sasa auch ein echter Kaffer, ein Mgoni von Runsewe. Diese Wangoni sind die Nachkommen jener Kaffernwelle, die von allen am weitesten nach Norden gedrungen ist. Während das Gros der reisigen Scharen, die vor einem halben Jahrhundert oder etwas mehr über den Sambesi heraufkamen, sich an beiden Ufern des Nyassa niederließ und unter blutigen Kämpfen Reiche begründete, zogen diese Wangoni am Ostufer des Tanganyika entlang immer weiter nach Norden. Im nordwestlichen Unyamwesi endlich kam auch diese Welle zum Stehen. Unter dem Namen Watuta haben die Nachkommen jener ersten Eroberer jahrzehntelang ein wildes Räuberleben geführt;[S. 413] in den 1890er Jahren hat sie der Hauptmann Langheld endlich in dem genannten Busch von Runsewe seßhaft gemacht.
„Na, Mambo sasa, was wirst du mir schön dolmetschen können“, sage ich zu meinem ewig lustigen Freunde. Mambo ist in der Tat der Spaßmacher der ganzen Kompagnie; seine Stimme ist nicht melodisch, dafür aber laut und ausdauernd; seine Improvisationen verstummen denn auch niemals am Tage, weder auf dem Marsch noch im Lager. Schon stehen sich die Wangoni von Nchichira und der Mgoni von Runsewe einander gegenüber; nach meinem bewährten Verfahren beginne ich meine ethnologische Aufnahme. Mambo hat die Frage verstanden, er gibt sie in der Sprache seiner Jugend weiter. Es erfolgt keine Antwort; verständnislose Mienen ringsum. Das wiederholt sich noch mehrere Male, stets mit demselben negativen Erfolg; die Namensgenossen verstanden einander einfach nicht. In der Folge habe ich die beiden Elemente getrennt vorgenommen und von beiden Sprachen soviel aufgezeichnet, wie es mir angesichts des geradezu fabelhaften Unverstandes sowohl des guten Mambo sasa, wie auch der Stammesgelehrten von Nchichira möglich war. Das Ergebnis lautet, soweit mir eine Übersicht schon jetzt möglich ist, wirklich so, wie ich vermutet hatte: die Wangoni von hier haben mit den gleichnamigen Leuten oben bei Ssongea in Wirklichkeit nur den Namen gemein, nichts weiter; sie sind eine genau so durcheinandergewürfelte Horde von allen möglichen Stammesresten, wie sie in andern Teilen des Südens auch noch existieren.
Einen klipp und klaren Beweis für die letztausgesprochene Vermutung hat mir schließlich das Durchsprechen der Stammesgeschichte selbst gebracht. Neben dem Riesen Makachu ist mein Hauptgewährsmann der alte Madyaliwa, in dessen Dorfbereich die Boma erbaut worden ist, bei dem wir also sozusagen zu Gaste sind, und der der Chef der andern der beiden Sippen zu sein die hohe Ehre hat. Das jüngere und gleichzeitig „gebildete“ Element wird durch Herrn Saidi, den Lehrer von Nkundi, repräsentiert, der auf meinen[S. 414] Hilfeschrei endlich auch herbeikam, um mich aus allen Aufnahmenöten zu retten. Die Leute hier sind aber auch zu hinterwäldlerisch! Mehr als Staffage neben jenen drei Säulen dient ein halbes Dutzend anderer, meist älterer Männer, denen es anscheinend mehr darauf ankommt, meine Barasa vollzuspucken, als meine geschichtlichen Kenntnisse ihres Stammes zu bereichern.
Zunächst stellen Madyaliwa und Makachu ihre beiderseitige Sippenzugehörigkeit fest; jener gehört zur Lukohu der Makāle, Makachu zur Lukohu der Wakwāma. Unaufgefordert beginnt der Recke Makachu, dessen Stattlichkeit leider durch einen sehr tief zwischen den Schultern sitzenden Kopf beeinträchtigt wird, zu erzählen, er sei am Lukimuafluß geboren, aber sein Volk sei an den Mluhesi vertrieben worden, als er ein Junge gewesen sei. Ganz mechanisch ist bei dem Worte Junge der Arm des Sitzenden bis zur Wagerechten in die Höhe gegangen, ebenso mechanisch hat sich die Hand senkrecht zum Arm emporgerichtet. Es seien die bösen Wangoni gewesen, vor denen sie hätten davonlaufen müssen.
„Die Wangoni?“ frage ich daraufhin ganz erstaunt, „du bist doch selbst Mgoni.“
„Allerdings, aber es waren doch die Wangoni.“
Ich habe es für das Klügste gehalten, den Alten einstweilen nicht aus dem Konzept zu bringen, und so erzählte er weiter: „Als ich anfing einen Bart zu bekommen — heute ist Makachus kurzer Kinnbart fast weiß —, da kamen die Wangoni wieder; diesmal aber wurden wir bis zum Häuptling Namagone vertrieben, und die Wangoni waren zahlreich wie die Heuschrecken.“
Ich habe meine kostbare einzige Karte selbstverständlich stets zur Hand. Ein Blick auf sie belehrt mich, daß Namagone wirklich existiert, unter 38° 26′ östlicher Länge auf dem rechten Rovuma-Ufer; so weit nach Osten ist also schon der damalige Rückzug des einen Trupps dieser Wangoni erfolgt. Im gleichen Augenblick wird mir dieses auch schon von einigen der Beisitzer bestätigt; Kambale erzählt, daß er als[S. 415] Knabe bei Namagone gewesen sei, Liambaku aber, der etwas jüngere Bruder Madyaliwas, berichtet, auch er sei am Lukimua geboren.
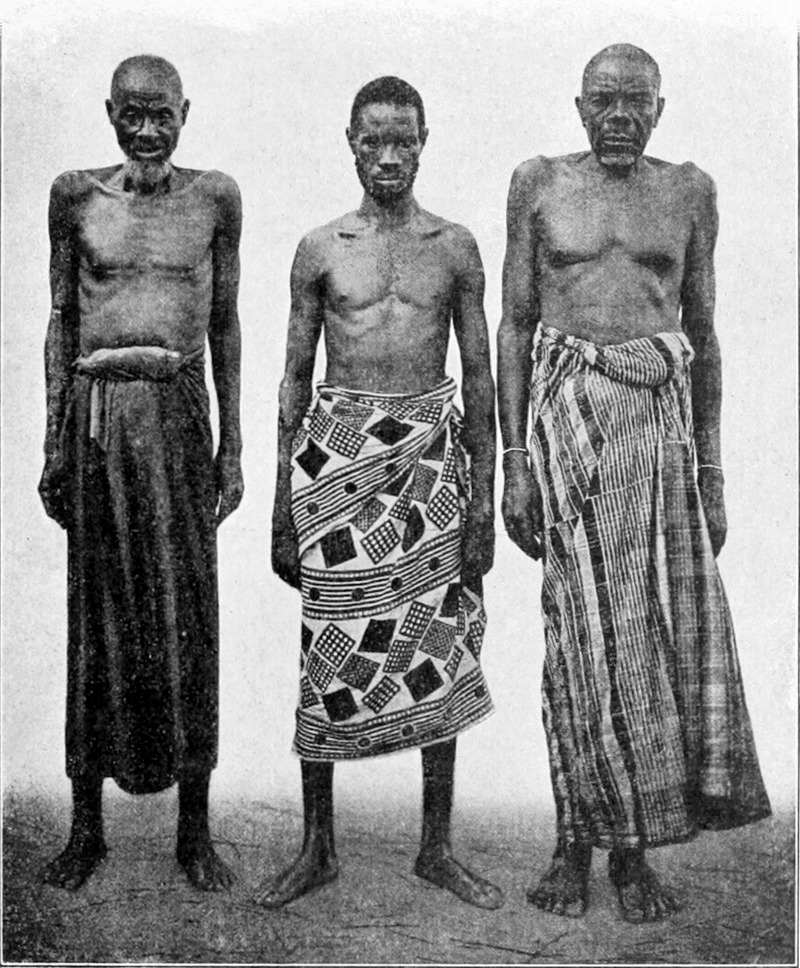
Makachu will gerade in seiner Erzählung fortfahren, da öffnet Madyaliwa, der Senior, seinen nur noch von Zahnruinen besetzten, welken Mund: „Vom Lukimua sind wir zu Kandūlu gegangen, dem Yaohäuptling. Von da haben uns die Wangoni vertrieben; erst sind wir zu Namagone gegangen und dann zu Makachu. Hier haben wir ein Jahr gesessen, dann aber sind die Wangoni auch hierher gekommen und haben uns von neuem verjagt; da sind wir bis Nchichira gegangen. Doch auch hier sind wir noch einmal von den Wangoni überfallen worden, und das ist zu der Zeit gewesen,[S. 416] wo schon ihr Wadachi, ihr Deutschen, eure Boma in Lindi gebaut hattet.“
Es meldet sich kein Redner weiter, also kann jetzt ich einsetzen:
„Ihr erzählt immer so viel von den bösen Wangoni, sind denn das nicht eure Brüder?“
Lebhaftes Gestikulieren ringsum: „Aber nein,“ erschallt es im gleichen Augenblick, „sie sind unsere schlimmsten Feinde.“
„Doch unterhalten könnt ihr euch miteinander?“
Auch hier ein einhelliges, glatt ablehnendes Nein. Aus dem weiteren Verhör geht dann folgendes hervor:
„Wir Leute von Nchichira nennen uns selbst Wangoni, die Leute aber von Ssongea nennen wir Mafiti. Die sind vor langer Zeit von weither gekommen; woher sie aber gekommen sind, das wissen wir nicht. Unsere Väter haben stets am Lukimua gesessen, und wären nicht die bösen Mafiti so oft gekommen und hätten Krieg mit uns gemacht, so säßen auch wir, ihre Söhne, noch immer am Lukimua. Mit den Wamatambwe sind wir nicht verwandt, doch mit den Yao sind wir gute Freunde; unsere Väter sind stets zu ihnen geflüchtet.“
Das ist also das Bild, welches ich auf Grund eines eingehenden Studiums von den Wangoni von Nchichira gewonnen habe. Sie sind in Wirklichkeit, wie ich oben schon sagte, ein Konglomerat aller möglichen Elemente, die sich in den langen Mafitiwirren hier in diesen entlegenen Winkel geflüchtet und zu einer Art Volkstum verdichtet haben. Wie sehr sie den Yao gleichen oder doch zu gleichen streben, zeigt nichts besser als das fast ausschließliche Vorkommen des Kipini, des Nasenpflocks, bei ihren Frauen; die Lippenscheibe ist bei diesen eine Seltenheit. Den Reiz des Neuen und Fremden, den diese Wangoni als wirkliche Kaffern auf mich ausgeübt haben würden, wenn sie sich tatsächlich als Südostafrikaner herausgestellt hätten, haben sie unter diesen Umständen natürlich für mich verloren. Immerhin bin ich sehr stolz darauf, die alte, falsche Ansicht, die man an der Küste von diesen Leuten bis heute hegt, endlich einmal berichtigt zu haben.[S. 417] Indes vermag ich nicht zu leugnen, daß das Ergebnis meiner Untersuchung stark mit dazu beigetragen hat, mir den Abschied von Nchichira leichter zu machen, als er mir sonst wohl geworden wäre.

Mein Abmarsch ist nicht direkt nach Mahuta zurück erfolgt. Nils Knudsen hatte die ganze Zeit über, wo ich mit den Wangonigelehrten volkskundliche Studien trieb, seinen Jagdfreuden gehuldigt. Immer wieder war er den auch hier außerordentlich steilen Plateaurand hinuntergestiegen, um unten in der alluvialen Rovumaebene mit ihrem reichen Wechsel von dichtem, hohem Wald, struppigem Gebüsch und wiesenartigen Flächen dem hier häufigen Dickhäuter aufzulauern und auch andere, kleinere Tiere zur Strecke zu bringen. Oft glaubte ich seine Büchse knallen zu hören, so nahe liegen die Jagdgründe unter der Boma von Nchichira, und mehr als einmal habe ich mir an meinem Standort auf dem Plateaurande eingebildet, die gebückte Gestalt des rasch und doch vorsichtig Vorwärtseilenden da unten auf dem Talgrunde verfolgen zu können.
Der gegebene Abendspaziergang für Nchichira ist nur sehr kurz, doch bietet er eine Überfülle des Schönen. Soeben ist der Sonnenball dort im Westen hinter dem fernen Nyassa zur Rüste gegangen. Aufs äußerste erschöpft, lege ich Notizbuch und Bleistift zur Seite, stecke mir eine frische Zigarre ins Gesicht — wir haben wieder welche, doch keine vom Inder, sondern echte Leipziger; hei, ist das ein Genuß nach jenem Rattengift von Lindi! —, winke meiner Apparatgarde und verlasse mit raschen Schritten die Boma. An ihrem Palisadenzaun schreiten wir entlang, bis er zu Ende ist; damit sind wir auch schon am Ziel: das Rovumatal mit seiner ganzen Herrlichkeit liegt unmittelbar zu meinen Füßen. Das Phänomen eines Sonnenunterganges zu schildern, ist schon an und für sich keine leichte Aufgabe; hier, wo zu der eigenartigen Oberflächengliederung des Landes, seinem merkwürdigen Gegensatz zwischen stärkster Erosion und machtvollster Auflagerung, ein geradezu unerhörter Farbenreichtum des Abendhimmels tritt, versagt die Feder einfach schon aus dem Grunde,[S. 418] weil es angesichts dieser Herrlichkeit für einen fühlenden Menschen überhaupt nicht möglich ist, seine Eindrücke zu Papier zu bringen. Hätte ich Farbenphotographie, das wäre ein Objekt! So muß ich mein Heil mit ganz gewöhnlichen oder höchstens orthochromatischen Platten versuchen; von der wirklichen Farbenpracht bringen diese natürlich nichts, da wird später daheim das Notizbuch aushelfen müssen.
Das Plateau ist hier, an seinem mittleren Südrande, bei weitem niedriger als bei Newala; man kann es auf 400 bis 450 Meter schätzen. Immerhin ruft das 10 bis 15 Kilometer breite, an seiner Sohle kaum 60 Meter über dem Meer gelegene Rovumatal den Eindruck einer gewaltigen, tiefeingeschnittenen Schlucht hervor. Seine beiden Ränder sind absolut gleich; einem Kinde muß es klar werden, daß drüben das Maviaplateau und hier das Makondehochland desselben Alters und eines Ursprungs sind. Es ist der Rovuma mit seiner Sägekraft gewesen, der dies alte Tafelland cañonartig auseinandergeschnitten hat. Jetzt, am Ende der Trockenzeit, sieht der Fluß kläglicher aus denn je: ganz dünn rieselt seine kümmerliche Wasserader in dem kilometerbreiten, von ungeheuren Kies- und Sandbänken erfüllten Flußbett. Um so gewaltiger wird er in der andern Jahreszeit einherfluten; zu meinen Füßen verfolgt das bloße Auge ein ganzes System von Hochflutbetten; auch drüben auf der portugiesischen Seite läßt das Fernglas ähnliches erkennen. Bei Hochwasser muß die Niederung einen großartigen Anblick gewähren; heute waltet mehr der Grundzug des Lieblichen, Heiteren vor. Der graue Streifen mit dem blinkenden Silberfaden darin liegt vor mir, als wenn ich ihn greifen könnte, und dabei sagt Knudsen, man müsse zwei starke Stunden wandern, bevor man am Ufer des Stromes stände. Dermaßen täuscht die merkwürdig klare Luft. Freilich, Rauchwolken steigen auch hier zum Himmel auf; besonders drüben auf der andern Seite, zwischen dem Strom und dem Nangadisee, sind sie zuzeiten recht dicht und häufig. Fast möchte ich meinen, die guten Mavia wollten den unglücklichen Portugiesen, der dort in seiner, mit dem Glase ganz deutlich[S. 419] wahrnehmbaren Boma wohl darüber nachdenken soll, wozu er eigentlich hierher verdammt worden ist, ausräuchern, so konzentrisch legen sich die Flammengürtel um das Haus des einsamen Europäers. Wendet sich aber das Auge mehr nach rechts: fast unabsehbar dehnt sich das graue Rovumabett mit seinen grünen Rändern gen Westen. Der Lidedesee ist nicht gar nahe, aber auch er liegt in dieser Perspektive noch fast zu unsern Füßen, so weit vermag mein scharfes Auge noch über ihn hinaus in das Innere des Erdteils zu schauen. Über dem allen das Erglühen des ganzen westlichen und südlichen Horizonts in tausend leuchtenden Tinten. Fast scheint es, als wolle auch die Sonne dieser Schönheit zuliebe nicht so rasch scheiden, wie sie das sonst zwischen den Wendekreisen zu tun beliebt; nur ganz langsam und allmählich werden der Farben weniger, wird ihre Leuchtkraft geringer. Nur mit Mühe habe ich mich von dem Bilde losreißen können, um mit kleinster Blende ein paar Aufnahmen dieser wunderbaren Szenerie auf die Platte zu bannen; stumm und sichtlich ebenso ergriffen wie ihr weißer Herr stehen auch meine schwarzen Freunde hinter mir. Erst dunkelt es langsam, dann senken sich rascher immer schwerere Schatten auf den Lidede und den Nangadi hernieder; auch über die Matten und den grünen Wald streichen jetzt die ersten dunkeln Töne dahin, nur das helle Grau des Strombettes hebt sich noch eine Weile aus der sinkenden Nacht hervor. Ich bin ein durchaus nüchtern veranlagter Mensch, aber ich gebe gern zu: ich hätte die Ziele eines Marsches bis zum entlegenen Nchichira als erreicht angesehen, selbst wenn dort keine Wangoni wohnten; ein einziger Sonnenuntergang hätte mich für alle Mühsal entschädigt.
In diesem Stromtal hatte also Nils Knudsen als ein gewaltiger Nimrod gewaltet. Es brauchte nur der erste beste Neger zu kommen und ihm zu sagen: „Herr, viele Elefanten stehen da unten“, so war er zehn Minuten später schon, so schnell es sein Seemannsgang erlaubt, auf dem Marsch. Verständigerweise vertraut er aber seinen eigenen Donnerbüchsen nicht mehr, sondern hat mich um eins[S. 420] meiner trefflichen Gewehre gebeten. Wie immer, sitze ich an einem Nachmittag mit meinen Gelehrten zusammen. Mit dem Kingoni will es gar nicht vorwärtsgehen; heiße ich die „Intelligenz“ Saidi übersetzen: Dein Vater ist gestorben, so kommt unweigerlich ein Satz zutage, der sich bei der Nachkontrolle herausstellt als: Mein Vater ist gestorben, und lasse ich ihn sagen: Mein Vater ist gestorben, so übersetzt er von seinem Standpunkt aus ganz richtig: Dein Vater ist gestorben. Solche Scherze sind mir seit langem geläufig, sie regen mich nicht mehr auf; schlimmer wird es schon, wenn man die persönlichen Fürwörter: ich, du, er, wir, ihr, sie festlegen will; Herrgott, welche Mühe haben mir diese schon bei den doch wahrlich nicht dummen Lehrern von Newala verursacht! Hier geht’s überhaupt nicht; ich mag anstellen, was ich will, die dritte Person Singularis und Pluralis sind nicht zu erzielen. Die erste und zweite habe ich glücklich noch herausgebracht, selbstverständlich auch wieder in der bekannten Umkehrung; will ich haben: „Ich“ und deute unwillkürlich dabei auf mich, so bekomme ich unfehlbar „du“ heraus, und umgekehrt. Resigniert will ich mir gerade eine Beruhigungszigarre anbrennen, da entsteht ringsum eine merkliche allgemeine Aufregung. In einem Tempo, gegen welches die Geschwindigkeit des Läufers von Marathon ein Schneckengang gewesen sein muß, rast einer der Diener Knudsens heran; sein Mund sprudelt irgend etwas hervor, von dem ich nichts verstehe; erst aus dem Munde meiner rasch zusammengelaufenen Leute und der Bomaeinwohner erfasse ich, daß Knudsen erfolgreich gewesen ist und einen stattlichen Elefanten zur Strecke gebracht hat. So groß, und dabei spreizen die Kerle ihre Gibbonarme auseinander, soweit es nur irgend geht, seien die Stoßzähne, und Fleisch gäbe es jetzt! Ich sah förmlich, wie den Burschen das Wasser im Munde zusammenlief.
Dieser und der nächste Tag haben ganz unter dem Zeichen des getöteten Elefanten gestanden. Wahre Berge von Fleisch wurden herangeschleppt, die ganze Gegend roch nach afrikanischer Küche, jedoch nichts weniger als schön. Dann kamen die vier Füße; darauf die Zähne;[S. 421] endlich der erfolgreiche Jäger selbst. So stolz der wackere Nils auch einherschritt, sehr glücklich war er über den Schuß nicht, denn in Wirklichkeit waren die Zähne im Verhältnis zu der Größe des Tieres nur sehr klein, nach unserer Schätzung höchstens 40 Pfund schwer. Dafür brachte mein Nimrod mir aber eine andere, für mich viel frohere Kunde: die Leute dort unten, die wohnten ganz anders als hier oben, fein und fremdartig zugleich; mehrstöckige Häuser seien es, die man da unten zu sehen bekäme! Nils hat erst einen Schwur tun müssen, daß er nicht lüge. Als er ihn aber, ohne mit der Wimper zu zucken, geleistet hatte, da hat es mich auch nicht mehr länger oben gehalten, und schon am nächsten Frühmorgen sind wir wie die Affen an den Klippen und Felsen des Plateaurandes in die Stromebene hinuntergestiegen.

[S. 422]
Seit ein paar Tagen nun sitzen wir hier im kümmerlichen Schatten verkrüppelter Bäume inmitten eines Gewirrs von Röhricht und hohem Grase, in dem unsere Leute nur mit Mühe den Platz für die Zelte freimachen konnten, unmittelbar am linken Ufer des Hauptstromes. Es ist eine Stelle, die den Ausblick aufwärts und abwärts auf eine weite Strecke gestattet; auch geradeüber liegt ausnahmsweise keine der sonst häufigen Inseln, so daß der Blick ungehindert über ein wahres Meer von Sandbänken bis ans jenseitige Ufer schweifen kann. Die vom mittleren Rovuma her sattsam bekannten steilen Abbruchsufer sind auch hier die Regel; sitzt man auf solch hoher Böschung, so ist es schon eine Kunst, das unvermutet und schnell auftauchende Flußpferd mit der Kugel zu treffen; selbst der sonst unfehlbare Nils knallt unter zornigem Knurren vorbei. Diese Steilwände sind aber auch das einzig Malerische in der weiten Einöde des Flußbettes selbst, sonst nur Kies und Sand und Sand und Kies, wohin man blickt. Zwischen ihren Massen verkrümelt sich der Rovuma noch mehr als weiter oben an der Bangalamündung, und die Wamatambwe, die hier zahlreicher schweifen als weiter oben, haben es keineswegs nötig, zu ihren berühmten Schwimm- und Tauchkünsten zu greifen; ganz gemächlich waten sie durch die einzelnen Rinnsale hindurch. Freund Nils kommt damit um eine wunderschöne Gelegenheit, mich von der Wahrheit einer Geschichte zu überzeugen, die er nicht müde geworden ist, mir stets von neuem zu erzählen, sooft von den Wamatambwe die Rede war.
„Schwimmen können die,“ hatte er immer gesagt, „das Krokodil ist nichts dagegen, und Furcht vor dem Reptil hat ein ordentlicher Matambwe auch nicht; erstens hat er seine Daua dagegen, und dann ist er im Wasser auch viel gewandter als das Tier. Wenn aber der Rovuma Hochwasser hat, und die Matambwe können mit ihren Einbäumen nicht über den reißenden Strom, da laufen sie einfach hinüber.“
„Wie, Herr Knudsen, die Leute laufen hinüber? Wie machen sie denn das? Etwa auf Wasserschuhen, oder wie sonst?“
[S. 423]
„Unten durch“, sagt Nils darauf und dabei macht er eine so bezeichnende Gebärde, daß man den Eindruck hat, er selbst sehe sich in diesem Augenblick auf dem Grunde des hochgeschwollenen Stromes dahinkrabbeln.
„Aber Mann,“ wage ich angesichts dieser Entschiedenheit nur noch ganz schüchtern einzuwerfen, „der Fluß ist dann doch über 1000 Meter breit; selbst wenn die Matambwe in der Minute 100 Meter abspazierten, was selbst in ruhigem Wasser nicht einmal möglich ist, geschweige denn in dem pfeilschnell fließenden Strom, so würden sie doch volle zehn Minuten unter Wasser sein müssen.“
Nils hat nicht nur den Dickschädel des echten Nordgermanen, er hat auch den Vorzug des bessern Landeskenners; daher wundert es mich gar nicht, daß nur eine Art bedauernder Blick mich streift. „Aber Neuling, was verstehst denn du davon?“ soll der mir besagen.
Also von diesen Taucherkünsten des sonst ganz amphibischen Volkes bekomme ich jetzt nichts zu sehen. Dagegen scheint mir auf Grund eigener Beobachtung das Zutrauen zu der berühmten Krokodildaua keineswegs so groß zu sein, wie Nils das behauptet; kommen die Matambwemänner, die Knudsen unentwegt über den zu unseren Füßen rauschenden Stromarm hinüberschickt, um die von ihm erlegten zahlreichen Enten zu holen, unversehens einmal in eine tiefere Stelle, ei wie ängstlich schauen sie da um sich und wie schnell hasten sie dem rettenden Ufer zu.
Doch darum bin ich ja gar nicht zum Rovuma hinabgestiegen; zu meinem Lobe kann ich auch gestehen, daß ich von der mir so karg zugemessenen Muße immer nur die Nachmittage auf den Strom verwendet habe; der Vormittag ist stets der Erscheinung gewidmet gewesen, von der Knudsen so viel Aufhebens gemacht hatte. Und diesmal hat er endlich einmal recht gehabt; selbst die einfachste Photographie besagt mehr als die langatmigste Beschreibung, daher verweise ich auf die beigegebenen schönen Bilder und beschränke mich in meinem Kommentar zu dieser merkwürdigen Erscheinung der Pfahlbauten[S. 424] lediglich auf das, was dem Völkerkundler und Kolonialfreund zu wissen unumgänglich notwendig ist.
Unser Abmarsch von Nchichira hat sich um ein weniges verzögert; Ursache: ein warmer Regen, der in langen, senkrechten Linien auf den pulvertrocknen Sand „herunternieselt“. Ein förmliches Aufatmen ringsumher bei Natur und Mensch, ist es doch der erste Bote der rasch herannahenden Regenzeit. Doch nur zu bald tritt wieder die unbarmherzige Sonne in ihre Rechte, der Zug setzt sich in Bewegung und verschwindet rasch im nahen Abgrund. Schon nach wenigen Metern Abstieg hört die Schlüpfrigkeit des steilen Pfades auf, heiß und trocken knirschen Stein und Fels unterm Fuß, heiß und trocken ist auch die Atmosphäre, in die wir mit jedem Schritt um den Bruchteil eines Meters hineintauchen; daß hier der Regen noch im Fallen hat verdunsten müssen, versteht man wohl. Endlich sind wir unten; ein dichter Urwald von gewaltigen Stämmen nimmt uns auf, doch auch hier nichts von der Kühle des deutschen Waldes; heiß, feucht und moderdunstig schlägt die Luft uns entgegen, und nur unsicher tastet der Fuß über den schwanken Boden hin. „Wenn das die Forstverwaltung wüßte; hier ist Nutzholz zu holen“, sage ich noch eben zu mir selbst, da hört auch schon die Herrlichkeit auf. Hat ein Orkan hier gehaust, oder ist die Lawine herniedergegangen vom jähen Steilabhang nebenan? Wie geknickte Streichhölzer liegen die gewaltigen Stämme kreuz und quer, durch- und übereinander; ein wahrer Jammer ist’s, das Ausmaß dieser Vernichtung mit dem ökonomischen Auge des Europäers sehen zu müssen. Mühselig springen und klettern wir weiter; der Boden wird trockner, jetzt tritt der Fuß hie und da in dichte Aschenhaufen; noch ein forschender Blick ringsum, dann ist mir alles klar. Auch hier unten ist es der Mensch, der die Natur nicht in Frieden lassen kann. Das Makondeplateau wäre mit seinen 10000 Quadratkilometern wahrlich groß genug, um lumpigen 80000 oder 90000 bedürfnislosen Negern das bißchen Lebensunterhalt zu gewähren. Nein, in Wirklichkeit genügt es diesem Neger, wie man sieht, nicht; in weitem[S. 425] Umkreis hat er mit seiner scharfen Hacke das Unterholz niedergeschlagen und verbrannt, den Riesenbäumen aber ist er in seiner gewohnten Weise mit Axt und Feuer zu Leibe gegangen; überall glimmt es an den Enden und Seiten der Stämme, und weiße Aschenleichen zeugen, genau wie an den jungfräulichen Stellen oben auf dem Plateau, von der verschwundenen Pracht stattlicher Laubbäume. Und da bringen sie auch schon einen der Sünder heran; bei Gott, es ist der alte Madyaliwa selbst; zum Überfluß grinst er auch noch, ganz stolz auf sein Zerstörungswerk. Und sein Beil hat der alte, schwache Mann noch in der Hand.

An wirklichen Wäldern mit brauchbarem Nutzholz ist Deutsch-Ostafrika wahrlich nicht reich; der berühmte Schumewald in Usambara und einige andere, ob ihrer Seltenheit angestaunte Wälder helfen uns über diese bedauerliche Tatsache nicht hinweg. Um so gebieterischer ergibt sich für uns die Notwendigkeit, die bisher unberührten Hochwaldkomplexe hier am Rovuma vor dem Raubbau der Eingeborenen zu[S. 426] schützen. Wir haben ein wohlbegründetes Recht dazu, den Anwohnern dieses Tales jeden Axthieb in ihm zu untersagen, denn die Besitzergreifung dieses neuen Kulturbodens außerhalb ihres altangestammten Plateaus ist lediglich eine Folgewirkung der durch die Deutschen herbeigeführten neuen, sicheren Verhältnisse. Schaute nicht hoch oben die Boma von Nchichira so kühn und trutzig ins Tal und zu den Mavia hinüber, keinem Mgoni und keinem Makonde würde es einfallen, auch nur ein Korn Mais außerhalb des Plateaurandes zu pflanzen. Heute wissen die Leute ganz genau, daß sie unter unserm Schutze auch da unten vor Überfällen vom andern Ufer aus sicher sind, daher steigen sie hinab und zerstören uns unsere schönsten Wälder.
Doch weiter geht es, eine Bodenwelle hinauf; dort ist endlich das Wunder, und gleich in doppelter Gestalt sogar. Staunend stehe ich vor einem Turm, und verständnislos glotzen auch meine Leute das fremdartige Bauwerk an. Madyaliwas neues Palais — hierher also hat sich der Alte täglich nach unserem Schauri zurückgezogen — ist nun zwar nicht dreistöckig, wie Nils Knudsen behauptet hatte, doch zwei Stockwerke und eine Mansarde bekommt man mit einiger Sophistik sehr wohl heraus. Das Parterre beherbergt die Wirtschaftsräume; in Wirklichkeit ist es ein mit Stroh umhüllter quadratischer Raum, in dessen Mitte das übliche Herdfeuer zwischen den drei Klumpen Termitenerde glimmt, und der wie immer angefüllt ist mit Töpfen, Löffeln, Kellen und anderem Hausrat der Negerin. In der „Beletage“ ist es weit feiner; nur der Aufgang läßt an Bequemlichkeit zu wünschen übrig. Als alter Turner bin ich im Nu oben, dem ungelenkeren Nils machen die in meterweitem Abstand an die Tragpfeiler des Hauses gebundenen Sprossen dagegen arge Pein, und wie der alte steifbeinige Madyaliwa nebst Gemahlin allabendlich diese Hühnerstiege emporklimmt, ist mir erst recht ein Rätsel. Doch dafür entschädigt ihn dann das ganz behagliche Schlafkabinett: eine dicke Strohlage bedeckt den Knüppelboden, die dürren Leiber aber hüllen sich in gar nicht üble Matten. Die Wangoni haben kein Mutterrecht, daher verstößt es[S. 427] nicht wider den Anstand, wenn Abdallah, der Kronprinz, oben das Dachgeschoß bewohnt; auch dieses ist für Negerverhältnisse ganz nett mit weichem Lager, Matten und Vorratskörben eingerichtet.

Das ist meine erste Berührung mit den Pfahlbauten der hiesigen Gegend gewesen; an sie schlossen sich noch sehr ausgiebige Studien, das Gesamtbild aber ist folgendes. Selbstverständlich dachte ich, als ich den ersten Orientierungsmarsch beendet und überall nur Pfahlbauten vorgefunden hatte, an die Furcht vor Moskitos und Überschwemmungen als Entstehungsursache dieser Bauart; manche der hochragenden Hütten liegen ja auch in Wirklichkeit unmittelbar im Bereich der Hochflut des Stromes. Indessen die Mehrzahl befindet sich auf den Rücken von Hügelwellen, die ganz außerhalb des Hochwasserbereichs liegen. Fragen wir also die Eingeborenen selbst, warum sie gerade so und nicht anders bauen. Gesagt, getan. „Pembe, der Elefant“ antwortete uns der eine, „pembe“ sagt auch der folgende,[S. 428] „pembe“ sagen auch die übrigen. Ich habe es zuerst nicht glauben wollen; der Elefant ist doch ein überaus scheues Tier, das die Nähe des Menschen unter allen Umständen meidet; da berichten uns die Eingeborenen, daß die hiesigen Vertreter der Spezies Elephas ein wenig anders geartet seien als ihre Brüder anderswo; erst vor wenigen Tagen habe ein solches Untier einen friedlich des Weges wandelnden Mgoni ganz ungereizt ergriffen und in die Höhe geworfen. Auch wenn ich mir den derben Palisadenbau betrachte, der so manche dieser hohen Bauten umgibt, so muß ich mir sagen: so ganz unrecht scheinen die pembefürchtenden Helden hier doch nicht zu haben. In jedem Fall hat mir die Entdeckung dieses Pfahlbautenstrichs hier dicht unter der Küste eine fast ebenso große Freude bereitet wie mein glückliches Erfassen der alten Stammesaufteilung im kühlen Newala.
Ja, diese Kühle! Wenn wir doch nur einen winzigen Teil von ihr hier unten in dieser Höllenglut hätten. Im Zelt bei Tage auch nur minutenlang zu verweilen, ist schier unmöglich; dort steigt das Thermometer hoch in die 40°, doch auch unter unserer Banda, dem schnell errichteten derben Strohdach, sitzen und schwitzen wir bei 36 und 37°. Dabei fehlt der sonst so gefürchtete Abendwind hier ganz; an seine Stelle ist, so scheint es, eine Legion von Moskitos getreten, gegen die man sich nur durch schleuniges Verkriechen hinter dem Bettnetz schon kurz nach Sonnenuntergang zu schützen vermag.
„Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen?“ habe ich soeben den unermüdlichen Knudsen gefragt. „Ich meine, haben Sie sonst noch etwas ethnographisch Merkwürdiges in petto?“ füge ich hinzu, als der total Erschöpfte mich nicht sogleich begreift.
„Nicht daß ich wüßte“, ist die Antwort.
„Gut, dann werden wir noch heute marschieren, zunächst wieder bis zur Barasa von Nchichira, morgen früh aber um ¾5 von Nchichira nach Mahuta.“
„Machen wir“, sagt Herr Knudsen und trollt sich in sein Zelt, um den total durchnäßten Khakirock gegen eine bessere Garnitur einzutauschen.
[S. 429]

Mahuta, 8. November 1906.
Das also ist der Nachtisch zu meinem Forschermahle! Nun, dieses Mahl ist nicht in allen seinen Teilen gleich schmackhaft gewesen, aber es hat doch eine lange Reihe von guten Gängen und vielen Leckerbissen gebracht, und das Dessert entspricht dem ganzen Charakter dieser vielmonatigen Schlemmerei: keinerlei Weiterbelastung des Magens, nein, ein durchaus angenehmer, einschmeichelnder, sachter Übergang zu der Dinerzigarre, dem Mokka und dem Verdauungsschnäpschen. So ist mir bisher Mahuta erschienen.
Schon der Empfang, wie feierlich war er! Freilich, die Neger sind Männer von Takt und guter Erziehung, ganz gleich, ob sie sich bereits mit dem weißen Kansu des Suaheli bekleiden, oder ob sie noch mit dem kümmerlichen Lendenschurz des Urmenschen einherlaufen. Es ist demgemäß ganz selbstverständlich gewesen, daß, wo ich hier im Lande auch erschien, die Spitzen des Dorfes mir mehr oder weniger weit entgegengeschritten kamen, um dem seltenen Besuch ihren Salam zu entbieten. Der Wali Abdallah bin Malim hat sie alle an Akkuratesse[S. 430] des Empfangs übertroffen; er ist nicht umsonst der Vornehmste im ganzen Lande, und fast möchten wir beiden, vom langen Marsch über und über bestaubten und beschmutzten Reisenden uns unseres durchschwitzten, auch sonst schon arg mitgenommenen Khakis schämen, als uns noch weit vor Mahuta die in das lange, schwarze, seidengestickte Gewand des Küstenarabers gekleidete Gestalt des Wali mit feierlicher Würde, das silberbeschlagene, kostbare Schwert in der Hand, entgegentritt.
Auch unsere Unterkunft ist vielversprechend. Durch einen unglaublich engen Schlitz in der Palisadenwand haben wir unsere schlanken Körper in die Boma gezwängt. Ei, ist die fein! Sie ist fast doppelt so groß als alle anderen im Lande, mit einer breiten Mittelallee von Kautschukbäumen und Mauritiusagaven zwischen den beiden Toren; zu beiden Seiten dieser Allee liegen die Wohnhäuser genau ausgerichtet. Angesichts des solid gebauten Rasthauses innerhalb der Boma fällt es mir sehr leicht, auf das Professorenhaus draußen an der Schlucht zu verzichten. Bald stehen unsere beiden Zelte auf dem freien Platz, Träger und Soldaten verteilen sich ihrer Gewohnheit gemäß in die Hütten und Kammern der Bomabewohner, da fühlt Abdallah bin Malim auch schon das Bedürfnis, mir seinen Besuch zu machen. Er ist noch immer festlich gekleidet; das berechtigt ihn seiner Ansicht nach wohl am meisten dazu, Knudsens Liegestuhl für sich in Anspruch zu nehmen. Ich für meine Person habe wieder einmal stark mit meinem linken, auf dem „Prinzregent“ versprungenen Fuß zu tun, der mir die ganzen Monate hindurch eine Unsumme von Pein und Schmerzen verursacht hat; auch jetzt ist er wieder arg geschwollen und will gekühlt sein. Abdallahs Stimme ist nicht melodisch, um so rascher aber ist der Tonfall, der den wulstigen Lippen des Wali entströmt. Wie ein Wasserfall geht das, es rollt, donnert, braust und zischt. Ja wirklich, es zischt: wie eine Rakete saust es durch die Luft; klatsch! spritzt es vor meinen Füßen auf. Ich bin in die Pflege meines unglücklichen Hinterbeins sehr vertieft und schaue kaum auf. Hscht — klatscht[S. 431] schon wieder eine Ladung seitwärts vor mir nieder. Jetzt werde ich auf den anscheinend doch recht interessanten Würdenträger aufmerksam, und wahrlich, er hat es verdient; eine solche Virtuosität im Spucken dürfte selbst für den größten Yankeekünstler auf diesem Gebiet ein unerreichbares Ziel bleiben! Ich habe allerhand Hochachtung vor den von der deutschen Regierung eingesetzten Organen, selbst den farbigen, aber im Interesse meiner Selbsterhaltung habe ich es doch vorziehen müssen, den Wali durch Knudsen auf das Unziemliche seines Betragens hinzuweisen; nicht einmal die Schensi täten das in Gegenwart des Bwana kubwa, da würde er es als feiner Mann wohl erst recht lassen können. Der Hinweis hat auch sofort geholfen.

Es ist morgens 8 Uhr; die Sonne steht schon ziemlich hoch in ihrer Bahn, die zu dieser Jahreszeit vollkommen senkrecht über Mahuta hinwegführt; mit unendlichem Behagen schlürfen die beiden Europäer die würzige Morgenluft. Mahuta ist aber auch der reine Luftkurort; nichts von lästiger Hitze und unbehaglicher Kälte; kein Nebel und kein Sturm; ein treffliches Trinkwasser am nahen Plateaurand; eine reinliche Barasa und Hühner in Menge; da schmeckt die Morgenzigarre, daß es eine Lust ist. Da horch! Ist das rollender Donner in der Ferne, oder machen die Makonde Krieg mit uns? Näher kommt’s, lauter und lauter wird das rollende, rhythmische Geräusch; jetzt vermag das Ohr auch schon verschiedene Ursprungsrichtungen zu unterscheiden; von Osten kommt’s und von Westen und anscheinend von[S. 432] Norden auch. Unverkennbar mischt sich nunmehr Gesang in den Trommelton, denn solcher ist’s. Wir treten aus dem Schutz des Daches und hinter den Zelten hervor, da quillt es auch schon herein durch die engen Pforten: einer hinter dem andern, immer mehr und mehr, als wolle es nie enden. Schon sind die schwarzen Massen in der Mitte des geräumigen Bomaplatzes zusammengestoßen, doch von beiden Seiten her strömt es noch immer von neuem herzu; die Allee ist voll, das schwarze Meer breitet sich über die Seitenteile des Platzes aus; es wogt und wallt, die Trommeln donnern, die Stimmen kreischen, trillern, singen; über dem allen an langen Stangen wehende Fahnen, schön bunt zu schauen wie geblümte Taschentücher; ganz hoch oben aber unabsehbare Scharen flockiger Zirruswölkchen und strahlender Sonnenschein. Es ist ein Bild, einzig in seiner Art, und sicherlich angetan, in seiner Wildheit den Pinsel eines Brueghel zu locken.
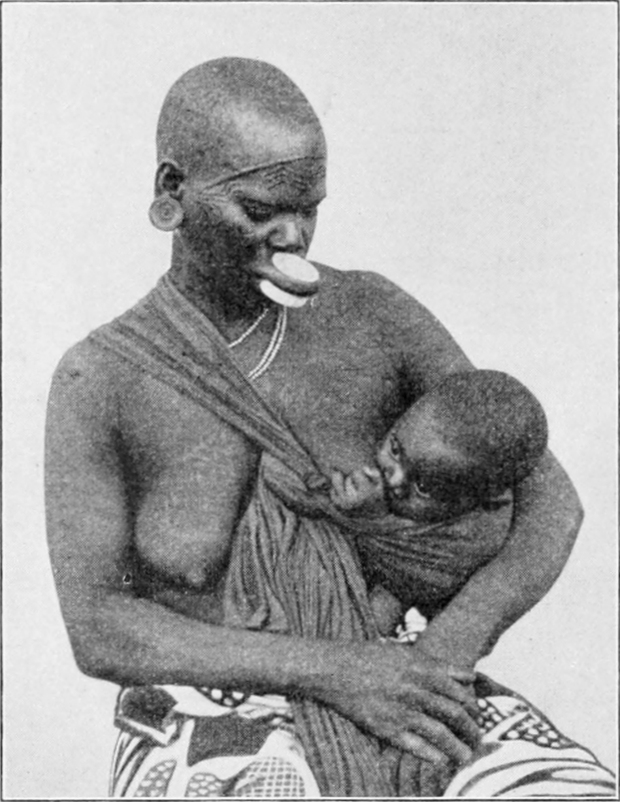

Malen kann ich nun zwar nicht, aber wozu habe ich denn 30 mit Platten wohlbewaffnete Kassetten; heraus mit euch aus Ledersack und Tasche! Doch wohin sich wenden bei dieser Überfülle von Motiven? Hier ein gewaltiger Kreis von Männern, Frauen und Kindern; in rasendem Takt donnern sechs gewaltige Trommeln zum Himmel, rhythmisch, wie von Geisterhand bewegt, regt die ganze, große Schar Arm und Bein, Mund und Hand im Takte. Und hinter diesem Riesenkreis, was ist das? Nun, Mädchen sind’s in jugendlicher[S. 433] Schlankheit und doch knospender Fülle. Im höchsten Diskant durchschwirrt ihr Triller die Luft, klapp klapp klapp klapp klapp arbeiten die hochgehobenen Handflächen gegeneinander. „Ä, die Liquata — Menschheit ist doch recht ideenarm.“ Enttäuscht wenden wir uns weiter; dort ganz hinten, die ganze Hälfte der einen Platzseite beanspruchend, exerzieren ein paar Schützenlinien im Feuer, aber echt afrikanisch. Deckung verschmäht der Neger, er ist Fatalist; trifft’s ihn, nun Inschallah! Das kommt ganz treffend in der Majimaji-Ngoma, der mimischen Darstellung des letzten Aufstandes, zum Ausdruck; unbekümmert selbst um das unheimliche rak-rak-rak-rak der „Bumbum“, jener teuflischen Maschinen, aus denen die Wadachi, diese verfluchten Deutschen, gleich tausend Kugeln in der Minute auf den Gegner schleudern, stürmt die schwarze Angriffslinie vorwärts. Vergebens: nicht einmal die starke Daua des Hongo, des kriegsgewaltigen Zauberers, schützt vor Tod und Verderben. Und da flutet auch schon der Gegner heran; sollen sie standhalten, die Majimaji? Die Bajonette der Askari sind scharf und spitzig, instinktiv taumelt die ganze Linie zurück, soweit das „Schlachtfeld“ es gestattet; unter heulendem Gesang stürmen sie gleich darauf wieder vor. Das wiederholt sich stundenlang.
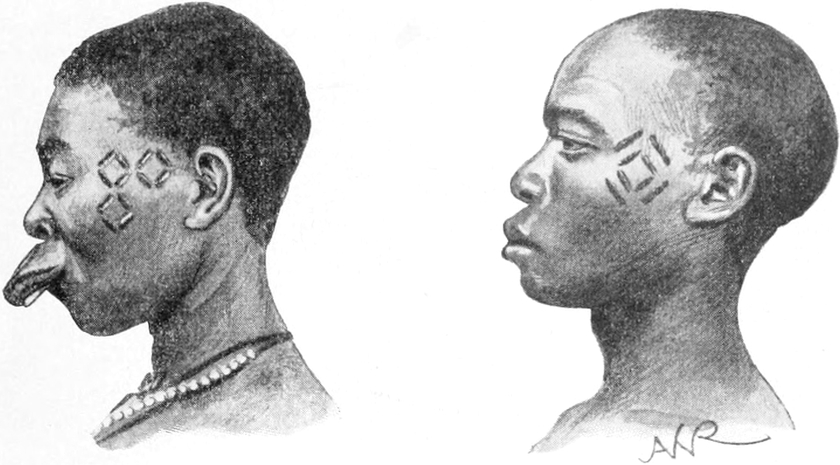
Mit Kamera und Kino habe ich getan, was in meinen Kräften steht; sie sind jetzt erschöpft, ebenso der Plattenvorrat. Die Sonne[S. 434] ist mittlerweile auch bis zum Zenit emporgeklommen; ermüdet, hungrig und durstig steht und lungert mein schwarzes Halbtausend unter den schattenlosen Kautschukbäumen herum. Uns aber rufen die Köche zu Suppe, Huhn und Bananeneierkuchen.

Abdallah hat es zu gut gemeint mit seinem Zustrom von Eingeborenen; eine solche Menge am gleichen Tag, die nützt mir nichts, das habe ich schon am ersten Morgen gesehen. Nach einiger Zeit hat es auch der Wali begriffen. Da hat er die Jumben von nah und fern von neuem entboten und hat ihnen eine lange Rede gehalten: „Morgen kommst du mit deinem Dorf, um 8 Uhr“ — der Arm zeigt im Winkel von 30° genau nach Osten — „und mitbringen sollt ihr midimu und mitete, Tanzmasken und Schnupfbüchschen, soviel ein jeder davon hat; und auch alle anderen Dinge sollt ihr mitbringen, die ihr in Haus und Hof, in der Schambe und im Pori habt; der weiße Mann liebt diese Dinge, und er wird euch Heller und Rupien dafür zahlen. Und übermorgen“, fährt er zum nächsten gewendet fort, „kommst du mit deinen Leuten, und auch ihr bringt alles mit, was ich eben aufgezählt habe.“ Zum Zeichen des Verständnisses fährt der Jumbe salutierend mit seiner Hand an die Mütze; dann folgt der nächste, und so fort.
[S. 435]
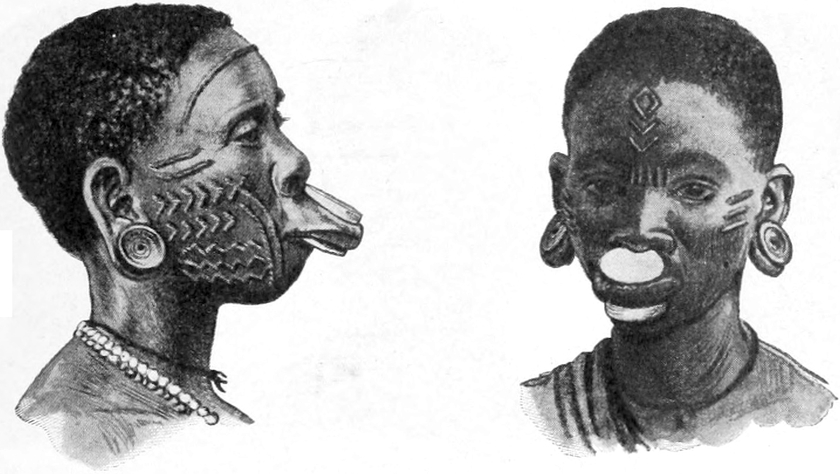
Das neue System bewährt sich gut; morgens habe ich volle Muße, die Leute einzeln zu photographieren, Tänze und Spiele auf den Kinofilm zu bannen, Walzen zu füllen und anderes mehr zu treiben; der Mittag verfließt im Studium der unsagbar mannigfaltigen Körperverzierungen der hiesigen Eingeborenen; der Nachmittag endlich ist den Männern und dem Feilschen um ihren materiellen Kulturbesitz gewidmet.
Nein, diese Weiber! Eng aneinander geschmiegt, die Köpfe einheitlich nach vorn und zu Boden gesenkt, steht eine Schar von 30 bis 40 Makondefrauen in einem Winkel der Boma von Mahuta. Bis jetzt hat es noch geplappert und geschwatzt, daß es eine Art hatte; da naht der fremde Mann im gelben Rock, und alles ist mäuschenstill; nur die 20 bis 30 Babys auf dem Rücken und den Hüften ihrer Mütter schnarchen weiter, brüllen oder suchen den mütterlichen Born. Längst kenne ich den Umgang mit Frauen, ein Scherz, und verflogen ist die Scheu, die Gesichter fliegen hoch, die richtige Stimmung ist da. Sie ist auch nötig, denn was gibt es an diesen Köpfen und Leibern alles zu sehen! Nur das frohe Lachen ringsum veranlaßt die einzelne, sich vom weißen Mann begucken und vielleicht auch berühren zu lassen. Sodann aber ist der Fremde ja auch unermeßlich reich, ganze Säcke[S. 436] und Kisten voll Pesa hat er mitgebracht, und jeder schwarzen Frau läßt er durch seinen Diener blankes Geld zahlen, wenn sie alles tut, was er will; die Freundin aus dem Nachbardorf hat es gesagt, und die muß es doch wohl wissen.
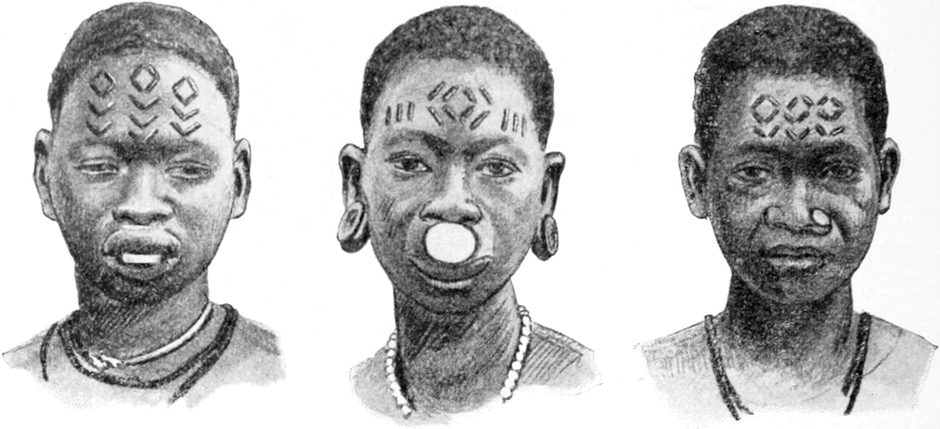
Der bisherige Verlauf meiner Reise hat mir bereits so viele Auswüchse menschlichen Eitelkeitstriebes gezeigt, daß ich mich gegen weitere Überraschungen völlig gefeit wähne. Kurzsichtiger Tor, der du bist, du Fremdling aus Uleia, so raunt mir der Makondebusch zu, dring ein in meine Tiefen, da siehst du Wunder über Wunder! Und ein Wunder will es mich wirklich dünken, daß diese zarten Lippen so ungeheure Massen schweren Holzes in sich tragen können; riesengroß, eine Hand breit im Durchmesser und drei Finger breit in der Höhe, klemmt sich das Ungetüm von Klotz, den die Hand der eitlen Trägerin mit feingeschlämmtem Kaolin täglich schneeweiß zu färben versteht, in den schmalen, straffgespannten Saum der so grausam durchbohrten, ausgeweiteten Oberlippe. Als die Kleine noch ein Kind war, da hat es begonnen; da kam ein böser Onkel und stach sie in den Mund, daß es arg blutete. Das Blut ist gestillt worden, aber das Loch ist geblieben. Erst hat die Mama einen feinen Strohhalm hineingetan und dann immer mehr und immer mehr, und dann haben sie eine[S. 437] kleine Rolle hineingesteckt in die Öffnung; ein Palmfiederblatt ist es gewesen. Das hat gespannt, daß man förmlich merkte, wie das Loch sich geweitet hat. Und dann ist ein großer Festtag gekommen, und sie haben ihr einen Holzpflock in die Lippe gesteckt. Das ist der erste gewesen; dem sind seither viele andere gefolgt, aber stets ist einer größer gewesen als der andere. Immer hat sie ihr Mann geschnitzt, und jedesmal, wenn er aus dem Pori heimkommt, bringt er die feine, weiße Erde mit. Ja, sie hat einen guten Mann, deswegen heißt sie ja aber auch Ngukimachi, das will besagen, daß sie gar keinen Anlaß hat, ihn zu betrügen, wie es alle die anderen Frauen mit ihren Männern tun. Aber er weiß auch, wie gut gerade ihr das Pelele steht; das ragt so geradeaus in die Weite, daß es eine wahre Lust ist zu schauen; und wenn sie nun gar erst lacht, dann blitzen ihre Zähne in schimmernder Pracht. Wie häßlich sind dagegen jene Alten dort! Denen sind die Zähne schlecht geworden; und wenn sie die Ugalikugel, die sie mit zitternder Hand aus dem Breiberg heraus[S. 438] geformt haben, zum Munde führen, dann sieht das schrecklich aus; wie in einem dunkeln Abgrund verschwindet die Speise in dem zahnlosen Munde, nachdem die andere Hand das Pelele vorsichtig emporgehoben hat.
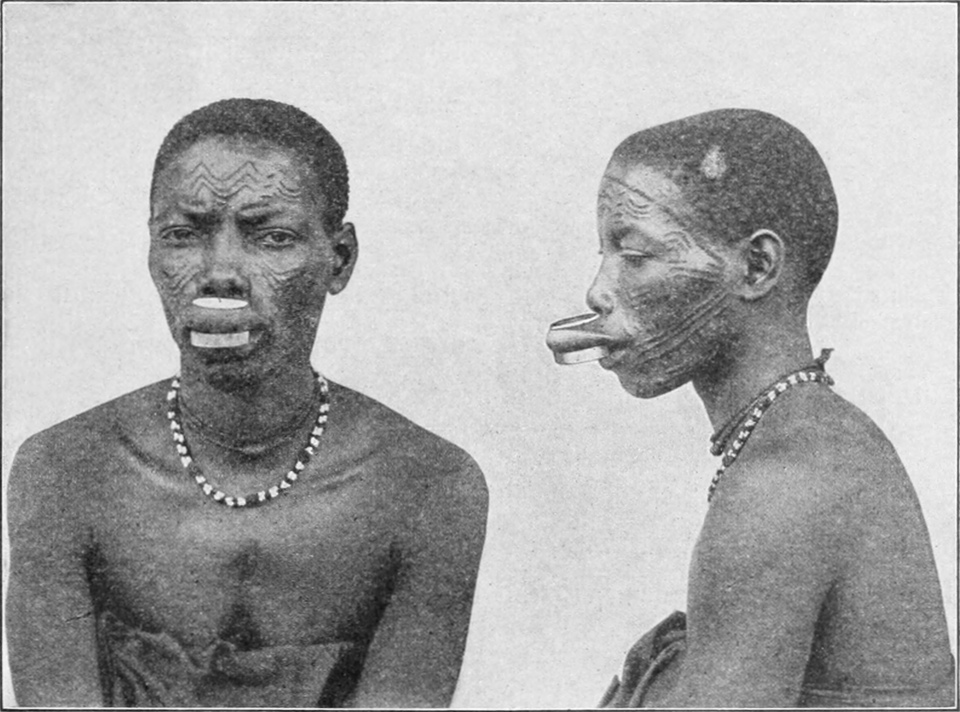
Und gar jene beiden anderen erst, wie sind die zu bedauern! Sie sind beide noch jung, die eine ein Mädchen, die andere eine junge Frau, aber stets traurig sind sie; sie haben auch beide Anlaß dazu, denn der Schmuck des Pelele ist ihnen versagt. Wieviel Daua hat die Mutter und auch der Onkel ihnen schon auf den Mund gestrichen, doch immer schlimmer und böser ist die Wunde geworden. Ein ganzes Loch hat der Eiter schon gefressen, und bei der Großen ist die Lippe nun ganz auseinandergefallen; sie sieht mit ihren großen, breiten Zähnen, die so weiß durch die Lippe schimmern, jetzt aus wie der Sungura, der Hase. Schön ist das nicht, und auch der weiße Mann mit seiner großen Dauakiste wird sie nicht heilen können. Daher sind sie auch wohl so traurig.

Auch Alitengiri dort drüben ist ernst; bei ihr zu Hause ist der Tod ständiger Gast; er hat in ihrer Sippe jüngst so reiche Ernte gehalten, daß nicht einmal ihre Schambe bestellt werden kann. Sonst ist sie doch so lustig gewesen und hat zu plappern gewußt, daß das Pelele kaum zu verfolgen war. Und ein schönes, großes Pelele hat sie gehabt, so groß, daß die Lippe es kaum noch zu tragen vermochte. Jetzt sieht sie stark verändert aus; sollte sie krank sein? Oder ist das[S. 439] Pelele etwa gar geschrumpft? Aber das geht doch nicht, das ist ja aus Holz; erkundigen wir uns doch einmal, was ihr fehlt. — Nein, sie ist doch auch zu hochnasig, die Alitengiri, nicht einmal geantwortet hat sie mir; ganz stumm und dumm hat sie dagestanden! Aber ich habe es wohl gesehen, sie hat gemogelt. An ihrer Lippe hat sie etwas; die ist sicher zerrissen, und da hat sie sie geflickt; ich habe den blauen Zeugstreifen sehr wohl bemerkt, den sie über jene Stelle gepappt hat. Und jetzt darf sie nicht sprechen und auch nicht einmal lachen, denn dann reißt die Wunde wieder auf.
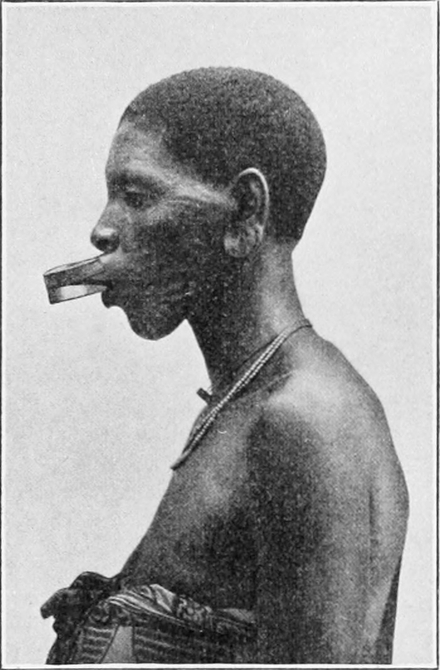
In den Abmessungen ihrer Lippenscheiben schlagen die Makondefrauen um Mahuta zweifellos alle ihre Schwestern im ganzen weiten Süden; Klötze von 7, ja 7½ Zentimeter Durchmesser und 3 bis 5 Zentimeter Höhe sind nichts Seltenes. Zählt man zu dieser hier stets schneeweiß schimmernden Mundzier die fast nie fehlenden schwarzen oder weißen, runden Scheiben in den talergroß aufgeweiteten Ohrläppchen, so machen diese drei Schmuckstücke allein schon ein Ganzes aus, das man auf dieser Erde in solcher Absonderlichkeit nicht wieder findet. Jedoch der Makondefrau genügt das nicht; wozu hat sie ihre schönen braunen Wangen und die von krausem Wollhaar umrahmte Stirn, den schlanken und doch kräftigen Arm, die üppige Brust, den schlanken Leib und den glänzenden Rücken? Drüben die Nachbarin, die läßt schon lange den Fundi kommen; der macht Schnitt auf Schnitt in die sammetweiche kühle Haut, und dann reibt er feine Daua, selbstgebrannte Pulver, in die kleinen Wunden. O, das tut sehr weh, aber es sieht doch auch gar zu schön aus, wenn[S. 440] erst alles verheilt ist. Doch das dauert noch lange, denn mit einemmal geht das nicht; immer wieder schneidet der Fundi an dieselbe Stelle, Schnitt neben Schnitt. Endlich wird er einmal fertig werden; ach, wird dann die Nachbarin schön sein! Es wird wohl nicht anders gehen, auch sie muß den Fundi bitten.

Die Zahl der Ziernarbenmuster, mit denen die Makondefrau Gesicht und Körper, diesen bis zum Gesäß und bis zu den Oberschenkeln hinunter, schmückt, erweckt auf den ersten Anblick den Eindruck, als sei sie Legion; in Wirklichkeit lassen sie sich auf eine nur verblüffend geringe Anzahl von Elementen zurückführen. Der Neger von heute hat für diese Grundbestandteile Namen wie Chitopole, die Taubenfalle, oder Chikorombwe, der Fischspeer, oder Teka u. a. m. Jenes erste Muster ist ein Bügel, wie ihn die Taubenfalle in der Tat besitzt; das Chikorombwe gleicht mehr einem Tannenbaum, die Teka einer Chitopole mit Mittelachse. Ob diese Muster in irgendwelcher Beziehung zur Taubenfalle oder zum Fischspeer stehen, kann ich nicht sagen, denn auch die Eingeborenen wissen es nicht; aber so viel weiß ich bestimmt, keins dieser Muster kann heute mehr als wirkliches Stammesabzeichen gelten. Als Neuling im Fach huldigt man dieser Ansicht so lange, bis man eines anderen belehrt wird; bei mir hat der alte Makachu dies in trefflichster und kürzester Weise besorgt. Der[S. 441] alte Herr ist über und über mit Mustern bedeckt, mit ganz den gleichen, wie sie die Frauen hierzulande tragen, nur daß bei ihm manche schon recht verwittert und verwischt sind.
„Warum trägst du das?“ frage ich ihn, in der sichern Erwartung, ein langes Kolleg über Stammeszeichen und ähnliche Einrichtungen zu hören zu bekommen.
„Ninapenda, es gefällt mir so“, ist die ganze Antwort des Riesen.
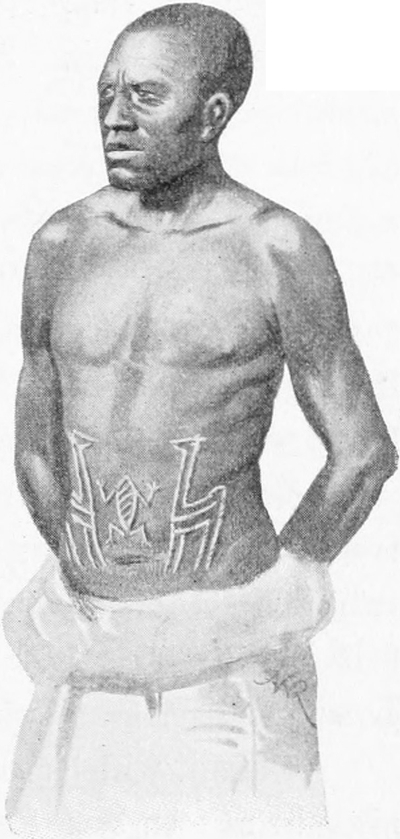
Mit diesem Hinweis auf den persönlichen Geschmack haben wir in der Tat die einwandfreie Lösung für die Narbenverzierung selbst, sodann auch für die Wahl der jeweiligen Muster. Ich habe während meines Aufenthaltes in Newala, in Nchichira und vor allem jetzt hier in Mahuta Hunderte und Aberhunderte von Einzelwesen entweder photographiert oder doch wenigstens körperlich besichtigt, das Ergebnis, soweit ich es jetzt schon übersehen kann, ist die vollkommene Unmöglichkeit, aus dem Vorwalten bestimmter Figurengruppen auf die Stammeszugehörigkeit ihres Trägers zu schließen; „ninapenda“ will jede einzelne dieser Figuren besagen.
Nun ist nicht zu leugnen, daß es auch in dieser Narbenzier Moden gibt. Von irgendwoher ist eine neue Figur eingeschleppt worden; sie findet Anklang, erst bei der einen Mutter, dann bei der anderen und dritten; wie mit einem Schlage hat sie sich über eine ganze Generation verbreitet, wird von dieser durchs Leben getragen und kann so in der Tat als eine Art Stammesabzeichen gelten. Vielleicht hat in früherer Zeit jede der hiesigen Völkergruppen auf diesen Teil ihres Kulturbesitzes einen höheren Wert gelegt; nachweisen läßt sich dies[S. 442] heute nicht mehr, wie denn überhaupt die Sitte unter dem Ansturm der neuen Zeit zu schwinden scheint. Es bereitet nicht nur mir, sondern auch den Betroffenen selbst stets ein ganz ungeheures Vergnügen, wenn ich die Männer und Jünglinge plötzlich auffordere, sich einmal etwas zu dekolletieren, d. h. ihr Hemd abzulegen und mir Brust, Bauch und Rücken zu zeigen. Bei den Alten eine wahre Menagerie von Antilopen, Schlangen, Fröschen, Schildkröten und anderem Getier, Chikorombwe, Chitopole oder Teka auf der breiten Männerbrust, bei der heranwachsenden Generation wenig oder nichts. Bei dieser gilt es eben nicht mehr als fein; sie schielt nach der Küste mit ihrer Hyperkultur und begnügt sich, wenn sie sich überhaupt herabläßt den Körper zu ritzen, mit den beiden senkrechten Schläfenschnitten der Suaheli. Bei den Yao und den Nchichira-Wangoni sind diese Schnitte schon heute sehr allgemein, bei den anderen Völkern werden sie es von Jahr zu Jahr mehr.
Der Leiter eines ethnographischen Museums muß schon daheim in Europa ein tüchtiger Kaufmann sein; geht dieser selbe Mann aber unter die Neger, so muß er einen Armenier an Schlauheit, Gerissenheit und Geduld übertreffen. Ich habe schon früher mit wehem Herzen auf die ungeahnten Schwierigkeiten gerade des Sammelns hinzuweisen Gelegenheit gehabt und kann mir daher neue Jeremiaden ersparen, doch leicht machen mir die Herren Makonde das Zusammentragen ihrer Kulturgüter keineswegs. In dichter Kolonne rückt der schwarze Schwarm heran.
„Na, was hast du denn da?“ spricht man leutselig und herablassend zum Vordersten; ein völlig abgenutzter Rührlöffel liegt in meiner Hand. „Für den Msungu ist der noch gut genug“, hat sein holder Besitzer gedacht und ihn aus der Müllgrube, wohin er schon gewandert war, herausgeholt.
„Schensi!“ ist die milde Anerkennung dieses löblichen Verfahrens, „so, hier hast du deine Kostbarkeit wieder; zeig’ mal her, was du sonst noch hast; wo hast du denn deine Maske?“
[S. 443]
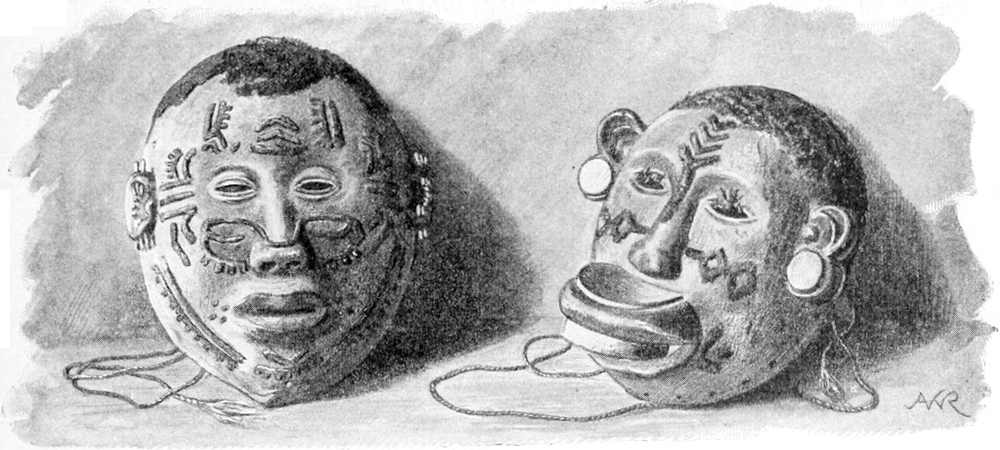
„Ich habe keine, Herr.“
„So, dann will ich dir Gelegenheit geben, noch einmal gründlich nachzusehen, morgen früh bist du wieder hier, aber dann mit deinem mdimu; vergiß auch deine Schnupfbüchschen nicht.“
So wiederholt sich das im Laufe der Stunden wohl ein dutzendmal und mehr; in einigen Fällen hat der Bußgang Erfolg gehabt, in den anderen ist es den Leuten gar nicht eingefallen wiederzukommen. Seitdem wir das gemerkt haben, belieben wir ein anderes Verfahren: jetzt machen wir einfach den Jumben verantwortlich, und seitdem geht es, geht ganz ausgezeichnet sogar; allabendlich haben Knudsen, alle Boys und auch die Trägerelite alle Hände voll zu tun, um die am Tage erworbenen Schätze zu registrieren und zu bergen.
Es lohnt sich wohl, das Sammeln hierzulande, vom wissenschaftlichen wie vom künstlerischen Standpunkt aus. Ostafrika gilt ja im Gegensatz zum Kongobecken, zu Nordkamerun und einigen andern Teilen des Westens als ein ethnographisch langweiliges Gebiet, und künstlerische Ansprüche an Form und Ausstattung der Waffen und Geräte seiner Völker darf man im allgemeinen nicht stellen.
Um so überraschter bin ich gewesen, in manchen Schnitzwerken meiner Forschungsprovinz wahre Kabinettstücke der Kleinkunst zu[S. 444] entdecken. Die Tanzmasken sind zum großen Teil wohl nur schematische Darstellungen, sei es der Frau oder des Mannes, oder irgendeines Tierkopfes. Eine geringe Anzahl von Exemplaren der von mir zusammengebrachten Sammlung stellt Porträts berühmter Persönlichkeiten dar: einiger bewährter Helden aus dem letzten Aufstand, ein besonders hübsches junges Mädchen und dergleichen mehr; im großen und ganzen aber sind sie alle, das läßt sich nicht leugnen, nur sehr rohe Arbeiten. Um ein weniges höher stehen schon die von mir früher gestreiften Statuen der Urmutter; die Anatomie und Harmonie des Körpers läßt zwar auch hier sehr zu wünschen übrig; dafür sind einige der Figuren, soweit meine Kenntnisse reichen, die einzigen Darstellungen des Menschen aus Afrika, die wirklich durchgearbeitete Füße aufweisen.

In hohem Grade geschmackvoll, in Durchführung und Stil selbst verwöhnten Ansprüchen genügend, sind besonders die Mitete, jene kleinen Büchschen aus hartem Holz, die von den Leuten zum Aufbewahren und Tragen ihres Schnupftabaks, ihrer Medizinen, hie und da auch ihres Schießpulvers benutzt werden. Was die ältere Generation der Männer als Ziernarbenornament in ihre Haut eingeritzt mit sich herumträgt: die Darstellung der ganzen Fauna des Landes, es tritt uns als Gebilde der freien Kunst hier in den Mitete von neuem entgegen. Stets ist es der Deckel des Gefäßes, der zum Kunstwerk ausgestaltet worden ist; er zeigt uns die verschiedensten[S. 445] Affenarten, das Gnu, den Buschbock und andere Antilopen, vor allem aber kehrt er in der Gestalt des Litotwe wieder und damit eines Tieres, das allerdings im höchsten Grade zur künstlerischen Nachbildung reizen muß. Dem Körper nach ist dieses Litotwe eine Art riesige Ratte, wohl von Kaninchengröße, in der Bildung seines Kopfes gemahnt es hingegen an den Elefanten, oder doch mindestens an den Ameisenbären. Der Kopf läuft in einen unendlichen Rüssel aus, so lang und zierlich, daß man glauben möchte, er fände gar kein Ende. In Chingulungulu habe ich einmal ein solches Wundertier zu zeichnen begonnen. Salim Matola, der Tausendsasa, hatte eins gefangen und mir in einem schnell improvisierten Käfig auf meinen Eß- und Arbeitstisch gesetzt. „Unsere“ Windhose ist schon vorbei, und bleierne Hitze brütet über Mensch und Tier. Nur ich bin fleißig wie immer; rasch fliegt mein Stift über das Papier, schon ist der Kopf des Litotwe vollendet. Bis dahin hat das Modell ganz manierlich „gesessen“, jetzt wird auch es schläfrig; immer tiefer senkt sich das Rüsselchen, immer bequemer und formloser legt sich der Körper auf mein einziges Tischtuch. Zur Aufmunterung „pieke“ ich die Flanken mit dem spitzigen Stift. Wie elektrisiert fährt das Rüsselchen hoch, senkt sich aber alsbald langsam wieder; ich pieke noch einmal, derselbe Erfolg; gerade will ich zum dritten Stich ausholen, da passiert dem Tierchen etwas Menschliches, Allzumenschliches. Im selben Augenblick schon fliegen Modell und Käfig in hohem Bogen nach außen; ich vermeine, ein leises, höhnisches Lachen zu vernehmen; ein Blick hinterher, der Käfig ist leer. Das war des Litotwe Rache.
Neben der Tierwelt kehrt in diesen Mitete vor allem der Mensch außerordentlich häufig wieder, und auch er ist glänzend durchgeführt. Aber sind wir in China, daß ein stattlicher Zopf vom Schopf des Gebildes herniederwallt? O nein, John Chinaman liebt es nicht, sein gelbes Antlitz zu zerstören; diese Physiognomien aber sind zerfetzt wie das Antlitz manches deutschen Studenten. Mavia seien es, werde ich belehrt, bei denen trügen die Männer eine solche Haartracht; beide[S. 446] Geschlechter aber seien bei ihnen noch viel mehr tätowiert als selbst die Makonde.
Bis heute weiß ich noch nicht, ob diese Mitete in der fast unübersehbaren Fülle ihrer Motive und ihrer durchweg prächtigen Durchführung das Werk hiesiger Künstler, oder ob sie Selbstporträts der Mavia sind. Die Verkäufer dieser Kostbarkeiten schweigen sich darüber aus, oder sie antworten, was hierzulande jeder in dem Falle sagt, wo er über den Autor eines Stückes nicht im klaren ist: „Schensi“ heißt es da, das will sagen: irgendein Unbekannter dahinten hat es gemacht. Für unser Urteil über diese Kunst ist das im übrigen belanglos.
Eine Art der Kunstübung scheint den Makonde zu fehlen. Wie immer in meinen Standquartieren schweife ich in jeder freien Stunde in die Weite, um die Eingeborenen in ihren Dörfern, in ihrem Heim zu belauschen. Das ist hier nicht so leicht wie sonst. Ich glaube, man könnte über das ganze Makondeplateau hinspazieren und träfe unter Umständen nicht eine einzige Siedelung, so versteckt liegen die kleinen Weiler im Busch. Doch wir haben hier einen idealen Führer; das ist Ningachi, der Lehrer; sein Name bedeutet: „Was denkst du?“ Nun ist Ningachi ein kreuzbraver Mann, aber ein starker Denker scheint er mir trotz seines Namens nicht gerade zu sein; er hat auch zumeist gar keine Zeit dazu, denn er ist mein Reisemarschall und mein Dolmetsch von früh bis spät; sogar junge, fette Hühner hat er uns schon höchst eigenbeinig aus weiter Ferne herangeholt.
Unter Ningachis Führung haben wir mehr als ein Makondedörfchen erschaut. Malerisch sind sie, das muß ihnen der Neid lassen, aber komfortabel selbst im bescheidenen Sinne des Negers ist keine der elenden, luftigen Rundhütten, in denen die Generationen dieses Volkes dahindämmern; nicht einmal den sonst so allgemeinen Lehmverputz hat der Makonde, und damit entfällt die Freske von selbst. In gewisser Weise bedeutet das für mich eine Erholung; wie bin ich in den früheren Monaten gejagt, wenn es hieß, dort in jenem Dorfe sind[S. 447] die Häuser schön bemalt. Bemalt waren sie dann allerdings, aber schön? Zeichnet unser Söhnchen schön, oder auch die unbeholfene Patschhand unserer Tochter? Embryonenhaft, ungelenk, ohne Perspektive, das sind auch die Grundzüge dieser Art von Negerkunst, die unsere Kunstwissenschaft, und leider auch die Völkerkunde, immer von neuem mit den stammelnden Kritzeleien unserer Kleinen verglichen haben.
Ich bin Ketzer in dieser wie in so mancher andern Richtung. Möchten doch Kunstgeschichte und Völkerkunde einmal das Experiment machen, einen guten deutschen Normaljungen — es kann auch ein Mädchen sein — ohne jede Betätigung mit Feder und Blei aufwachsen zu lassen, sozusagen als Wilden. Dann nehme man ihn her, mache es wie ich hier mit meinen Negern und gebe ihm Papier und Bleistift in die Hand mit dem Auftrage, irgend etwas zu zeichnen. Würde wohl etwas wesentlich anderes herausspringen als das Bilderbuch des kleinen Moritz? Es geht durch die ganze Menschheit der Zug, zugängliche freie Flächen, Fels- und Hauswände, Aussichtstürme und Bedürfnisanstalten mit den Werken einer Art Ur- und Universalkunst zu bedecken. Wo nicht der wirklich geübte Künstler sich einmal vergessen hat, wo vielmehr der Mann des Volkes, der Handwerksbursche und der Landstreicher seine Zeichen macht, da sind diese „Werke“ in Auffassung und Charakter nicht um einen Deut anders als die farbigen Tonmalereien oder die Ritzfiguren meiner Wangoni, Yao und Makua oder die Bleistiftzeichnungen aller dieser Völker und meiner eigenen Leute in meinen Skizzenbüchern.
Ja, diese Skizzenbücher! Ich weiß nicht, wie lange die Erinnerung an mich hier im Süden und bei meinen eigenen Leuten im Gedächtnis haften bleiben wird, und ob man überhaupt des Bwana Picha, wie ich hier heiße, d. h. des Mannes, der alles photographiert, noch über den Schluß der Expedition hinaus gedenken wird. Wenn es geschieht, dann, so sagt mir mein Gefühl, wird weder mein ganz unaussprechlicher Name — ein einziges Mal haben meine Wanyamwesi das Wort Weure zuwege gebracht, aber sie mußten dermaßen dabei[S. 448] lachen, daß ich keinen weiteren Versuch gemacht habe, sie an dieses Unwort zu gewöhnen — noch mein Titel — einen Bwana Pŭfēsa hatten sie aus dem Herrn Professor gemacht — noch die Zaubernatur meiner Maschinen diese Erinnerung vermitteln, sondern die vielen Bücher mit dem schönen weißen, dicken Papier werden dieses Verewigungsmittel sein. Es ist aber auch gar zu schön, diese Blätter so in aller Behaglichkeit zu bekritzeln.
In Lindi war es, wo die Kunstbetätigung meiner schwarzen Freunde so recht von Herzen einsetzte. Besonders Herr Barnabas war unermüdlich; stolz und doch erwartungsvoll überreichte er mir täglich immer neue Meisterwerke. Ich bringe hier in diesen Blättern nur eins: die Elefantenherde auf Seite 238; aber schon diese Skizze allein charakterisiert den Künstler vollkommen. Hat man das Recht, ihm eine gewisse Kraft der Auffassung abzusprechen, und steht nicht auch die technische Durchführung vollkommen auf der Höhe? Freilich ähneln die einzelnen Tiere mit ihren kurzen Beinchen bedenklich unserm Hausschwein, in der Kopfpartie aber dem Chamäleon; der obere Rüsselstrich ist auch hinter dem linken Stoßzahn sichtbar, und dem „mtoto, dem Elefantenkinde“, auf der rechten Bildseite fehlt gar der Hinterleib — aber gleichwohl: der Mann kennt nicht nur die Perspektive, sondern er wendet sie auch an, und in nicht einmal übler Weise zudem.
Nur einen Fehler hat Barnabas bei allen seinen Künstlertugenden: er ist kein „Schensi“, kein roher, unbeleckter Hinterwäldler, sondern ein Gebildeter, ja ein Gelehrter sogar. Von Geburt ein Makua weit aus dem Innern, hat er in Lindi die Regierungsschule absolviert, um nunmehr in dem kleinen Postamt des Städtchens als „Postboy“ dem wichtigen Geschäft des Abstempelns der Briefe, des Wiegens der Pakete usw. obzuliegen. Nebenher schriftstellert er gar für die in Tanga erscheinende Suahelizeitung „Kiongosi“.
Also mit Barnabas ist es nichts; ihn kann und darf man nicht als Vertreter der Urkunst betrachten. Dafür alle andern: Träger, Soldaten, Wilde; keiner hat bislang Papier und Bleistift in der Hand gehabt.

[S. 449]
In hoher Blüte steht die Marinemalerei. Kein Wunder; dem Motiv eines auf der Meeresflut schaukelnden, segelnden oder dampfenden Fahrzeuges widersteht schon im kalten, nebligen Uleia so leicht kein ästhetisch veranlagtes Gemüt, um wieviel weniger hier am stahlblau leuchtenden Indischen Ozean. Mein Askari Stamburi, so benannt nach der Stadt des Padischah am Goldenen Horn, ist im Dienst ein schneidiger Soldat, außer Dienst ein Don Juan; jetzt entpuppt er sich unerwarteterweise auch noch als bedeutender Marine- und Tiermaler. Auch er ist Landratte, weit hinten am obern Rovuma zu Hause; daher ist ihm das Abenteuer des Matambwefischers (Seite 421) besser gelungen als das Bild der arabischen Dhau (Seite 41). Exakt genug ausgeführt ist sie freilich; sie ist gerade vor Anker gegangen; noch bläht sich das Segel an der Gaffel; auch Flagge und Steuerruder sind vorhanden. Zum Überfluß auch noch drei Paddelruder, die oben in den Wolken schweben. Sie sind für die Windstille berechnet, wie mir der Zeichner sagt. Doch, was ist das in der Mitte? Hat das Schiff ein Leck oder deren gleich zwei? Weit gefehlt! Ladeluken sind’s, mein Freund. Solche Öffnungen sind auf dem Schiff vorhanden, das weiß Stamburi; also muß er sie auch anbringen; das ist Künstlerpflicht. Perspektive kennt er nicht; somit dreht er sie einfach um 90 Grad und sieht sie seitlich von oben. Dem Genie erwachsen keine Schranken.
Der Matambwemann vom obern Rovuma ist fischen gegangen; dort an der Strombiegung hat er sein Boot verankert, die Angel mit dem ungefügen Eisenhaken ausgeworfen und harrt nun mit der philosophischen Ruhe des alten Anglers auf das bewußte Zerren an der Leine. Gerade jetzt erfolgt es; ein kurzer Moment des Wartens noch, dann ein Ruck, ein gewaltiger Schwung — ein breites, rundes Etwas liegt im Grase. Bedächtig läßt der Fischer die derbe Schnur durch die Hand gleiten, um die Beute zu sich heranzuziehen; da, was ist das? Taucht der Scheitani aus den Fluten, der Satanas, oder ist es der Flußgott selbst, was sich dort so schnell wie das Feuer, das[S. 450] Mulungu unter gewaltigem Getöse so oft aus den Wolken zur Erde herunterschickt, auf seine schöne, große Schildkröte stürzt? Rasches Handeln ist sonst des graubärtigen Alten Sache nicht, doch hier heißt’s festhalten, was man hat. Zudem ist’s ja auch nur eine gewöhnliche Schlange, wenn auch ein gewaltiges Exemplar, was ihm dort seine Beute streitig macht. Der werden wir sie schon abjagen!
Das historische Genre, so könnte man in der Tat die ganze hiesige Malerschule benennen; stets bringt sie Szenen aus dem täglichen Leben, aber es sind gleichzeitig doch historische Vorgänge, die der Maler mit eigenen Augen verfolgt hat, deren Einzelzüge ihm fest im Gedächtnis haften, und deren handelnde Personen, ob Mensch oder Tier, wirkliche Porträts sind. Der Zug des reinen Genres wird noch am meisten gewahrt von den Zeichnungen auf Seite 206, 345 und 463; die Frau unter der Hüttenbarasa am Mörser (S. 206) ist ein ebenso alltägliches Bild aus dem Volksleben wie die Mutter mit dem Baby auf der Hüfte (S. 345); da entfällt das Moment des Porträts noch am ehesten. Auch bei der Überreichung der beiden Eingeborenen (S. 463) durch Pesa mbili war von der Darstellung bestimmter Persönlichkeiten keine Rede; an jenem 21. Oktober hatte ich mich in der Boma von Mahuta vorwiegend mit dem Studium der Ziernarben befaßt; viele Männer hatten sich entkleiden müssen; das hatte den intelligenten Mnyampara zu der Wiedergabe von ein paar solchen Gestalten angeregt.
Bei allen andern Zeichnungen waltet das historische oder das persönliche Moment oder aber beide gleichzeitig vor. Wenn der Suaheli Bakari weit im Innern, in Nchichira, den Dampfer „Rufidyi“ aus der Erinnerung zeichnet, und er setzt in den Vordergrund einen riesigen Hai (S. 32), so bedeutet das Gemälde nichts anderes als eine bestimmte Fahrt des Künstlers auf jenem Schiff, von dessen Deck er an einem bestimmten Ort eben jenen Fisch gesehen hat. Als der Träger Yuma mir das Bild „Affen beim Einbruch in eine Pflanzung“ (S. 211) überreichte, fügte er seinem Kommentar die nähere Erklärung[S. 451] hinzu: „Aber, Bwana kubwa, das ist meine Schambe, und die Affen habe ich mit Steinen verjagt; es waren sieben sehr große Tiere.“
Wirkliche Porträts sind der Bwana Pufesa, der Herr Professor, auf Seite 457 und der Stelzentänzer (S. 292). Jener ist das Werk eines Soldaten, dieser eine der unverkennbaren Skizzen meines Kochs Omari; beide stammen noch aus der ersten Zeit der Expedition, wo ich den Reiz der Neuheit noch nicht eingebüßt, der Bondeimann aber nur erst einen einzigen Stelzenmann zu Gesicht bekommen hatte. So schlecht Omari sonst zeichnete, hier hat er doch den Mut der En face-Zeichnung bewiesen, zu der ein Anfänger in der Kunst sich sonst nur ganz selten versteigt. Daß mein rechtes Auge als Stern im Weltenraum spazieren geht, ist nicht verwunderlich; es ist bei dem rauchenden Msungu mit dem weißen Helm und den großen Taschen im Rock in Wirklichkeit vorhanden, folglich muß es auch auf die Zeichnung.
Eine Anzahl der Zeichnungen führt an der Hand von ganzen Szenen in die Volkskunde des Südens von Deutsch-Ostafrika ein. Da ist zunächst die „Kette“ (S. 42). Sieben Mann stark, zieht sie langsam durch die Straßen Lindis dahin, fünf Sträflinge mit dem großen Blechgefäß auf dem Kopfe, die letzten beiden unbelastet. Es gilt, beim Europäer das Badebassin zu füllen; das ist nicht schön, der hohen Leiter wegen, bei deren Besteigung die schwere Kette so heftig am Nacken zerrt; doch der Askari dahinten ist streng; zwar die Nilpferdpeitsche steht ihm nicht zu, die ist nur ein Phantasieerzeugnis des Malers, sein großes Gewehr hat er jedoch immer bei sich; das soll sogar geladen sein, seitdem kürzlich eine Kette rebellisch geworden ist und den überwachenden Soldaten meuchlings niedergeschlagen hat. Da ist so eine Liquata (S. 64) doch etwas viel Ansprechenderes und Erfreulicheres, zumal wenn der Bwana picha, der erst vor einer Stunde zugereiste weiße Mann, die lebhafte Szene in seinem dreibeinigen Kasten auf eine jener merkwürdigen Glasplatten zaubert, auf denen alle die schwarzen Frauen weiß und ihre großen, weißen Lippenscheiben[S. 452] kohlschwarz aussehen. Auch die Karawane des Mdachi selbst lockt sehr zur Wiedergabe in dem großen Buche mit dem schönen, dicken Papier (S. 136). Wie stolz tragen die beiden Boys Moritz und Kibwana die Gewehre ihres Herrn! Der sitzt auf seinem Nyumbu, dem alten Maultier, und dreht sich gerade um. Lustig weht die Reichsdienstflagge im Morgenwinde; dahinter aber, da kommen sie heran, die Träger alle, mit Kisten und Kasten, Stöcke in der Hand, mit denen sie im Takte an die Kisten schlagen, alle fröhlich und guter Dinge. So sind sie ja aber, die Freunde Pesa mbilis aus dem fernen Unyamwesi.
Lustig war auch die Jagd, die Salim Matola auf Seite 102 verewigt hat. In dem bogenbewaffneten Jägersmann hat der Künstler sich selbst gezeichnet, wie er dahinschreitet, dem Hunde nach, der eifrig dem Buschbock folgt. Kwakaneyao, der braungelbe Hund, ist von Haus aus sehr scharf; sein Name bedeutet, daß er jeden andern Hund wegbeißt, der ihm die Beute streitig machen will. Trotzdem hat Salim Matola vor dem Aufbruch erst noch ein übriges getan, indem er dem vierbeinigen Jagdgenossen die Zähne mit bestimmten Wurzeln einrieb und indem er ihm etwas vom letzterlegten Buschbock zu fressen gab. Wie ein abgeschossener Pfeil ist da Kwakaneyao losgesaust ins wilde Pori hinein; kaum daß sein Herr ihm zu folgen vermochte.
Dieses Pori mit seiner so mannigfaltigen Tierwelt führt derselbe Salim Matola uns in einem andern Bilde, dem auf Seite 477 wiedergegebenen, vor. Trotz aller Skizzenhaftigkeit kann man sich keine treffendere Wiedergabe des Charakters der lichten Baumgrassteppe denken: die vereinzelt stehenden, sperrigen Bäume, dazwischen das harte, übermannshohe afrikanische Gras; links in der Tamariske die dunkelgrüne Baumschlange, rechts ein Nashornvogel, im Hintergrunde eine kleine Antilope als Charaktertiere — kurz, in seiner Art ein kleines Meisterwerk.
In die Tiefen des Volksglaubens führt uns der Makua Isak mit seinem auf Seite 265 wiedergegebenen Bildchen. Das drollige[S. 453] Tierchen dort ist der Unglücksvogel Liquiqui, die Eule. Marquardts Töchterlein brachte sie durch ihren Nacht für Nacht wiederholten Ruf den Tod; auch sonst sieht und hört man sie nicht gern.
Ein Bild aus dem Makondeleben endlich bringt die kleine Skizze auf Seite 305. Mtudikaye, die „Gastfreie“, und ihre Tochter Nantupuli, die leider immer noch keinen Mann bekommen hat, trotzdem sie es an Bemühungen keineswegs hat fehlen lassen, haben gegenwärtig ihre „Wasserwoche“. Die Männer haben jetzt alle Hände voll mit dem Urbarmachen des Busches zu tun, da müssen sich eben die Frauen mit den derben Tragstangen samt den großen Flaschenkürbissen belasten, um unten aus dem Bach am Fuße des Plateaus das zum Kochen nötige Wasser herbeizuschleppen. Der Weg ist weit und steil dazu, doch jetzt sind sie endlich am Ziel; dort die beiden Bananenstauden mit den schweren Fruchttrauben sind das Wahrzeichen der Schöpfstelle; klettert man in ihrem Schatten auf die großen, runden Steine im Bachbett, so strömt ein viel klareres Naß in die Gefäße als vom schlammigen, zertretenen Ufer aus.
Und nun endlich die Wissenschaft. Meine schwarzen Expeditionsgenossen müssen ein ausgeprägtes geographisches Gefühl besitzen; anders kann ich mir die zahlreichen Land- und Routenkarten nicht erklären, mit denen sie mich überschüttet haben. Ich bringe hier (S. 15) nur eine, die erste und darum für mich überraschendste. Ihr Autor ist Sabatele, ein ganz unberührtes Naturkind von weit hinten aus der äußersten Südwestecke unserer Kolonie, nämlich vom Südende des Tanganyikasees; schon zu Beginn der Expedition, in Lindi, brachte er sie eines Tags heran. Großes Schauri; Pesa mbili, der Trägerführer, und die anderen Intelligenzen natürlich dabei. Nach einer Viertelstunde ist die Identifizierung all der rätselhaften Zeichen gelungen; und wahrlich, staunenswert genug ist diese kartographische Erstleistung mit ihrer ganz richtigen Orientierung und der lediglich in einzelnen Ortsabständen mißglückten Topographie. Ich deute auf das seltsame Gebilde bei Nr. 1 der Zeichnung: „Mawopanda“ hallt es im gleichen Augenblick[S. 454] zurück. Das ist Kinyamwesi und bedeutet Daressalam. Nr. 2: „Lufu!“ lautet die Antwort. Das ist also der Ruvu unserer Karten, der große Fluß, den die Wanyamwesiträger bei ihren Wanderungen auf der großen Karawanenstraße überschreiten müssen. Nr. 3: „Mulokolo!“ lautet die Erklärung. Also Morogoro, der vorläufige Endpunkt der großen Zentralbahn, die dem altgewohnten Karawanenwesen der Wanyamwesi und Wassukuma für immer ein Ende bereiten wird. Den Wanyamwesi wird die Aussprache des R schwer; sie ersetzen es meist durch L; so stramme Burschen und dabei ein so weiches Idiom — ein merkwürdiger Gegensatz!
Nr. 4 ist der „Mgata“, also die zur Regenzeit völlig versumpfte Makatta-Ebene zwischen den Uluguru- und den Rubehobergen. „Kirossa!“ schnarrt es mir im nächsten Augenblick entgegen, als ich mit dem Bleistift auf Nr. 5 deute. „Natürlich, gerade wo kein R ist,“ brumme ich, über das prächtige Zungen-R entzückt, „da sprechen sie’s; also buchen wir: Kilossa.“ Nr. 6 ist die „Ballaballa“, die große Karawanenstraße selbst. Nr. 7 Mpapua, das alte Karawanenemporium, einst der letzte Ruhepunkt vor dem gefürchteten Marsch durch die Marenga Mkali, die große Bitterwassersteppe, und durch Ugogo auf dem Marsch ins Innere, die Erlösung von Durst und Mißhandlung auf dem Marsch zur Küste. Zögernd setze ich den Stift auf Nr. 8; der Zeichnung nach muß es ein Gewässer sein; mir ist aus jener Gegend jedoch keins bekannt. Richtig ist mir denn auch der Mutiwe, den Sabatele jetzt nennt, ein unbekannter Begriff; erst auf der Spezialkarte entdecke ich, daß er bei Kilimatinde vorüberfließt, wohlgemerkt, wenn er Wasser hat, was in jener Gegend nicht immer der Fall ist. In Sabateles Gemüt muß er als Wasserader haften geblieben sein; was sollte den materiellen Gesellen sonst an diese Örtlichkeit erinnern?
Doch nun gelangen wir ins Herz Deutsch-Ostafrikas und damit in Gegenden, die meinen Getreuen geläufig sind. Nr. 9 ist Kilimatinde, das hochgelegene; Nr. 10 nennt Sabatele Kassanga. Ich glaube Katanga, den Kupferdistrikt weit unten im Kongobecken, zu vernehmen[S. 455] und schüttele den Kopf; so weit kann der junge Mann doch wohl noch nicht gereist sein. Durch ein Kreuzverhör bekomme ich denn auch heraus, daß er aus der Landschaft Mambwe am Südende des Tanganyika stammt, und daß Kassanga mit unserm Bismarcksburg identisch ist. Nr. 11 ist mein ursprüngliches Ziel Kondoa-Irangi. Nr. 12 ist der in Iramba gelegene Unteroffizierposten Kalama. Bei Tobola, wie mein Kartograph Tabora nennt, geht er sogar auf Einzelheiten ein; Nr. 13a ist das Tabora von heute mit der neuen Boma; Nr. 13b das „Tobola ya samani“, das alte mit der Boma von früher. Nr. 14 und 15 sind Ujiji am Tanganyika und Muansa am Victoria-Nyansa; beide Handelsorte sind die Endpunkte der Reisen Sabateles nach Westen und Norden, wie er mir mit Stolz und Genugtuung erklärt.
Auch von den Leistungen seiner Gefährten abgesehen, steht die Routenkarte Sabateles unter den Naturvölkern nicht vereinzelt da; über deren kartographische Leistungen sind vielmehr bereits ganze Bücher geschrieben worden. Gleichwohl entbehrt die kleine, anspruchslose Skizze keineswegs eines gewissen wissenschaftlichen und völkerpsychologischen Interesses. Wir sind gewohnt, jedes Kartenblatt von Süden her zu schauen; der Norden liegt uns stets oben. Bei allen meinen Negerkarten ist die Orientierung umgekehrt; sie sehen das dargestellte Gebiet von Norden her und legen den Süden nach oben. Auch das hier wiedergegebene Blatt ist im Original nach Süden orientiert; lediglich, um es mit unsern Karten in Übereinstimmung zu bringen, habe ich es um 180° gewendet. Falsch sind die Ortsabstände; das ist aber in der Situation auch wohl der einzige Fehler; von ihm abgesehen, ist die Gesamtleistung für ein völlig unberührtes Naturkind erstaunlich gut.
Eine Kombination von Landschaftsmalerei und geographischem Sehen ist schließlich die letzte der hier wiedergegebenen Eingeborenenzeichnungen; sie ist gleichzeitig ein Stück Heimatskunst, denn Salim Matola hat in ihr die Berge seiner Heimat Massassi zur Darstellung gebracht (S. 87). Mir hat es nie gelingen wollen, die stolze Bergkette[S. 456] im Bilde festzuhalten; hatte ich auf meinen Rundtouren den nötigen Abstand erreicht, so konnte ich darauf wetten, daß die Luft unklar sein und jeden Fernblick verhindern würde; war ich aber im Schatten der Berge selbst, so fehlte der Gesamtüberblick. Salim hat also dem Mangel abgeholfen, und er hat das in nicht einmal übler Weise getan. Freilich, der schwarze Jäger oben auf dem Gipfel des Chironji ist in Anbetracht der reichlich 800 Meter Seehöhe des Berges ebenso unverhältnismäßig groß geraten wie sein Jagdgewehr; auch der Baumwuchs ist in der Größe — nicht im Charakter — mißglückt; aber sonst stimmt alles: die Reihenfolge Mkwera, Massassi, Mtandi und Chironji als Riesen; links davon dann Mkomahindo, Kitututu und Nambele als kleines Anhängsel. Gut ist auch die Steilheit der einzelnen Berge wiedergegeben; desgleichen die abgerundete Kuppenform; ja selbst die Struktur des Gneises glaubt man in den Strichen Salims wiederzuerkennen.
Es scheint, daß ich überall die ersten Regen nach mir ziehe: in Newala bereits zu Michaelis, in Nchichira einige Wochen später; hier in Mahuta haben sie zu Ende des Monats Oktober gleich mit ziemlicher Heftigkeit eingesetzt. Zum Glück habe ich vor ihrem Eintreten die Eingeborenen doch noch bis zum Übermaß genießen können. Es sind wahre Volksfeste im kleinen gewesen, die die Makonde auf dem großen, schönen Platz hier im Laufe der Wochen gefeiert haben; ganz zwanglos entwickelten sie sich und boten mir damit auch die Gewähr, etwas Ungekünsteltes, Echtes zu sehen zu bekommen. Mehr als einmal sind auch hier Stelzentänzer mit ihren Riesenschritten, dem starren Maskengesicht und wehenden Kleidern durch die Volksmenge gestapft. Allgemeinen Beifall hat eines Nachmittags eine wohlgelungene Affenmaske geerntet, die das Gebaren unseres differenzierten Vetters wirklich ganz trefflich und naturgetreu nachzuahmen verstand. Der Neger lacht gern, vielleicht weil er weiß, daß diese Reflexbewegung zu seinem prachtvollen Gebiß gut steht; bei den Kapriolen und Purzelbäumen dieses Mimikers waren indessen die dröhnenden[S. 457] Lachsalven sehr wohl begründet. Ein Meister in allerlei Scherz und Kurzweil war ferner ein Volksgenosse, der sozusagen alles konnte; eine mittelgroße, überaus sehnige, muskulöse Figur, war der Mann zunächst ein unübertrefflicher Parterreakrobat, der dreist in einem europäischen Zirkus auftreten könnte; er produzierte sich gleich darauf in gleicher Meisterschaft am schwebenden Reck — vier starke Männer trugen eine lange Stange, die ihm als Evolutionsachse dienen mußte —; ausgezeichnet war derselbe Mann schließlich als „dummer August“. Der ganzen Rassenveranlagung nach entsprang die Komik dieser Figur aber auch nicht etwa der Physiognomie, sondern trat vorwiegend in Haltung und Bewegung der Beine zutage; im Kino habe ich das alles für die Zukunft festgehalten. Um den Beweis seiner Universalität zu vollenden und lückenlos durchzuführen, trat derselbe Mann im zweiten Teil des Programms als Held in einer Pantomime auf. Es war ein Ehebruchsdrama, der Ehemann ein Tölpel und Dummkopf, die Frau, nach antikem Muster durch ein männliches Individuum dargestellt, eine schlaue Kokette, der Cicisbeo ein aus alle Verführungskünste geeichter Don Juan. Soweit die Grundlagen des Dramas; sie sind, wie man sieht, ganz kosmopolitisch; urecht afrikanisch war dafür die Natürlichkeit und Ungeniertheit, mit der sich alle, aber auch alle Vorgänge des Lebens auf der Bühne abspielten, ganz echt afrikanisch auch der unerschütterliche Ernst, mit dem das sichtlich aufs äußerste interessierte Publikum dem Fortschreiten der Handlung folgte; kein unzeitiges albernes Lachen, kein vorlauter Zwischenruf.

[S. 458]
Wer noch immer bezweifeln möchte, daß es mit der Ursprünglichkeit und Unberührtheit des Kulturbesitzes unserer Naturvölker rasch und immer rascher zu Ende geht, dem empfehle ich das Folgende zur Beachtung.

Es ist wiederum ein fröhlich belebter Nachmittag, Tänze, Gesang und Spiel ringsum. Ich habe alle Hände voll zu tun, plötzlich jedoch wird meine Aufmerksamkeit auf eine Gestalt hingelenkt,[S. 459] die eine besondere Tätigkeit für sich verfolgt. Rhythmisch pendeln die Unterarme aufwärts und abwärts, verlängert um halbmeterlange Holzstäbchen, die durch eine gedrehte Bastschnur miteinander verbunden sind. Plötzlich ein jähes Auseinanderspreizen der Arme in ihrer ganzen Länge, ein Hochstrecken des rechten, ein Seitwärtsspreizen des linken, wie eine Bombe saust ein zunächst noch unerkennbares Etwas aus der Luft herunter, wird geschickt auf der Schnur aufgefangen und läuft wie ein geängstigtes Wiesel zwischen den Stabenden hin und her; gleich darauf ist es wieder in den Lüften verschwunden, kehrt reuig zu seinem Herrn zurück, und so fort.
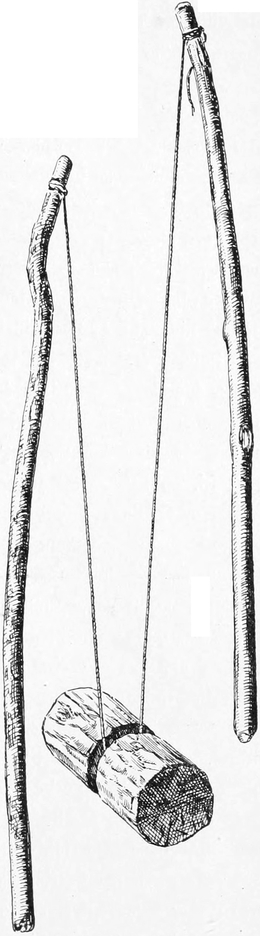
„Ei, das mußt du doch schon irgendwo gesehen haben“, fährt es mir durch den Sinn; ich grüble und grüble, endlich habe ich es: das ist ja nichts anderes als das Diabolo, von dem die deutschen Zeitungen erzählen, daß es in England und andern Ländern des Sports so eifrig betrieben werde! Bei uns im langsam, aber sicher nachhinkenden Deutschland war das Spiel bei meiner Abreise noch unbekannt; ich stelle jedoch die Prognose, daß es dort dereinst zu blühen anfangen wird, wenn die andern Nationen es längst zu dem Alten gelegt haben. Jetzt fällt mir[S. 460] auch ein, in einem Laden der Grimmaischen Straße zu Leipzig einmal ein Bild des Spiels gesehen zu haben; vergleiche ich mit diesem Erinnerungsbilde den vom Neger mit so großer Sicherheit geschleuderten Wurfkörper, so muß ich gestehen, der Mann hat das technische Problem ausgezeichnet gelöst: der schmale, scharfe Keilschnitt in dem Zylindermantel der Holzwalze gibt der Schnur vollkommenen Bewegungsraum, ohne das Gewicht des Ganzen wesentlich zu vermindern. So weit hat mein stets reges technisches Interesse mich ernst erhalten, jetzt aber lächle ich doch unwillkürlich; als Träger der höchsten Kultur das neueste Symbol ebendieser Kultur gerade von einem unbeleckten Wilden im entlegenen afrikanischen Busch kennen lernen zu müssen, ist das nicht ein Treppenwitz der Kulturgeschichte!
Wüßte ich nicht, daß der Regen die einzige Ursache für das immer spärlichere Erscheinen der Eingeborenen ist, so hätte ich auch hier allen Anlaß, mich wieder für einen mächtigen Zauberer zu halten; so aber sagen die Leute selbst, daß es nunmehr an der Zeit sei, an ihre Felder zu denken. Ehrlich gestanden, ist die daraus erwachsende Muße mir durchaus nicht unlieb, ich bin wirklich satt, übersatt sogar und habe schon mehrfach an mir beobachtet, daß ich an den fesselndsten Erscheinungen des Volkslebens mit Gleichgültigkeit vorübergegangen bin. Die menschliche Aufnahmefähigkeit ist nun einmal nicht unbegrenzt, und wenn man so viel an neuen Eindrücken auf sich hat einstürmen lassen müssen wie ich, versagt sie schließlich einmal völlig.

Nur Ningachi und seine Schule fesseln mich immer wieder von neuem. Unsere Barasa ist auf der Südseite der Boma, von Osten her gerechnet, das zweite Haus. Im ersten hausen angeblich ein paar Baharia, in Wirklichkeit scheint es ein großer Harem zu sein, denn fast ohne Unterlaß hört man ein vielstimmiges Kichern und Schwatzen weiblicher Stimmen; im dritten Haus wohnt Seine Exzellenz der Staatssekretär des Vizekönigs, nämlich der amtlich bestellte Schreiber des Wali. Er ist ein Suaheli aus Daressalam[S. 461] und ein Busenfreund von Moritz obendrein, aber diese Freundschaft mit der Säule meiner ruhelosen Wanderwirtschaft hat es durchaus nicht verhindert, daß ich dem Burschen jüngst die Ohren sehr lang gezogen habe. Keine Nacht hatte ich ordentlich schlafen können, denn von irgendwo, aber ganz nahe, ertönte unausgesetzt ein jämmerliches Kindergeschrei. Bald habe ich es herausgehabt und habe Vater, Mutter und Sohn in meine Sprechstunde zitiert: Vater und Mutter kerngesund und speckfett, das Kind reichlich ein Jahr, ebenfalls kugelrund, doch wund und angefressen infolge ärgster Verwahrlosung von der Zehe bis zum Auge. Und der Mann kann lesen und schreiben, er ist also ein vollwichtiger Vertreter der Kulturwelt im Sinne der Statistik und schaut mit abgrundtiefer Verachtung auf jeden herab, der nicht wie er im weißen Hemd und mit gestickter Mütze einherfaulenzt.
Doch nun das vierte Haus. Verständnislos sehe ich am ersten Tage nach unserer Ankunft um 6½ Uhr morgens eine Schar von sechs bis acht halbwüchsigen Knaben sich vor ihm versammeln. „Die wollen spielen“, denke ich noch so, da treten sie auch schon der Größe nach hintereinander an, ein Erwachsener im weißen Hemd tritt zu ihnen, macht ein Zeichen, und im Gänsemarsch verschwinden alle unter dem niedrigen Strohdach. Unmittelbar darauf erfolgt etwas, was für Afrika an[S. 462] sich nicht gerade merkwürdig ist, mich aber aus mir noch unerklärlichen Gründen veranlaßt, langsam näherzutreten: eine tiefe Solostimme spricht etwas vor, im hohen Diskant antwortet der Chor. Unbewußt bin ich auf wenige Schritte an das Haus herangerückt: „Herrgott, das sind ja deutsche Laute!“ „Und das ist ains“, hebt es gerade von vorne an; „und das ist ains“, ertönt es klar und hell zurück. „Und das ist swai“ — „und das ist swai“; „und das ist drai“ — „und das ist drai.“ Sehr geistvoll mag mein Gesicht in diesem Augenblick sicherlich nicht gewesen sein: die Askari exerzieren deutsch, Lehrer und Jugend sprechen deutsch — wir müssen doch wohl ein tüchtiges Volk von Kolonisatoren sein.
Ich bin an jenem denkwürdigen Morgen aus begreiflicher Diskretion nicht näher herangetreten. Seitdem weiß ich aus vielmorgiger eigener Erfahrung, daß Ningachi sich nicht nur auf die Zahlenreihe allein beschränkt, sondern daß er keck und kühn sogar subtrahiert und addiert. Aber der Eindruck, daß diese Unterrichtsmethode bei Lehrer und Schülern in gleicher Weise die reinste Dressur und Abrichtung ist, hat sich bei mir von Tag zu Tag nur bestärkt. Zunächst liegt Ningachis Zahlengrenze bereits bei der Zahl 31 — Ningachi spricht das wie ein Halberstädter ganz breit ainunddraißig —, sodann aber sind seine Zöglinge sofort in Verlegenheit, sobald sie in der langen Zahlenreihe, die der Herr Lehrer säuberlich an die große Wandtafel geschrieben hat, eine Ziffer außer der Reihe und selbständig heraussuchen sollen. Und nun die Exempel erst! „Swai weniger acht ist sechs“ ist noch ein harmloser Fehler. Ningachi fühlt sich denn auch nicht weniger als behaglich bei diesem Lehrprogramm, aber er habe es in der Regierungsschule von Mikindani einmal so gelernt und müsse nun auch so unterrichten. Es hat den ehrlichen Burschen nur wenig getröstet, als ich ihm sagte, es gebe auch anderswo Dressieranstalten.
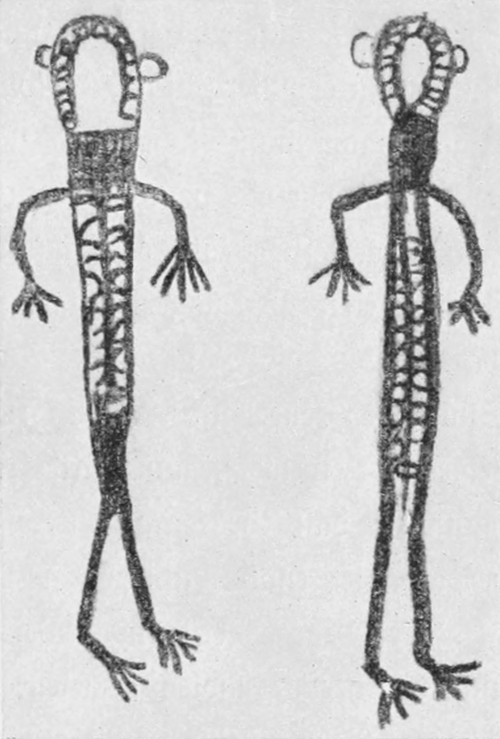
Mit der Aufnahme des Kimakonde bin ich in geradezu erstaunlich kurzer Zeit fertig geworden. Wie ein Deus ex machina erschien plötzlich die Perle Sefu von Newala; im Bunde mit ihm und[S. 463] Ningachi habe ich mich dann in sieben allerdings sehr strammen Tagewerken davon überzeugen können, daß das Kimakonde sich aufs engste den benachbarten Idiomen anschließt und daß lediglich das Fehlen des „S“ der Anlaß gewesen sein mag, wenn andere Autoren es oftmals als vom Kisuaheli und Kiyao sehr abweichend bezeichnet haben. Dieses Fehlen des S aber, davon bin ich fest überzeugt, hängt aufs innigste mit dem Tragen des Lippenpflocks in der Oberlippe zusammen; jeder von uns hat wohl schon einmal eine dickgeschwollene Lippe gehabt, hat er da irgendwelche Laute der S-Gruppe hervorbringen können? Allerdings setzt diese Theorie voraus, daß dann auch die Männer ursprünglich dieselbe Lippenzier besessen haben müssen. Aber warum soll das nicht der Fall gewesen sein? Die Maviamänner sollen sie ja noch heute tragen; die Mavia aber gelten als die engsten Verwandten der Makonde.
Nur mit dem Kimuera habe ich kein Glück gehabt. Den Plan, in das Gebiet jenes Stammes noch einmal zu längerem Aufenthalt zurückzukehren, habe ich zu keiner Zeit aus den Augen verloren. Jetzt kommt der Wali, es kommen Sefu und andere einsichtige Männer vom Plateau und sagen mir:
„Zu den Wamuera, Herr, kannst du unter keinen Umständen; siehe, diese Leute haben mit den Deutschen Krieg gemacht, sie haben dann während der ganzen Bestellzeit im Busch gesessen und haben nichts säen können; das wenige, was sie verborgen hatten, ist längst[S. 464] aufgegessen, und nun haben sie gar nichts mehr; alle leiden schrecklichen Hunger und viele sterben.“
Ich habe daraufhin die Möglichkeit erwogen, mit hier aufgekauften Vorräten aufs Rondoplateau zu ziehen, doch auch davon hat man mir sehr ernstlich abgeraten; die Leute würden sich in ihrer Verzweiflung auf uns stürzen und um das Getreide mit uns kämpfen. Nun, wenn der Berg nicht zu Mohammed kommt, habe ich mir schließlich gesagt, dann muß Mohammed zum Berge gehen; wenige Tage später erschienen, von ein paar Eilboten geholt, die angeblich gelehrtesten aller Wamuera. Zwei ältere Männer waren es, aber wie sahen sie aus! Zum Skelett abgemagert, ohne eine Spur von Waden oder sonstiger Muskulatur, die Wangen und Augen eingefallen, kurz, die wandelnden Sinnbilder jener furchtbaren Hungersnot. Geduldig haben wir die beiden erst ein wenig aufgefüttert; sie schlangen so erhebliche Quantitäten hinunter, daß ihr Magen wie eine dicke Kegelkugel aus dem Leibe hervorragte; endlich schienen sie „vernehmungsfähig“.
Trotz ihrer gerühmten Weisheit ist aus Machigo und Machunja nicht viel herauszuholen gewesen: ein paar Dutzend Sippennamen, eine längere Reihe einfachster Wortbegriffe, das war alles. Jeder Versuch, Verbalformen oder irgendwelche Geheimnisse der Syntax mit ihrer Hilfe festzulegen, schlug gänzlich fehl. Nicht mangelnde Intelligenz mag die Ursache sein, sondern fehlende Schulung des Geistes; wollte jemand mit Hilfe eines Ochsenknechts den Bau der deutschen Sprache ergründen, ihm würde es nicht anders ergehen als mir. Ohne Groll, im Gegenteil, sogar reich beschenkt, habe ich die beiden Greise nach kurzer Zeit entlassen; im Bewußtsein ihres so unvermutet erworbenen Reichtums sind sie nicht schlecht ausgeschritten, als sie den Weg nach Norden einschlugen.

Mit dem Abmarsch der beiden mageren Kimueraprofessoren bin ich im Grunde genommen auch meine letzte wissenschaftliche Sorge los geworden, und das ist gut so, ich bin wirklich übersatt. Was habe ich auch in den verflossenen Monaten alles geschafft! Die mehr[S. 465] als 1200 photographischen Aufnahmen wird der dieser Kunst Fernstehende kaum rechnen wollen, photographieren ist ja doch ein Vergnügen; nur der Kenner weiß, welch eine Unsumme von Arbeit und Aufregung mit einer solchen Riesenzahl in Wirklichkeit verknüpft ist. Und zudem gerade hier. Auf einige Schwierigkeiten habe ich früher bereits hingewiesen; sie sind im Laufe der Zeit immer größer geworden, denn immer mehr ist die Sonne an unseren Breitenkreis herangerückt, und ganz fabelhafte Lichtmassen sind es, die sie von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags vom Firmament herniedersendet. Ich habe über alle Wetter- und Lichtumstände in meinem Negativregister stets ganz genau Buch geführt, aber gleichwohl bin ich von Mißerfolgen nicht verschont geblieben, so schwer beurteilbar ist die Intensität des Tropenlichts. Mit Freude und Genugtuung stellt man abends beim Probeentwickeln fest, daß man heute Glück gehabt hat, alles ist richtig exponiert; am nächsten Tage ist das Wetter genau so, folglich nimmt man dieselben Blenden, dieselbe Expositionszeit; aber siehe da, am Abend zeigt sich alles zu kurz oder zu lang belichtet. Fröhlicher wird man nicht dadurch. Und dann die immer wiederkehrende Sorge um den Hintergrund; Isolarplatten habe ich leider gar nicht mit; zu einem Teil ersetzt diesen Mangel ein ungeheures Persenning, ein Segeltuch, das ich ursprünglich zum Bedecken meiner Lasten während der Nacht mitgenommen habe. Diesem Zweck hat es nie gedient; schon in Massassi haben wir es zwischen zwei lange Bambusstangen geknüpft und auf einer Seite mit ein paar Bahnen Sanda überzogen, und seitdem dient es mir bei allen Aufnahmen unter hohem Sonnenstande als Rückendeckung gegen starkbelichteten Hintergrund. Und wenn es gar nicht anders geht, dann halten meine starken Männer den Rahmen auch einmal schützend über das Objekt, falls es gilt, in senkrechter Mittagssonne etwas ganz Bemerkenswertes auf die Platte zu bannen.
Zu den Platten treten die Phonographenwalzen. Die abnormen Wärmeverhältnisse der tiefer gelegenen Gegenden haben mich mancher[S. 466] guten Gelegenheit zu wertvollen Aufnahmen beraubt, aber das muß man mit philosophischer Würde zu tragen wissen. Ich kann das um so mehr, als ich von meinen fünf Dutzend Walzen trotz jener Übelstände nur noch wenige zur Verfügung habe, und auch für die weiß ich eine wundervolle Verwendung: schon morgen werden sie mit den schönsten Wanyamwesiweisen bedeckt sein. Gefaßt trage ich auch mein Kinoschicksal. In bezug auf diese modernste ethnographische Forschungsmethode bin ich Pionier; ich muß alle Unvollkommenheiten einer erst im Werden begriffenen Industrie ausbaden, desgleichen auch alle Gefahren der Tropen für die Gelatinefilms in Kauf nehmen. Nun stimmt es mich zwar nicht heiter, wenn Ernemann mir aus Dresden schreibt, auch die letzte Filmsendung sei wieder schlecht, doch ärgere ich mich nicht mehr, seitdem jener verhängnisvolle Fall meines 9 × 12-Apparates mir das fürchterliche Fieber eingetragen hat. Durch eigene Probeentwicklung weiß ich zudem, daß von meinen 38 kinematographischen Aufnahmen immerhin noch gegen zwei Drittel brauchbar oder sogar gut ausgefallen sein muß; das ist für den Anfang gerade genügend. Mehr als 20 solcher unvergänglichen Dokumente eines rasch verschwindenden Volkslebens — ich gratuliere mir selbst.
Indes mein Hauptstolz gründet sich auf die Fülle und noch mehr auf den Inhalt meiner ethnologischen Aufzeichnungen. Als Fremder im Lande und in einer so kurzen Zeit habe ich selbstverständlich bei weitem nicht alle Gebiete des Eingeborenenlebens ins Auge zu fassen vermocht, doch habe ich ihrer eine ganze Reihe zum Gegenstand eines eindringlichen Studiums gemacht. Und dann mein guter Stern in bezug auf das Unyago; die Aufhellung dieser Mysterien allein hätte die Reise vollauf gelohnt.
Auch meine soziologischen Ergebnisse gereichen mir selbst zu hoher Freude; für unsere Kenntnis des ostafrikanischen Negers werden sie gleichzeitig ein sicherlich nicht ganz wertloser Beitrag sein.
Zum Schluß die ethnographische Sammlung. Im Kongobecken und in Westafrika hätte ich in einer gleich langen Expedition ohne[S. 467] jede Schwierigkeit vermutlich eine kleine Schiffsladung zusammenzutragen vermocht, hier im Osten stellt eine Sammlung von noch nicht 2000 Nummern bereits den Inbegriff des Kulturbesitzes einer ganzen Völkerprovinz dar. Freilich, die Stückzahl hätte sich mühelos noch vergrößern lassen, die Zahl der Besitzkategorien kaum, so gründlich habe ich die Negerdörfer abgesucht und die einzelnen Hütten durchstöbert; der Ostafrikaner ist nun einmal ein armer Mann.
Doch was frommt das Grübeln über Erreichtes und Unerreichbares! Siehe, wie schön die Sonne lacht, wie frisch der nahe Wald nach dem Regen grünt und wie malerisch die Gruppe jener Askari sich dort von der Palisadenwand abhebt!
„Wie, das sind Askari, deutsche Krieger, diese Gestalten mit dem schlecht gewundenen Turban um das Haupt und dem lächerlichen Nachthemd am Leib?“

Auch ich habe mich höchlich über die Metamorphose gewundert, die unser schwarzer Krieger im Laufe des Tages mit sich vornimmt. Auf dem Exerzierplatz schneidig und stramm — dem Neger ist der Drill ein Spiel, er nennt ihn ganz wie wir „Soldatenspielen“ —, ist er am Nachmittag das gerade Gegenteil, wenigstens nach unseren deutschen[S. 468] Begriffen. O, macht er sich’s da bequem! Zweierlei Tuch zieht auch in Afrika; wohin es kommt, da stehen seinem Träger sofort die besten Bettstellen zur Verfügung. Auf ihnen räkelt sich der brave Lumbwula stundenlang herum, daß die Kitanda nur so kracht; kein Glied rührt der Faule; er hat es auch nicht nötig, denn sein Boy sorgt für ihn, wie er es sich gar nicht besser wünschen kann; sogar das Gewehr nimmt er dem müden Herrn aus der Hand, wenn Hemedi Marangas klares Organ endlich, endlich das langersehnte Kommando: „Wegtreten!“ herausgeschmettert hat. Doch nun will es Abend werden, da wird es Zeit, sich den Schönen des Landes zu zeigen. So hübsch wie in Lindi sind die Mädchen nicht, die weißen Holzstücke in der Lippe sind gar nicht so nett wie das zierliche Chipini im Näschen seiner Valide daheim; aber was tut’s: „Andere Städtchen, andere Mädchen.“ Merkwürdig rasch ist die Toilette vollendet; der Turban sitzt freilich nicht so, wie es der Würde seines Herrn entspricht, aber Hassani, der Boy, ist noch gar zu ungeschickt. Es schadet auch weiter nichts, das Kansu macht alles wieder wett; ganz neu ist es noch und auch ganz anders als die Gewänder der albernen Suaheli; deren Hemd ist zwar bestickt, aber ist auch nur eins von ihnen mit einem so schön verlängerten Hinterteil versehen wie seines? Und nun drüben der Nubier Achmed Mohammed gar: er hat nicht einmal ein Beinkleid; sein Hemd ist hinten auch hübsch lang, aber es muß schmutzig und zerrissen sein, denn der Mann trägt sogar beim Spazierengehen seine Khakijacke. Na, überhaupt diese Nubier; sie sind doch ganz andere Menschen als wir Wakhutu, immer ernst und gar nicht so vergnügt.
Meine Entlastung von allen Sorgen und Nöten der Arbeit tut physiologisch wahre Wunder: wie ein Bär schlafe ich in meinem Bett, schlage bei Tisch eine gewaltige Klinge und nehme an Umfang von Tag zu Tag fast merkbar zu. Es geht uns auch seit einiger Zeit wieder gut; der ersten Porterkiste ist eine zweite gefolgt, und mit ihr sind auch noch andere Herrlichkeiten aus Lindi heraufgekommen: echte, unverfälschte Milch aus dem gesegneten Lande Mecklenburg,[S. 469] frischer Pumpernickel, Kartoffeln neuester Ernte aus Britisch-Ostafrika, Fleisch und Fruchtkonserven in Fülle. Ei, da lebt es sich bene, vergessen sind die mageren Wochen von Newala, in nebelgrauer Ferne verschwindet das nicht viel üppigere Chingulungulu. Und nun gar die Abende! Ein gütiges Geschick will es, daß ich wohl noch Platten, aber keinen Entwickler und kein Fixiersalz mehr habe. So kann ich noch nach Herzenslust photographieren, bin aber des grausamen Entwicklungsprozesses im Zelt überhoben. Omari hat zum abendlichen Tisch ein nach neuer Methode geröstetes Huhn geliefert; es nimmt sich auf der Schüssel kurios aus; ganz breit auseinandergebogen liegen die beiden Körperhälften da, aber sie duften kräftig, sehen knusprig aus und schmecken prächtig. Es ist der Urröstprozeß der werdenden Menschheit, den der Mann aus Bondei hier aufgefrischt hat: ein einfaches Halten des Fleisches über das Feuer, bis es dem Gaumen genießbar erscheint. Nur eine einzige Neuerung hat das alte Verfahren über sich ergehen lassen müssen: Omari hat den Tierleib erst mit Salz und Pfeffer eingerieben; das ist kulturgeschichtlich nicht stilgerecht, doch die Freveltat soll dem Koch verziehen werden, denn diese Zutat verleiht dem Braten erst die rechte Würze.
Und nun kommen auch sie heran, die Herren Träger; alle Mann hoch quellen sie aus ihrem Unterschlupf hervor, den sie unter dem weitausladenden Strohdach eines der Bomahäuser gefunden haben. Reingewaschen sind ihre Kleider, und freudig strahlen die braunen Gesichter, denn sie wissen, daß es in den nächsten Tagen schon auf Safari geht, diesmal endlich der Küste zu, auf die sie sich schon so lange gefreut. Sie werden aber auch unfaßbar viel Geld bekommen dort in Lindi. Oft sind sie dem Bwana kubwa ganz böse gewesen, weil er ihnen gar keinen Vorschuß geben wollte, und es wäre doch so nett gewesen, wenn man dem hübschen Mädchen dort im Nachbardorfe einmal hätte etwas schenken können. Sie hat den Wunsch sogar direkt ausgesprochen, aber der Bwana Pufesa hat stets gesagt: „Nenda sako, scher dich deiner Wege“, wenn man bei ihm borgen wollte. Das ist[S. 470] hart von ihm gewesen, aber jetzt ist es doch gut, denn nun bekommen wir ja das viele Geld auf einmal ausgezahlt; mehr als 40 Rupien müssen es sein. Wird das eine Lust geben da unten in Lindi! Und dann in Daressalam erst! Und zum Inder werden wir gehen und eine Weste werden wir uns kaufen, schöner als sie selbst die Suaheli tragen, diese Affen!
Von dem leuchtenden Abendrot, das mir in Mahuta jeden Abend verschönt hat, steht nur noch ein schwachleuchtender Schimmer am westlichen Horizont; dafür ist hinter jenem breitästigen Baum, unter dem ich das halbe Makondeplateau im Laufe der Wochen auf meine Platten gebannt habe, in wunderbarer Leuchtkraft der Vollmond emporgestiegen. Sein Antlitz schaut mit behäbigem Lächeln auf eine seltsame Gruppe herab: im bequemen Liegestuhl streckt sich das gelbröckige Blaßgesicht; es muß anderen Glaubens sein als sonst die Leute in diesem Erdteil hier, denn mächtige Rauchwolken sendet es als Opfer zu Mulungu, dem Schöpfer alles Irdischen, hinauf. Auch sein Pombeopfer ist anders geartet als das der schwarzen Leute; zwar hat auch er einen großen Krug dort stehen, doch nicht in den hinein schüttet er den braunen Trank, sondern immer in den eigenen Mund. Und auch sonst ist er nicht wie die Afrikaner; er scheint stumm, den ganzen langen Abend hindurch hat er noch nicht ein Wort gesprochen. Dafür ist das Kelele, das Geschrei der schwarzen Leute um ihn herum, um so größer und lauter. Warum er das bloß duldet, der weiße Mann? Warum schickt er die lästigen Gesellen nicht weg? Aber vielleicht hat er auch darüber seine besonderen Ansichten und nennt dieses Geschrei sogar Musik? So sind sie nun einmal, diese Weißen! Diese merkwürdigen Geschöpfe begreife überhaupt wer kann. Ihr Land liegt weit weg von hier, dort, wo die Strahlen des Mondes schon ganz schräg auf die Erde treffen. Kalt ist es dort und unbehaglich; manchmal ist die Erde sogar ganz weiß. Dennoch muß man staunen, warum ihrer so viele gerade hier zu den albernen Schwarzen kommen. Blieben sie doch daheim bei ihren Lieben!
[S. 471]

Mit den tiefen Tönen, wie sie den Wanyamwesi eigen sind, dringt das Lied in das Ohr des Europäers. Es stellt einen wundervollen Beitrag zu dem Kapitel: Rhythmus und Arbeit dar. Wie oft haben es meine Leute schon in Newala, bei Madyaliwa und hier in[S. 472] Mahuta gesungen, stets aber war der Rhythmus des Gesanges begleitet von ebenso rhythmischen Körperbewegungen. Ein Hacklied ist es. Zieht der Muyamwesi mit seinem Universalinstrument, der Hacke, aufs Feld, dann ist er gerüstet mit einem ganzen Arsenal solcher Lieder; taktmäßig hebt und senkt sich der Oberkörper, knirschend fährt das breite Eisen durch den Boden dahin, weich und harmonisch klingt über die weite Ebene das Arbeitslied. In diesem Augenblick, wo die Leute malerisch um mich gruppiert kauern, enthalten sie sich dieser Hackbewegung zugunsten eines mit großer Verve geübten Schnalzens mit den Fingern.
Die Melodie ist ansprechend und einschmeichelnd; in seinen Träumen der rauhen Natur Afrikas weit entrückt, blickt der fremde Mann sinnend in den Nachthimmel hinauf. Im Drang der arbeitsschweren Zeit, die nunmehr hinter ihm liegt, hat er kaum Zeit gefunden, an das alte Uleia und seine Kultur zurückzudenken; jetzt, wo des Vorsängers Pesa mbili klarer Bariton periodisch mit dem machtvollen Chor wechselt, da ziehen ihm in bunter Reihe die Kulturbilder gleicher Art von daheim durch den Sinn: wie des Grobschmieds nervige Faust am Amboß den Rhythmus sucht, um beim Schwingen des wuchtigen Hammers nicht allzu rasch zu ermüden. Aus ferner Jugendzeit, wo die garbenfressende Dreschmaschine noch nicht zur Errungenschaft des kleinen Landwirts zählte, hört er von des Nachbars Tenne her den Drei- und Viertakt der Drescher. Ping ping ping, ping ping ping, zum Greifen nah hat er es vor sich, das typische Bild der Großstadtstraße; die Zigarre im Munde, sind die Herren Pflasterer mitten im Strome des Verkehrs aufmarschiert. Das heißt, dieses halbe Dutzend Männer hat mit dem Setzen des Steines selbst nichts zu tun, sie sind die Elite, die mit der schweren Handramme in kunstgerechtem Stoß und Schlag Stein für Stein im einzelnen und dann auch noch das Ganze, nur roh Vorgearbeitete, nachfeilen müssen. Ping ping ping, ping ping ping, bald anschwellend zum gewaltigen Forte, dann wieder herabsinkend bis zum feinen Tone des silbernen Glöckchens, mischen sich die Töne in den Straßenlärm hinein. Mit Riesenkraft hat der Hüne dort[S. 473] das Eisen soeben auf einen neu in Angriff genommenen Stein herunterkrachen lassen, kaum zentimeterhoch hebt und senkt sein Nachbar das Werkzeug; und alles geschieht im strengsten Takt: Ping ping ping, ping ping ping. Das ist es ja eben: dieser Takt ist der Ausfluß eines Naturbedürfnisses im Menschen, er ist der Vorläufer, ja die Vorbedingung jeder körperlichen Dauerarbeit überhaupt. Das empfinden auch wir Träger einer alten Kultur noch immer: ganz einerlei, ob wir im Trupp dahinmarschieren; ob das Einsetzen der Regimentskapelle die Beine der müden Soldaten zu neuem, frischem Ausschreiten elektrisiert; ob wir gemeinsam eine schwere Last von ihrem Standort zu bewegen suchen, Takt und Rhythmus begleiten und beleben uns in allen Lebenslagen. Und nun der Naturmensch erst! Ich glaube, der Neger kann nicht das Geringste ausführen, ohne seine Arbeit mit einem schnell improvisierten Liede zu begleiten; selbst die schwerstgefesselten Kettengefangenen der Küste schieben ihre Karre oder ziehen den Wagen unter stetem Wechselgesang. So ist denn auch das Hacken des Feldes eigentlich mehr ein Spiel, zu dem der Körper ganz von selbst in die rhythmische Bewegung des Tanzens verfällt; kein Tanz aber ohne Lied.
Mit einem langgezogenen „Kweli, es ist wahr“, ist das Lied soeben ausgeklungen. Die Wanyamwesi haben Ausdauer, auf dem Marsch wie beim Singen, und so hat auch dieser Wechselsang eine geraume Zeit gefüllt. Der Weiße regt sich; er greift zum neuen Rauchkraut, aus dem Chor der Schwarzen aber erklingt im gleichen Augenblick das unverkennbare Organ des unermüdlichen Pesa mbili; gleich darauf fällt mit sonorem Ton der Chor der anderen ein. Es ist mein Lieblingslied, das jetzt in die schweigende Nacht und den leise rauschenden Makondebusch hinaus erklingt; es muß wohl etwas Gutes sein, denn selbst der alte Herr dort oben, der höher und immer höher geklommen ist auf seiner Bahn, schmunzelt mit unverkennbarem Behagen auf die malerische Gruppe herunter. Aus deren Mitte erschallt es jetzt, erst leise, dann in vollem Chor wie folgt:
[S. 474]
Kulya mapunda.

Die ansprechenden Töne haben auch jetzt wieder ihren Zauber auf den weißen Mann ausgeübt; hoch aufgerichtet sitzt er da, und kräftig singt er mit, zum nicht geringen Vergnügen der Herren Schwarzen. Ein Tanzlied ist es, dieses „Hasimpo“, wie es bei uns der[S. 475] Einfachheit halber kurz genannt wird. Bei dem Arbeitslied passen Melodie und Text, soweit ich diesen überhaupt habe übersetzen können, wenigstens noch einigermaßen zusammen; was mir Pesa mbili heute nachmittag jedoch als Grundlage dieses Hasimpo-Liedes in die Feder diktiert hat, will mir noch nicht so recht in den Kopf. Der Vollständigkeit halber hier zunächst der Versuch der Hilala-Übersetzung:
„Arbeit, Arbeit. Der Jumbe wird weinen über seinen Sohn. Wir lieben den weißen Ombascha, der ist stark. Danke. Der Sohn, er hat wahrgesagt. O ich Dummer, meine Mutter geht weg, die Kinder weinen. Weinet nicht, weinet nicht, weinet nicht.“
Also kraus wie immer, aber doch wenigstens in einzelnen Teilen Zusammenhang und Sinn; das sílilo, sílilo, sílilo, weinet nicht, weinet nicht, weinet nicht, klingt direkt ergreifend; weniger will mir der Ombascha, der weiße Gefreite, in den Rahmen des Liedes passen; doch wer vermag die Tiefen einer Negerseele zu ergründen! Und noch dazu die eines Poeten.
Das Tanzlied heißt:
„Es essen Gemüse die Wairamba, sage ich, sie essen Gemüse, sage ich, am Brunnen. Wenn ihr heim kommt, so grüßt sie, meine Mutter, und sagt: Wir kommen. So sagte ich, und die Polizei hat den Satanas gefaßt. Wir ließen nieder unsere Lasten von Zeug und Perlen und nochmals Perlen. Die Sonne, die geht unter; unsere Tanzerlaubnis ist zu Ende.“
Rührend ist auch hier wieder das Hereinziehen der Mutter, rätselhaft die Polizei und ihre Beschäftigung mit dem Höllenfürsten.
Und nun kommt das Standardlied:

[S. 476]
Es ist die Apotheose des Reisens an sich, also des Lebenselementes, das dem Mnyamwesi ebenso Bedürfnis ist wie sein Ugali: „O du Reise, du Reise mit dem großen Herrn, du (schöne) Reise. Die Jünglinge bekommen Zeug von ihm; o du Reise, du schöne Reise!“
Lang, fast klagend sind die tiefen Baßtöne verklungen; die vordem so glänzenden Augen meiner zwei Dutzend Getreuen sind immer kleiner geworden; es geht bereits stark auf zehn, und das ist eine Stunde, in der die Söhne Unyamwesis, in ihre dünne Matte gerollt, sonst längst von ihrer Heimat träumen. Ein fragender Blick von Pesa mbili herüber, ein kurzer Wink, im nächsten Augenblick ist die ganze Schar fast unhörbar verschwunden. Der Mond hat sich hinter einer dichten Wolke versteckt, bleich schimmern die weißen Gewänder meiner Braven noch einmal von ihrer Hütte herüber, dann bin ich allein. Wirklich allein, denn Knudsen ist wieder nicht zu halten gewesen und liegt schon seit einigen Tagen drunten im Tal der Jagd ob. Es seien gar zu viele Elefanten drunten, haben ihm die Leute von dort übermittelt, und da ist er im Sturmschritt von dannen gezogen; kaum daß sein Koch Latu und sein Diener Wanduwandu, dieser prächtige Yaorecke, ihm haben folgen können. Wo er nur bleibt? Er wollte doch schon heute mittag zurückkehren.
[S. 477]

Lindi, ausgangs November 1906.
Mein Feldbett in allen Ehren, aber auf dem meterbreiten, von einem geräumigen Moskitonetz überspannten Lager, auf das mich das kaiserliche Bezirksamt bettet, schläft es sich doch weit behaglicher und schöner. Seit rund einer Woche wird mir dieser Genuß von neuem zuteil; am 17. November bin ich nach sehr strammen, anstrengenden Märschen hoch zu Maultier mit fliegender Fahne in Lindi eingezogen.
Äußerlich ist das Städtchen ganz das alte geblieben. Im ewigen Wechsel rauschen die blauen Fluten des Meeres vom offenen Ozean her den Lukuledi aufwärts, das weitverzweigte Ästuar bis in die fernsten Krieks hinein füllend; sechs Stunden später strömt all dieses Wasser wieder zurück, dem Osten zu; es ist wie ein ruhiges Atmen des Meerriesen. Gleichmäßig und leise rauschen auch die Palmen über den niederen Hütten der Schwarzen, den winkeligen, schmutzigen Anwesen der Inder und den wenigen Häusern der Europäer. Unter diesen haben die verflossenen Monate bedeutende Veränderungen mit sich gebracht. Von den alten Säulen des Deutschtums hier im äußersten Süden ist fast niemand mehr vorhanden; dafür sind neue Landsleute eingetroffen,[S. 478] und zwar gleich so viel, daß es fast schwer hält, eine Wohnung zu bekommen. Wären wir in einer englischen Kolonie, so würden wir sagen, in Lindi herrscht ein „Boom“; so sagen wir weniger drastisch: das Kapital hat den Süden entdeckt und beginnt ihn wirtschaftlich zu erschließen; alles gute Land soll dem Vernehmen nach schon in festen Händen sein, so daß die Nachkömmlinge wohl oder übel schon zu weiter im Innern gelegenen Geländen werden greifen müssen. Ich persönlich freue mich über diesen Aufschwung des mir liebgewordenen Südens, im übrigen habe ich jedoch genug mit meinen eigenen Angelegenheiten zu tun.
Zunächst das Ablohnen der zahlreichen Hilfsträger, die ich für den Transport der vielen in Mahuta zusammengebrachten Sammlungsgegenstände hatte dingen müssen. Es sind geringe Beträge gewesen, denn ihre Empfänger hatten nicht übermäßig viel zu leisten gehabt. Im ganzen Bereich des Makondeplateaus war es Regel gewesen, daß die am Morgen beim Abmarsch eingestellten Träger zwar bis zum Tagesziel mitmarschiert waren, daß aber am nächsten Morgen regelmäßig von ihnen nichts mehr zu sehen war; trotz des Postens, der das Lager umkreiste, waren die schwarzen Gestalten in der dunkeln Tropennacht unbemerkt entwichen. Mir hat diese Unzuverlässigkeit viel Ärger und Verdruß und natürlich auch Zeitverlust gebracht, da ich stets erst neue Leute suchen lassen mußte; andererseits habe ich unter diesen Umständen auch keinerlei Gelegenheit gefunden, den Deserteuren den ihnen zustehenden Tageslohn auszuzahlen. Erst vom Yaogebiet im Kiherutal an ist es besser geworden; die Leute von dort sind willig mitgegangen.
Meine Träger sind bereits am 23. von hier abgereist. Auf der Reede von Lindi, dort drüben dicht unter dem steilen Bergeshang, lag ein schönes, großes Schiff, viel größer als die Nußschale von ehedem, auf dem die Landratten von Unyamwesi so schreckliche Tage hatten durchmachen müssen. Auf dieses stolze Schiff habe ich die zwei Dutzend Getreuen gesetzt, und dann sind sie von neuem gen[S. 479] Norden gefahren, in ihren Träumen wohl die Rückkehr nach der Heimat planend, um das viele Geld, das jeder von ihnen sorgsam in das Hüfttuch geknotet bei sich trug, verständig anzulegen, in Wirklichkeit aber wohl, um schon am Tage nach der Ankunft im „Hafen des Friedens“, mit der schweren Safarikiste bepackt, in der Expedition irgendeines andern Weißen nach einer entlegenen Gegend der riesigen Kolonie auf sandiger Barrabarra dahinzutrollen. Es ist dicht vor der Regenzeit, da sind die Träger rar.
So bin ich bei dem Verpacken meiner Sammlungen, von denen die früher gesandten Lasten in den Magazinen des Bezirksamts ein beschauliches, nur von zahllosen Ratten gestörtes Dasein geführt hatten, auf mich und meine Leute angewiesen. Zu diesen zählt einstweilen auch noch Nils Knudsen, der wacker mit zufaßt, trotz seines stets verdrießlichen Antlitzes. Es gefällt ihm an der Küste nicht; ihr feuchtes Klima sei ihm zu weich, und mit den Weißen vermöge er sich nicht zu stellen, behauptet er; er sei mehr an die Schensi dahinten gewöhnt, die ärgerten ihn nicht und guckten auch nicht auf ihn herab; er wolle bloß abwarten, bis ich nach Norden abgedampft sei, dann wolle er gleich wieder nach Westen ziehen, um Antilopen und Elefanten zu jagen.
„Nun, ich dächte, von der Sorte hätten Sie gerade genug“, sage ich wohlmeinend zu dem kühnen Jäger und werfe einen Blick auf seinen rechten Arm, von dem er behauptet, er könne ihn noch immer nicht recht wieder gebrauchen. Es ist aber auch eine schreckliche Geschichte gewesen.
Ich sitze eines Mittags gerade bei Tisch und quäle mich mit einem Gericht herum, dessen Natur ich nicht recht ergründen kann; es ist der Inhalt einer portugiesischen Konservenbüchse, doch habe ich die Aufschrift nicht übersetzen können. „Mach es nur zurecht, Omari“, habe ich zum Koch gesagt und mir nichts weiter gedacht. Jetzt schwimmen vor mir in einem gelbbraunen Meer von Brühe ovale dunkle Scheiben herum; zwischen ihnen tauchen hie und da gallertartige, molluskenhaft weiche Inseln auf; das Ganze schmeckt greulich,[S. 480] wie ein Gemisch von Schwefelsäure, Rüböl und Mostrichsauce. Endlich gelingt es mir, eine der Scheiben zu isolieren: eine Saubohne ist’s, die Inseln aber sollen den Speck bedeuten. Heiliger Vasco da Gama, nun kommst du auch mir noch in die Quere!
Ingrimmig male ich mir gerade aus, wie der alte Entdecker vor 400 Jahren als vorsichtiger Mann hier an der sichern Lindibucht ein Depot von Nahrungsmitteln errichtet hat, da erschallt Moritzens näselndes Organ: „Bwana mdogo anakuja, Herr Knudsen kommt.“ Ich drehe mich um; schleppenden Schrittes wankt die sonst so stattliche Gestalt des Wikingersohns daher, die Kleider zerrissen, über und über bestaubt; den rechten Arm aber trägt er in der Binde.
„Na, alter Nimrod, Sie hat wohl der Elefant gespießt?“ rufe ich ihm launig zu.
„Das nicht, ich bin bloß gefallen und habe den Arm gebrochen, aber mein Wanduwandu ist tot. Eben ist er gestorben, dort hinten bringen sie ihn.“ Tatsächlich sieht man in diesem Augenblick an der engen Bomatür eine Menschengruppe mit irgend etwas beschäftigt; was sie treibt, ist in dem rasch anwachsenden Schwarm der Hinzuströmenden nicht zu erkennen. Ich habe jetzt anderes zu tun, mit Gamas Saubohnen mag sich vergiften, wer da will; ich nehme den arg geschwollenen Arm des Jägers her und suche die Bruchstelle festzustellen. Nichts zu finden außer eben dieser starken Geschwulst, kein Knick, kein Splitter; also kalte Umschläge und Hochlagerung. Bassi, Schluß! Knudsen fällt wie ein Klotz in seinen Stuhl und versinkt sogleich in dumpfes Brüten, ich aber suche die Leiche. Unter einem breitschattigen Baum, ganz am andern Ende der Boma, haben sie sie aufgebahrt auf einer Kitanda, dem landesüblichen Bettgestell. Der Tote ist nur notdürftig zugedeckt, der Mund weit geöffnet; die gebrochenen Augen starren leer ins Weite. Hemedi Maranga tritt heran und drückt sie zu, während ich den Körper genauer untersuche; keine wesentliche Verletzung, nur die Fingerspitzen blutig und zerschlagen; sonst nur eine leichte Abschürfung an der linken Schläfe und darunter eine mäßige Schwellung.[S. 481] Dennoch kommen der Wali und ich überein, daß hier die Todesursache zu suchen sein wird; ein Abtasten des Kopfes läßt deutlich einen Schädelbruch fühlen; es muß ein furchtbar wuchtiger Hieb gewesen sein, dem der Mann zum Opfer gefallen ist. Aber ein Hieb mit weicher Waffe; ein harter Gegenstand würde die Außenteile zerschmettert haben.
Der Nachmittag hat viel Arbeit gebracht. Altgeheiligtem Brauch zufolge hatte ich mein Quantum Sanda mitgenommen, nicht ahnend, daß der leichte Stoff nun doch noch seinem eigentlichen Zweck dienstbar gemacht werden würde. In ein großes, weißes Stück hat man den Toten eingenäht, während andere draußen, hart über dem Bergesrand, dem jäh Verblichenen das Grab schaufelten. Gegen Sonnenuntergang hatte ich das Begräbnis angesetzt; um drei Uhr mußte ich schon meinen schnellsten Läufer entsenden, um die Leiche an ihren alten Standort zurückbringen zu lassen; die Stammesgenossen und Freunde Wanduwandus hatten die Zeit nicht abwarten können. Gegen sechs aber stand meine ganze Truppe in Leichenparade da. Auch hier wieder der Takt des Naturmenschen: jeder meiner Krieger hatte ohne Befehl meinerseits seinen Paradeanzug angelegt, Hemedi Marangas breite Brust aber zierte die Tapferkeitsmedaille. Von allen Eingeborenen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, ist mir Wanduwandu der sympathischste gewesen; eine prachtvolle Figur, die einzige, auf die die so oft mißbrauchte Redensart vom herkulisch gebauten Neger paßte; dabei ruhig, still, gemessen und doch seiner Kraft vollauf bewußt. So hatte er die Expedition Monate hindurch begleitet, von allen geschätzt, von niemand gehaßt. Ich habe es für ganz selbstverständlich gehalten, daß auch ich dem Mann, trotzdem er „nur“ ein Neger war, in reinem, weißem Anzuge das letzte Geleit zu geben hatte.
Yaogräber habe ich eine ganze Reihe gesehen und im Bilde festgehalten. Doch neben aller menschlichen Teilnahme mußte es mich fesseln, einmal einem Begräbnis als Zeuge beizuwohnen; ich habe aus diesem Grunde nicht im mindesten in die Maßnahmen der Eingeborenen eingegriffen. Das Grab hatte die Form des europäischen,[S. 482] nur war es weit flacher, wenig mehr als ein Meter tief; zudem hatten die Männer es viel zu kurz bemessen. Ein paar Hilfsbereite sprangen zwar sogleich herzu, um es noch angesichts des Toten zu verlängern, aber wenn in späteren Zeiten an jener Stelle einmal gegraben werden wird, dann wird man dort ein Skelett fast in der Form des liegenden Hockers vorfinden. Über den Toten hat man Matten als Schutz gebreitet; der Eingeborene liebt es nicht, selbst im Tode mit der bloßen Erde in Berührung zu kommen. Doch nun kommt etwas Fremdes in die Zeremonie; seit Tagen weilt der schwarze Prediger Daudi von Chingulungulu bei mir. Ich habe mit ihm noch manchen Punkt in meinen Aufzeichnungen durchzusprechen gehabt und daher habe ich ihn brieflich entboten. Wanduwandu ist Heide gewesen; Knudsen und ich haben ihn oft geneckt, ob er nicht lieber Moslim werden wolle oder gar ein Christ; aber überlegen hat er stets das Haupt geschüttelt, er wolle bleiben, was er sei, bei seinen Vätern sei er auch ganz gut aufgehoben. Daudi spricht am offenen Grabe ein paar Worte in Kisuaheli; unverkennbar hebt sich in ihnen die Stelle: „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub“ von den übrigen ab; sodann ertönt, von einigen wenigen Christenknaben, die es also in Mahuta doch geben muß, leise gesungen, ein ernster, kurzer Gesang der Feuerglut der scheidenden Sonne entgegen; ein leises Gebet von Daudis Lippen, klatschend fallen die ersten Schaufeln gelben Sandes auf die Sanda da unten. Strammen Schrittes marschieren meine Krieger davon, unter Lachen und schlechten Scherzen trollt die andere Gesellschaft hinterdrein. Der Tod? Was ist das weiter? Das kann jeden Tag passieren; zu ändern ist nichts dabei. Kismet!
Heute wird der Besucher von Mahuta über jener Stelle eine einfache, niedrige, aber gutgebaute Hütte finden, ein von sechs Pfählen getragenes Dach, das genau von Westen nach Osten gerichtet ist; von seinem First flattern Stücke bunten Zeuges lustig im Winde. Das ist Wanduwandus Grab.
[S. 483]

Für Nils Knudsen hat erst nach jenem Tage das Trauern angehoben. In seiner grüblerischen Weise hat er zunächst nach der Todesursache geforscht; der direkte Urheber des Unglücksfalles ist natürlich der Elefant, das unterliegt keinem Zweifel. Es war ein Alleingänger gewesen, ein riesiges Tier, auf das zunächst Knudsen ein paar Schüsse abgegeben hatte, worauf seine Begleiter, Leute aus der Niederung von Nkundi, aus ihren Vorderladern eine ganze Salve auf das unglückliche Tier losgedonnert hatten. Dieses war zwar in die Knie gesunken, hatte sich aber mit dem Rüssel an einem starken Baum wieder emporgezogen und die Jäger angenommen. Alles war bis zu dem verabredeten Sammelpunkt geflohen, nur der weiße Jäger war gestürzt, hatte dabei sein Gewehr weit weggeworfen und sich den Arm vestaucht. Erst nach unbestimmter Zeit bemerkt man das Fehlen Wanduwandus; Knudsen geht zurück und vernimmt auf dem Schlachtfelde von vorher ein dumpfes Stöhnen. „Na, den haben wir“, denkt er und meint den Elefanten; aber nicht das schwerverletzte Wild ist es, sondern der treue Wanduwandu, der unter einem Haufen von Geäst und Zweigen besinnungslos daliegt. Ob die Fährte des Elefanten unmittelbar an jenem Ort vorübergeführt hat, ist von Knudsen nicht beachtet worden, eine genaue Erinnerung an jenen schrecklichen Vorgang hat er bis heute überhaupt noch nicht. Nach Lage der Dinge wird man mit Sicherheit annehmen können, daß Wanduwandu,[S. 484] der im Ruf eines sehr tapferen, ja fast tollkühnen Jägers stand, dem wütenden Tier in die Quere gekommen und von ihm niedergeschlagen worden ist. Die starke Schweißspur des Elefanten hat sich im Busch verloren.
Dies ist also die direkte Todesursache; uns nüchtern denkenden Europäern würde sie genügen, hierzulande reicht sie nicht aus. „Das verfluchte dicke Frauenzimmer ist schuld daran, sie hat ihn früher schon einmal betrogen, und jetzt wird es wohl nicht anders gewesen sein“, das ist des völlig zur Negerdenkweise bekehrten Nils Diagnose. Ich weiß schon aus meinen früheren Jagdstudien von Chingulungulu her, daß in der Tat folgender Glaube allgemein besteht: Zieht der Mann hinaus ins Pori, um den Elefanten zu jagen, und die Frau daheim vergibt sich etwas im Punkt der ehelichen Treue, so rächt der Elefant das unweigerlich am betrogenen Ehemann selbst; er nimmt ihn an und schlägt ihn nieder; eine ganze Reihe von Beispielen, solche mit Namennennung sogar, hat man mir erzählt. Nun ist Wanduwandus Frau ein außerordentlich stattliches, für Negerbegriffe sogar bildschönes Weib; ihr Nasenpflock ist von außergewöhnlicher Größe und sehr zierlich ausgelegt, sie selbst von geradezu beneidenswerter Fülle; größte Rundlichkeit und höchste Schönheit aber sind hierzulande identische Begriffe. Erklärlich ist es darum, daß die Dame viel umworben wurde; diesen Umstand mit dem typischen Jägertod des Gatten in Verbindung zu bringen und ganz logisch den Schluß daraus zu ziehen: der Mann ist erschlagen worden, folglich muß ihn die Frau betrogen haben, ist für die Negerseelen, Nils Knudsen eingeschlossen, eins.
Erklärlicherweise habe ich mich dieser Deutung gegenüber sehr skeptisch verhalten, doch ich muß offen gestehen, es ist wirklich etwas daran; nur folgen die einzelnen Momente zeitlich in etwas anderer Reihe. Das Weib ist tatsächlich die indirekte Todesursache; Knudsen erinnert sich jetzt, daß Wanduwandu während des ganzen Jagdzuges seltsam aufgeregt und unvorsichtig gewesen ist; von anderer[S. 485] Seite habe ich gehört, daß die dicke Frau immer sehr stark kokettiert und daß unmittelbar vor dem Abmarsch zwischen den beiden Eheleuten eine sehr heftige Szene stattgefunden hat. Damit haben wir ohne weiteres den Schlüssel zum ganzen Rätsel: der Elefant hat den in völliger Verwirrtheit vor ihm herumstolpernden Jäger nicht umgebracht, weil dessen Frau sich gerade in diesem Augenblick mit anderen einläßt, sondern weil das Verhalten der Frau vorher den Mann bis zur Unvernunft erbost und kopflos gemacht hat. Aber es ist immerhin doch außerordentlich lehrreich zu sehen, wie leicht und allgemein sich Vorkommnisse solcher und ähnlicher Art, sofern sie nicht vereinzelt bleiben, zu Glaubensmaximen verdichten können.
Wanduwandus Tod hat an dem einmal festgesetzten Abmarschtermin nichts geändert; gleichwohl ist zu merken, daß es selbst unsere Leute noch stärker als vorher von dannen treibt. Für Knudsen hat seit jenem tragischen Ereignis ein hartnäckiger Kampf mit der Wittib begonnen. Diese nützt die Konjunktur aus und sucht den guten Nils unter dem Hinweis darauf, daß eigentlich doch nur er an dem Tode des Gatten schuld sei, auf einen Lieferungskontrakt von jährlich sechs neuen Kleidern festzulegen. Auf dem anderen Flügel seiner Schlachtordnung wird Nils von den Vettern und Verwandten des Verstorbenen attackiert; wie die Aasgeier sind sie plötzlich in ganzen Schwärmen herbeigeströmt und heischen nunmehr den rückständigen Lohn des verstorbenen Dieners für sich. Doch Bauer gegen Bauer, Nils ist ebenso zäh wie die anderen; schließlich kommt er zu dem Entschluß, der Witwe den Lohn zu verabfolgen. „Dann schlagen sie sie tot, noch ehe sie unten in Mchauru ist“, sage ich zu Knudsen und gebe ihm den Rat, das Geld durch einen Boten bei Matola, als dem Akiden von Wanduwandus Heimatsbezirk, zu deponieren; dort mag die Dicke die ungeheuere Summe von 4,75 Rupien — um diesen Riesenbetrag von 6,33 Mark handelt es sich bei der Erbschaft — nach Belieben abheben. Diesen Zahlungsmodus muß das Weib wohl nicht begriffen haben, denn als am Morgen nach dem Tage, an dem Knudsen ihr[S. 486] rundheraus erklärt hatte, auf den Kleidervertrag nicht eingehen zu wollen, ihr Abmarsch festgestellt wird, bemerkt der Koch Latu das Fehlen einiger Kostbarkeiten aus Knudsens Besitze: eines Quantums Erdnüsse und irgendeines anderen Genußmittels. „Nun soll sie mir aber noch mal wiederkommen“, sagt Nils, äußerlich sehr entrüstet, innerlich aber sichtlich beruhigt. Er kann wirklich ruhig sein; eine solche Schönheit läuft hierzulande nicht lange ungefreit herum, nach meiner Schätzung ist sie schon jetzt wieder verheiratet. Trotzdem drängt auch Nils von dannen.
Mir selbst läßt ein anderer Umstand Mahuta immer weniger anziehend erscheinen. Schon in Nchichira hatte mir der dortige Akide arg zugesetzt. Kaum graute der Tag, da begann auch schon das von tiefen Kehllauten begleitete Hersagen der Koransuren. Sprang man dann entrüstet aus dem Zelt heraus, so exerzierte schon die ganze Garde des Islam, am rechten Flügel der alte Akide, links an ihn angereiht die übrigen Moslim. Das ging morgens so und mittags und abends. Hier in Mahuta ist die Gemeinde des Propheten noch größer, ihr Glaube noch inniger und fester; zudem kommen wir immer tiefer in den Ramadan hinein. Huldigt mir mein Gesangverein durch seine Lieder, oder ergötzt sich die Schar der Träger und der Soldaten an immer neuen Ngomentänzen, in deren Erfindung sie wahre Virtuosen sind, so übertönt unser Kelele das Gemurmel und Geplärr der 17 bis 20 frommen Beter drüben unter der Barasa des Wali; haben diese aber das Wort allein, so ist es einfach schrecklich. Oberpriester ist der Wali; sein Organ ist an sich schon nicht melodisch, bewegt es sich jedoch in der Sprache des Koran, so kann einem das Nervenzufälle verursachen, zumal, wenn diese Exerzitien sich bis tief in die Tropennacht, bis über 10 Uhr hinaus, ausdehnen. Leider ist ein Eingreifen meinerseits ganz ausgeschlossen, selbst wenn ich nicht so tolerant wäre. Gegen die Gewohnheit des Wali indessen, nach der Entlassung seiner Gemeinde sich noch geraume Zeit mit lautester Stimme zu unterhalten und wahre Wasserstrahlen mitten auf den Bomaplatz zu spucken, habe ich sehr bald energisch und mit durchschlagendem[S. 487] Erfolge Front gemacht. Solange ich da sei, sei ich der Bwana kubwa, da habe ich zu bestimmen, was Desturi, was Sitte sei, und ich wünsche durchaus nicht, daß er meine Nachtruhe noch weiter störe.
Ein fernerer Anlaß für die baldige Rückkehr zur Küste ist die günstige Fahrgelegenheit für die Träger gewesen. Nach dem Fahrplan der Dampferflottille der Regierung, die aus den beiden Riesenkähnen „Rovuma“ und „Rufidyi“ und dem „Kaiser Wilhelm II.“ besteht, muß der letztere kurz nach dem 20. November von Lindi nach Daressalam gehen; kann ich meine Leute mit ihm nach Norden schicken, so habe ich für sie alle freie Fahrt, wenn ich sie aber bis zu meinem geplanten Abfahrtstermin am 2. Dezember bei mir behalten muß, so habe ich erstens noch eine Menge Lohn zu zahlen, außerdem aber, da mein Dampfer nicht der Regierung, sondern der Ostafrikalinie gehört, eine schwere Summe als Fahrpreis zu erlegen. Zu guter Letzt hat mich die Absicht an die Küste zurückgetrieben, in Lindi die Strafakten des Bezirksamtes durchzustudieren; gerade die Kriminalpsychologie ist ja für die Kenntnis der Völker wichtig.
Der Spektakel am Morgen des 12. November ist größer gewesen denn je. Wie wildgewordene Hammel springen meine Leute in der Boma umher, kaum, daß sie das „Los“ des weißen Führers abwarten können. Der Wali läßt es sich nicht nehmen, uns eine Strecke weit das Ehrengeleit zu geben; nicht so sein Sohn. Und wenn ich alt werden sollte wie Grillparzer, deiner werde ich nie vergessen, du holder Sprößling aus edlem Geschlecht. Unvergeßlich wirst du mir bleiben mit deinem abendlichen Tun; du bist nicht für die Arbeit, den ganzen Tag lungerst du umher, den anderen helfend, die auch nichts tun. Da sinkt der Sonnenball im Westen rasch hernieder, faulen Schrittes bist du auf die hohe Flaggenstange zugeschritten, an deren Gipfel im frischen Abendwind das schwarz-weiß-rote Symbol der Fremdherrschaft flattert. Einen letzten Blick wirft das Tagesgestirn noch auf Mahuta zurück, dann sagt es auf zwölf Stunden Lebewohl. Langsam gleitet das bunte Tuch am hohen Mast herunter, schon hältst du es mit beiden[S. 488] Händen gefaßt, ein scheuer Blick ringsum; der Bwana mdogo weilt in seinem Zelt, der andere aber, der Bwana Picha, der sitzt wieder über seinen Bildern dort am Tisch. Eine rasche Aufwärtsbewegung, — krachend explodiert das Riechorgan des Schmierlümmels in das Tuch hinein; es ist aber auch ein zu schöner, weicher Stoff, und so etwas wird selbst dem Sohn des Wali nicht geboten, da heißt es die Gelegenheit benutzen!
Der Marsch bis Luagala bietet wenig Bemerkenswertes. So eben wie auf einer Billardplatte zieht sich der Weg dahin; nur ist die Vegetation hier tausendmal schöner als im Süden des Plateaus. Ein wundervoller Hochwald zieht sich viele Meilen weit zur Linken und zur Rechten des Weges dahin; menschliche Siedelungen und der von ihnen untrennbare scheußliche Busch treten auf diesen zwei Tagemärschen zurück. Erst kurz vor Luagala wird es bergiger; bevor der Reisende aber zu der von einer halben Kompagnie besetzten, von einem kaiserlichen Leutnant befehligten Boma hinaufsteigt, durchreitet er erst noch ein seltsames Gefilde: Mangohaine mit Zehntausenden von Früchten, soweit das Auge zu schauen vermag, aber keine menschliche Seele dazwischen zu entdecken, nur verkohlte Häusertrümmer hier und da. Das ist Machembas altes Reich, jenes merkwürdigen Yao, der ganz ähnlich wie der berühmte Mirambo von Unyanyembe es verstanden hat, durch den Nimbus seines Namens ganze Scharen wagemutiger Männer um sich zu sammeln, das ganze Makondeplateau zu tyrannisieren und mehrfach selbst den deutschen Truppen die Spitze zu bieten; noch heute zeigt man dem Fremdling die einzelnen Gefechtsfelder. Machemba hat es vor fast einem Jahrzehnt aber doch vorgezogen, den deutschen Boden zu verlassen; seitdem sitzt er drüben auf dem andern Rovumaufer, fast in Sicht von Nchichira, und jagt zur Abwechselung den Portugiesen einen dauernden Schrecken ein. Der alte Krieger muß im übrigen ein ausgezeichneter Organisator gewesen sein; ein Dummkopf würde es kaum verstanden haben, auf dem Sande gerade dieses Plateauteiles eine solche Kultur erstehen zu lassen.

[S. 489]
Luagala mag strategisch gut gelegen sein, hydrographisch liegt es unglücklicher als irgendein Makondeweiler. Vier volle Marschstunden sind augenblicklich zum Herbeischleppen des Trinkwassers nötig. Und dabei grünt der Wald so schön und frisch, daß es eine Lust ist, nach der reichlich schweren Sitzung, die mir Leutnant Spiegel aus Freude über den Europäerbesuch bereitet hat, in seinem Schatten zu wandern. Es geht erst langsam, dann rascher abwärts; endlich klettert die Karawane den fast senkrechten Steilabsturz zum Kiheru hinunter. Das Flüßchen führt silberklares Wasser; so etwas ist in Ostafrika immer erfreulich, und schon will ich den Becher zum Munde führen. „Chungu-Bwana, es ist bitter, Herr“, sagt in dem Augenblick Hemedi Maranga, und ich lasse den Arm sinken.
Saidi Kapote ist schon ganz wieder typische Tieflandsiedelung, weitzerstreute, große, rechteckige Häuser mit schwerem Satteldach. Auch in bezug auf den abendlichen Fallwind gleicht es aufs genaueste den übrigen Siedelungen am Fuß des Hochlandes. Bis jetzt ist der Rückmarsch eine Reise mit Hindernissen gewesen; jeden Morgen die schreckliche Trägernot, so daß der Abmarsch erst in später Morgenstunde hat erfolgen können. Auch hier sind die am Vortag gedungenen Makonde wieder spurlos verschwunden; zwar gelingt es dem Akiden, durch Stellung einer Anzahl von Ersatzleuten unserer größten Not zu steuern, einige wertlosere Lasten indessen müssen einstweilen zurückbleiben; der Mann verspricht, uns diese nachtragen zu lassen.
Der vorletzte Marsch beginnt; es geht immer nach Osten, die langgezogenen Höhenzüge entlang, die sich zwischen Kiheru und Lukuledi in endloser Einförmigkeit erstrecken. Die Karawane ist jetzt sehr zahlreich, wohl über 100 Köpfe stark; in den hiesigen Sandmassen zieht sie sich zu unübersehbarer Länge auseinander. Dennoch geht es unverdrossen vorwärts, Stunde um Stunde; am Lukuledi eine kurze Rast, dann heißt es von neuem weiter. Endlich, erst gegen die Mitte des Nachmittags und nach mehr als achtstündigem Dauermarsch, machen wir unter ausgedehnten Palmen- und Mangohainen[S. 490] eine kleine Stunde westlich von Mrweka halt. Alles ist zum Umfallen müde und abgespannt, aber selbst der stumpfsinnigste Askariboy wälzt sich unruhig in seinen Träumen: schon morgen wird er in Lindi sein; welche Herrlichkeiten und Genüsse wird ihm diese Weltstadt diesmal bringen!
Unter dem Gefunkel des tropischen Sternenhimmels sind meine braven Krieger zum letztenmal angetreten, zum letztenmal ist das Getöse der aufbrechenden Karawane über das tiefeingeschnittene Lukuledital hinüber in das schweigende Pori gedrungen. In der Inderstraße von Mrweka fahren verschlafene Männer, nasenringbehängte Frauen und schreiend aufgeputzte Babys erschrocken hoch, als die furchtbaren Töne meiner Expeditionstuthörner ihnen ins Ohr gellen. Rasch wird es lichter, eine gelbbraune Gestalt fällt meinem Maultier in die Zügel; Herr Linder ist’s, der treffliche Wirtschaftsinspektor von Lindi. Er hat mir damals den letzten Europäergruß von Ruaha aus mitgegeben, er drückt mir nun auch als erster Kulturträger bei der Heimkehr die Hand. Seine Anwesenheit hier ist die Folge des „Booms“, er vermißt irgendwelche neuen Plantagengelände. Doch rasch geht es weiter, einen flachgeneigten Abhang zur Linken hinunter; die Spitze stutzt, alle Folgenden stauen sich auf, ein breiter Meeresarm dehnt sich vor uns aus. Ich bin landfremd und muß in diesem Fall einmal meinen Leuten folgen. Diese sind, die Kleider bis an die Schulter emporhebend, langsam in die Flut hineingeschritten; mein Maultier ziert sich noch ein Weilchen — es ist ja ein Fräulein —, dann aber stapft es mutig hinterdrein. Ohne jeden Unfall langt alles drüben am Ufer an, ein kurzer Sammelhalt, und im Geschwindmarsch geht es weiter auf Nguru Mahamba zu, das die Springflut bis fast in die Häuser hinein unter Wasser gesetzt hat.
Aus ist’s in diesem Moment mit der Wildnis. Der im Juli noch unfertige Weg stellt sich jetzt als die idealste Kunststraße dar; ihr fehlt nur das Auto, um das Kulturbild des zwanzigsten Jahrhunderts zu vollenden! Am Fuß des Kitulo der letzte große Halt; mich bannt[S. 491] Nils Knudsen auf die Platte, einen riesenhaften Baobab als Hintergrund; ich müsse mich auch im Kostüm des Afrikaforschers der Nachwelt erhalten, meint er; meine Leute aber machen Einzugstoilette. Es ist ein unsagbar malerisches Bild, wie die Kerle sich dort aufgebaut haben, auf Kisten und Lasten gekauert; mit einem Eifer, der so manchem guten deutschen Volksgenossen nur anzuempfehlen wäre, putzen und schaben sie an ihrem auch sonst schon so glänzenden Gebiß herum; spannenlang und daumendick ragt die „Swake“, die Zahnbürste Afrikas, zwischen den Lippen hervor, einer riesigen Zigarre gleich. Sie ist hygienisch einwandfrei und gut, diese Zahnbürste des Negers, ein simples Stück sehr faserigen Holzes, das in jede Ritze des Gebisses eindringt, ohne doch den Schmelz zu verletzen. Und überalt wird sie auch nicht, der Mann ist stets in der Lage, eine neue in Gebrauch zu nehmen.

Ich habe soeben den Scheitelpunkt des Kitulo erreicht; gerade werfe ich den letzten Blick auf den Teil Innerafrikas zurück, an dem nun auch ich in mühseliger, schwerer Arbeit Forscherrechte errungen habe, da brüllt mir Omari, der Koch, der keuchend den Berg herauf[S. 492] eilt, schon von weitem entgegen: „ndege amekwenda, der Vogel ist weggeflogen“. In der Tat ist der Käfig des kleinen Sängers leer; ein Stäbchen hat sich ein wenig gelockert, das war die Pforte zur Freiheit. Wie hat der kleine, bunte Vogel, eine Art Zeisig, die ganzen Monate hindurch unseren staubigen, heißen Rasthäusern durch sein schmetterndes Lied wenigstens etwas von ihrer schauderhaften Unwohnlichkeit und Ungastlichkeit genommen, und wie dankbar ist er für die paar Hirserispen gewesen, die sein Unterhalt gekostet hat. Jetzt ist er davon, genau in dem Augenblick, wo ich mir Sorge machen mußte, wohin mit dem kleinen Freund; das rauhe Klima des Nordens wird ihm kaum zusagen; soll ich ihn also dem ersten besten Europäer anvertrauen? Seine rechtzeitige Flucht hat mich des Dilemmas in einfachster Weise enthoben.
Eng aufgeschlossen, die Krieger in Sektionskolonne, die Reichsdienstflagge im frischen Seewind breit entrollt, geht es nach Lindi hinein. Meine Träger sind fremd, deswegen sind die Frauentriller, die sonst den Einzug jeder Expedition begleiten, nur dünn gesät. Stramm schwenken die Askari auf dem Bomaplatz ein, steif vom langen Ritt steige ich vom Tier, da endlich naht der erste Weiße. Die Begrüßung ist freundlich, die Freude ehrlich. Jetzt tritt der zweite herzu: „Herrgott, sehen Sie schlecht aus! Und Ihr Maultier erst, das geht doch noch heute ein; ums Bezahlen werden Sie wohl nicht herumkommen!“ Weg sind alle Illusionen; ich wende mich ab und lasse den Gefreiten, der in strammer Haltung abseits gestanden hat, nähertreten. „Ihr seid gute Soldaten gewesen, und du, Hemedi Maranga, bist der beste von allen; ich werde euch ein großes Fest geben. Aber jetzt geht heim zu euren Frauen.“ Ein Händedruck, ein paar kurze Kommandos, im nächsten Augenblick verschwinden die zwölf in ihrem Kasernenhof; ich selbst aber steige in meine alte Klause nach oben. Nils Knudsen hat recht: bei den Schensi ist es doch besser!
Von meinen Trägern habe ich in den wenigen Tagen, die ihnen in Lindi noch verblieben, nur wenig gesehen; um so mehr aber sind[S. 493] sie zu hören gewesen. Jetzt ist ihre Stunde gekommen; frei schwingt der „Kaiser Wilhelm“ draußen auf dem Strom um seine Ankerkette. Morgen früh bei Tagesanbruch soll die Reise nordwärts gehen, heute abend um Sonnenuntergang sollen meine Leute an Bord. Für 5½ Uhr habe ich sie vor das Posthaus, in dessen Oberstock ich ein nüchternes Zimmer bewohne, bestellt; ich will sie doch lieber selbst zum Hafen bringen. Die festgesetzte Zeit ist gekommen, aber kein Träger ist da; es wird 5¾ Uhr, schon werde ich unruhig, da erschallt immer näher ein so furchtbares Getöse, daß die Diagnose ohne weiteres gegeben ist. Aber haben sich die zwei Dutzend auf das Dreifache vermehrt? Ein dichtes Rudel tobt und wallt dort unten auf dem Platz herum, Bässe grölen, Triller schwirren; Ausschreitungen kommen nicht vor, wie ich das auch gar nicht anders erwartet habe. Regellos zieht der Haufe hinter mir her, die wenigen hundert Schritte zum Wasser hinunter; dort liegt schon der Fährmann bereit. „Bwana, ich möchte doch lieber hier bleiben“, sagt Kasi uleia, der Hübsche, und wirft einen zärtlichen Blick auf die dunkle Schönheit an seiner Seite. „Tu’, wozu dein Herz dich treibt, mein Sohn“, antworte ich milde. „Und das hier ist mein Boy, Herr“, sagt Pesa mbili II., der jetzt wieder sehr rundliche Jüngling aus Manyema. Die Bibi, die sich etwas verlegen hinter seinem breiten Rücken verbirgt, stellt er mir aber nicht vor.

[S. 494]
„Nun singt sie noch einmal, die schönen Lieder!“
In geschlossenem Kreis stehen die Mannen um mich herum. „Kulya mapunda“ geht ganz gut, sonor klingt die gefällige Weise über den rauschenden Lukuledi dahin. Auch bei „Dasige murumba“ zieht sich der Sängerkreis noch leidlich aus der Affäre; als nun aber das Standardlied anhebt: „Yooh ndērule“, da erscheint mir der Kreis recht verdünnt und lückenhaft; dafür erschaut mein Auge im Dämmerlicht in den Nischen des Ufergebüsches einzelne Pärchen. „Aha, Abschiedsszenen“, denke ich, stelle aber sofort fest, daß ich mich gründlich geirrt; nichts von Zärtlichkeit, sondern wie die Wölfe haben sich diese Materialisten über das letzte Liebesmahl hergemacht, das ihnen eine zarte Hand für die Seereise zugedacht. „Wohl bekomm’s“, sage ich halblaut und konstatiere zu meiner Befriedigung, daß auch beim Neger die Liebe durch den Magen geht.
Ungeduldig meldet sich der Fährmann; ich treibe den hagestolzen Teil der Sänger ins flache Wasser hinein. Lustig plätschernd waten sie von dannen; rasch ist es dunkel geworden, kaum unterscheide ich noch die weißen Gestalten, als sie ins Boot klettern. Yooh nderule, yooh nderule, wabwana mkubwa nderule — lang und gedehnt klingen die vertrauten Laute aus Pesa mbilis Kehle über die schweigende Flut — kubwa sumbana wogi nderulewa, yooh nderule hallt der Chor verklingend nach. Das Boot ist im Dunkel der Nacht verschwunden; ich wende mich der Messe zu, zur Hauptmahlzeit des Tages; in diesen Räumen gehöre ich wieder ganz zur Vollkultur — die Expedition Weule ist zu Ende.
[S. 495]
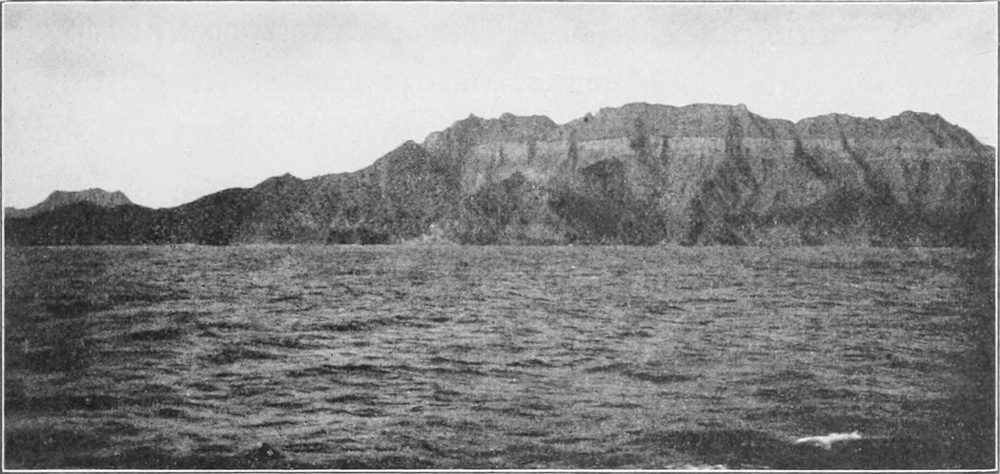
An Bord des Reichspostdampfers „König“.
Im Mittelmeer, vor den Nilmündungen,
20. Januar 1907.
Herrn Geheimrat Kirchhoff, Mockau bei Leipzig.
Vor wenigen Stunden haben uns die Palmen von Port Said den letzten Gruß Afrikas herübergewinkt. Jetzt ist der flache, sandige Strand des ägyptischen Deltagestades längst den Augen entschwunden, und graue Wasserwüste liegt vor dem Schiff, das immer mühseliger gegen den rasch aufkommenden Nordwestwind ankämpft. Überhaupt das Mittelmeer zur Winterszeit! Wo ist der ewig klare Himmel unserer Schulweisheit in Wirklichkeit! Kapitän Scharf, der es doch wissen muß, sagt, daß er diese Meeresstrecke um diese Jahreszeit gar nicht anders kennt als immer kalt, immer stürmisch, kurz, als einen unangenehmen Übergang von der herrlichen Temperatur des winterlichen Roten Meeres zu dem nordischen Klima des Atlantischen Ozeans und der Nordsee. Wir werden unmittelbar an Kreta entlang fahren[S. 496] müssen und werden so dicht an Griechenland vorüberkommen, daß die schneeigen Gipfel der Gebirge Spartas zu uns herüber grüßen, so schwer legt sich das Wetter gegen den breiten Bug unseres etwas altmodischen Dampfers, der für ein modernes Beförderungsmittel merkwürdig wenig Fahrt macht. Um so mehr Muße hat der Reisende, im behaglichen Rauchsalon in sich zu gehen und das Fazit zu ziehen aus alledem, was er in den letzten dreiviertel Jahren gesehen, gehört und gelernt hat.
War das ein vergnügter Abend am 2. Dezember an Bord des „Kanzler“ auf der Reede von Lindi! Man begriff kaum, woher mit einem Male die vielen weißgekleideten Europäer kamen. Ein Witzbold meinte, das eisgekühlte Pilsner, das Ewerbeck und ich in froher Abschiedslaune in unbegrenzten Mengen spendeten, sei der Magnet; doch das ist ein schlechter Witz gewesen. Die Anwesenheit eines deutschen Dampfers im Hafen ist in diesen Breiten immer ein Fest, das männiglich feiert wie es fällt. Mit Recht, denn nichts ist tötender als das Einerlei des Werktagslebens in Afrika.
Was den Dämpfling „Rufidyi“ mehr als drei Tage angestrengtester Arbeit gekostet hatte, der schnellfahrende „Kanzler“ hat es in einem Tage gemacht. Schon am 4. Dezember früh stiegen Ewerbeck und ich in Daressalam wohlgemut ans Land, Ewerbeck, um sich für immer vom Schutzgebiet zu verabschieden, ich, um über den verwaltungstechnischen Teil meiner Expedition höheren Orts Rechenschaft abzulegen. Für einen Neuling wie mich ist jener Aufenthaltswechsel belanglos gewesen, den Kaiserlichen Bezirksamtmann hingegen bewegten sichtlich ernsthafte und wehmütige Gedanken; er hatte den besten Teil seines Lebens, mehr als fünfzehn Jahre, an die Entwicklung gerade des Südostens von Deutsch-Ostafrika gesetzt; da geht man nicht gleichgültigen Herzens von dannen.
Daressalam war noch entzückender als im Juni; jetzt gab es „Embe“ in Mengen, in jeder Größe und jeder Beschaffenheit. Embe? Was ist Embe? Nun, für den Nordländer, der auf sein prächtiges Obst[S. 497] stolz sein kann, auf unsern unvergleichlichen Apfel, die saftige Birne, das große Heer unseres herrlichen Beerenobstes und was unser Garten an Köstlichkeiten sonst alles zu bieten gewohnt ist, für den ist Embe ein leerer Schall; wer aber dauernd in der Tropenregion des Indischen Ozeans lebt, für den ist diese Frucht der Inbegriff alles Herrlichen und Schönen. Die Mango ist es, jene indische Frucht, die seit langer Zeit ihre zweite Heimat in Äquatorial-Ostafrika gefunden hat. Der Baum ist gleichsam der Vorläufer jener ungezählten menschlichen Bewohner der großen Halbinsel zwischen dem Arabischen Meer und dem Bengalischen Golf gewesen, die heute alle größeren Orte in Britisch- und Deutsch-Ostafrika, im portugiesischen Gebiet und selbst auf der Südspitze des Erdteils als mehr oder minder unwillkommene Eindringlinge bevölkern. Angenehmer als der Inder niederer Kaste ist der Mangobaum allerdings; er gleicht im Habitus einigermaßen unserer Linde und verleiht jeder Siedelung etwas Anheimelndes und Gemütliches.
Und seine Frucht erst! Wie sie schmeckt, wenn sie vom Baume kommt, kann ich mit dem besten Willen nicht sagen; der weiße Bewohner von Daressalam genießt den großen Vorzug, in einem Kulturzentrum zu leben, wo man gewohnt ist, die fast kindskopfgroße, saftige Frucht nur auf Eis gekühlt serviert zu bekommen. In dieser Aufmachung ist die Embe allerdings ein Genuß, den man dem der Ananas fast an die Seite setzen könnte. „Embe“ ist denn auch das Schlagwort, das man vom Weißen beim Frühstück, beim Mittag- und beim Abendessen zum Boy hinüberrufen hört; ich glaube, die Weißen träumen in dieser Zeit sogar von jener Frucht.
Wie ein Blitz aus heiterm Himmel ist in dieses Schlaraffenleben die Kunde von den Ereignissen des 13. Dezember gefahren. Unmittelbar vor meiner Rückkehr nach Daressalam war dort der „Kaiserhof“ eröffnet worden, ein vortreffliches, erstklassiges Hotel, unter dessen erste Gäste zu gehören ich das große Vergnügen hatte. Man erstickte förmlich in Komfort: elektrisches Licht, vor jedem Zimmer eine breite,[S. 498] schattige Barasa, neben jedem Wohnzimmer die bequemste Badegelegenheit, eine mehr als üppige Verpflegung — nach den mageren Monaten in Busch und Pori war das des Guten eigentlich zuviel. Erfreulicherweise gewöhnt sich der Mensch jedoch an alles, selbst an ein gutes Leben.
In diese Ruhe und Behaglichkeit, die über der ganzen großen, beneidenswert behäbigen Beamtenstadt lagerte, schlug die Kunde von der jähen Auflösung des Reichstags wie eine Bombe ein. Selten habe ich so viele lange Gesichter gesehen wie in jenen Tagen; es war, als ob jeder einzelne Europäer bis zum letzten kleinen Unterbeamten hinunter persönlich von dem Geschehnis betroffen worden sei; in allen Messen und an allen Stammtischen ertönten die Unkenrufe über die schwarze Zukunft oder richtiger über den Mangel jeder Zukunft der Kolonie, deren ruhmloses Ende jetzt auch schon deshalb über jeden Zweifel erhaben schien, weil jeder von uns bei den Neuwahlen im Januar mindestens hundert „Sozi“ in den Reichstag einziehen sah. „Und mit dem Bahnbau ist es natürlich ein für allemal zu Ende“, das war der stereotype Refrain aller dieser Klagelieder, die man in gerechter Betrübnis in einem Meer von Whisky-Soda ertränkte. Ich persönlich bin der Überzeugung, daß es ganz so schlimm gar nicht werden wird, sondern daß auch der nächste Reichstag zum mindesten das gleiche koloniale Verständnis entwickeln wird wie sein Vorgänger; hoffentlich noch mehr. Am 25. Januar soll unser guter „König“ in Genua ankommen; das ist der Termin der Reichstagswahlen; am nächsten Tage wird man im großen und ganzen schon ersehen können, wie diese Wahlen zu einem Teil ausgefallen sind, zum anderen ausfallen werden, und wie sich das Schicksal unserer Kolonien für die nächste Zukunft gestalten wird.
Daressalam habe ich am 20. Dezember an Bord des „Admiral“ verlassen. Es ist ein herrliches, fast ganz neues Schiff, das noch weit ruhiger fährt als der „Prinzregent“. Auch sein Komfort ist noch größer; kein Wunder, wenn die Kabinen vollzählig besetzt waren. Es war[S. 499] jetzt noch mehr Old England an Bord als im Frühjahr, viel Kapstadt und noch mehr Witwatersrand; demgemäß herrschte auch ein erheblicher Toilettenluxus. Diesmal habe ich auch Tanga genießen können und sogar ein Stück Usambarabahn. Der umsichtige Kapitän Doherr hatte, wohl noch in Erinnerung an seine Managerdienste, die er erst vor wenigen Monaten den acht Reichstagsabgeordneten hatte widmen dürfen, einen Extrazug für die Schiffsgesellschaft oder doch für jeden, der sich beteiligen wollte, bereitstellen lassen, und mit dem „Zügle“ sind wir ins Innere bis Muhesa gefahren, bis riesige Schüsseln mit Sandwiches und große Servierbretter mit viel Whisky und Soda der Expedition ein rasches Halt geboten. Es geschieht wirklich etwas hier im Nordosten der Kolonie, das sieht man auch von den Abteilfenstern aus; zwar steht noch nicht alles Land unter Kultur, doch ist bereits jedes Stückchen in festen Händen, sogar weit über den Endpunkt des „Bähnle“ hinaus.
Hoch ging es am Abend in Tanga her. Die Stadt hat eine ganze Reihe von Vorzügen. Zunächst liegt sie von allen Küstenorten Deutsch-Ostafrikas dem Mutterland am nächsten; sie bleibt also auch schon dadurch gewissermaßen das Einfallstor in die Kolonie. Sodann ist der Hafen nicht schlecht; die weite Bucht ist freilich nicht ganz so abgeschlossen wie die von Daressalam, doch gewährt auch sie ausreichendes Fahrwasser bis dicht unter Land. Das Wichtigste ist jedoch die Nähe Usambaras, dieser Perle an Klima und Fruchtbarkeit. Usambara hat nur einen Fehler: es ist nicht groß genug, um alle die aufzunehmen, die sich dort niederlassen möchten. Jetzt soll bereits aller verfügbarer Boden aufgeteilt sein, so daß für Nachzügler kein Land mehr vorhanden ist. Diese sitzen unten in Tanga oder gehen weiter nach Süden, um andere Plätze für ihre Betätigung zu suchen; auch der „Boom“ von Lindi war zum großen Teil auf diese Überfüllung des Nordens zurückzuführen. Wirtschaftlich liegt also der Schwerpunkt unseres ganzen Kolonialbetriebes einstweilen noch in diesem Nordosten. Das tritt übrigens schon im ganzen Habitus des[S. 500] Europäerlebens in Tanga zutage; viele Monate lang hat der würdige Pflanzer dort oben in den Bergen Usambaras gesessen, ohne rechte Gelegenheit, den Nachbar zu begrüßen; jetzt hat’s ihn gepackt: er muß einmal unter Menschen. — Wenig später sitzt er im Klub von Tanga.
Wo der Deutsche ist, gibt’s auch Musik. Daressalam genießt den Vorzug zweier Kapellen, der Matrosenkapelle von den beiden Kreuzern und der schwarzen Askarikapelle. Beide erfreuen sich einer offiziellen Förderung; gleichwohl konnte ich mich den schwarzen Musikanten gegenüber des Eindrucks nicht erwehren: „sie kunnten’s nit gar schön“; in jedem Fall war die Musik sehr oft mit viel Geräusch verbunden. In Tanga ist man nicht nur in wirtschaftlicher Beziehung gewohnt, sich auf eigene Füße zu stellen; auch die Knabenkapelle ist ein privates Unternehmen. Tanga ist Schulstadt par excellence; Hunderte von Eingeborenenkindern werden hier in die Anfänge europäischer Wissenschaft eingeführt und in die Geheimnisse des Deutschen eingeweiht. Sie radebrechen’s denn auch alle, die kleinen schwarzen Kobolde; die Intelligenzen unter ihnen, bei denen die weißen Lehrer musikalische Talente entdeckt zu haben glauben, werden in die berühmte Knabenkapelle gesteckt. Dieser geht es augenblicklich ausgezeichnet. Als wir Admiral-Reisenden uns am Abend auf dem Platz vor dem Klub einstellten, empfing uns eine Musik, die mich sogleich an eine deutsche Jägerkapelle erinnerte. Ich hatte recht, von irgendwelcher Seite waren der Kapelle Waldhörner gestiftet worden; diese gaben den ganzen Darbietungen jenen unverkennbaren Charakter. Gespielt wurde von den kleinen Kerlen gut, das läßt sich nicht leugnen; so gut, daß allen Ernstes die Anregung fiel, man solle die Kapelle nach Uleia überführen, damit doch wenigstens einmal etwas Ordentliches aus den Kolonien importiert würde. Afrika reizt zu schlechten Witzen.
Es mag an zuviel Old England gelegen haben, daß Weihnachten nicht so stimmungsvoll verlief, wie wir Deutsche das wohl männiglich erwartet hatten. Der Tannenbaum, der im Speisesaal in hundert[S. 501] elektrischen Lichtern erstrahlte, wurde von den Ladies und Gentlemen stumm, aber ohne großes Erstaunen genossen, etwa mit derselben Gemütsruhe wie das illuminierte Eis, das von jedem hohen Festtag an Bord unzertrennlich ist, und ohne das man von dem Dasein des Festtages gar nichts merken würde. Neujahr „liegt“ wieder uns Deutschen nicht; am Silvesterabend sind wir zwar gewohnt, uns mehr oder minder tief unter Alkohol zu setzen, eine tiefere Bedeutung sehen wir jedoch in dem bloßen Wechsel der Jahreszahl nicht. Auch das neue Jahr wird uns genug Sorge bringen, dessen können wir sicher sein! Getanzt haben freilich beide Nationen mit gleicher Begeisterung und Ausdauer. Draußen brüllt der Sturm, von Nordnordwest direkt dem Schiff entgegen, das am nächsten Morgen vor Suez Anker werfen soll; hoch oben aber schaut mein alter Freund von Mahuta, der Vollmond, vom Firmament hernieder. Über den weißen Mann wundert er sich schon längst nicht mehr; der hat das gräßliche Kelēle, das Geschrei der Schwarzen, für schön befunden; jetzt springt er sogar höchstselbst wie ein wilder Neger vom Makondehochland dort auf dem großen Schiff herum, von dem so etwas wie Musik ertönt. Sie kommt zwar diesmal von weißen Leuten, gleichwohl ist sie nicht viel schöner als der Ngomenschall vom Rovuma. Es ist nur gut, daß sie so rasch vom Sturme verweht wird. Schier verärgert deckt der alte Herr jetzt sein Antlitz zu; weißgraue Wolken gleiten in rasender Eile vor ihm dahin; vor ihm und gleichzeitig auch vor den zackigen, steilen Bergen der Arabischen Wüste zur Linken, unter denen wir in fast unheimlicher Nähe der Küste entlang nach Norden dampfen. Um Mitternacht die übliche Versammlung im Speisesaal, ein Gratulieren von Tisch zu Tisch, von Bekannten zu Bekannten, ein Anstoßen und Zutrinken mit dem perlenden Naß der Champagne — man ist drin im neuen Jahr und segelt in seine dunkeln Tiefen mit ebenderselben Eleganz hinein wie das gute Schiff in den Golf von Suez.
Am 1. Januar gegen Mittag habe ich in Suez den Boden Ägyptens betreten, um ihn erst vor wenigen Stunden wieder zu[S. 502] verlassen. Mich hat es getrieben, die Stätten der altägyptischen Kultur und diese Kultur selbst an Ort und Stelle zu studieren; deshalb hat es mich bald von Kairo und seiner Umgebung hinweggezogen nach Oberägypten hinauf, nach Luxor, Karnak und Dehr el Bahri. Auch klimatisch war Kairo für den Übergang aus den Tropen zum winterlich kalten Nordeuropa nur wenig geeignet; von den Ägyptenreisenden des „Admiral“ wurde einer nach dem andern unpäßlich, so daß die einen sich kurzerhand nach Deutschland einschifften, indem sie sich sagten: „Den Schnupfen hast du dort billiger“, wohingegen die anderen in Luxuszug und Schlafwagen nilaufwärts steuerten, um im herrlichen Wüstenklima von Assuan sich langsam und vorsichtiger wieder an das subarktische Klima von Uleia zu gewöhnen.
Der Staudamm von Assuan ist kulturgeschichtlich eine Barbarei, technisch eine anerkennenswerte Leistung, volkswirtschaftlich eine Großtat. In scharfen Kurven schlängelt sich die Schmalspurbahn zwischen Luxor und Assuan nilaufwärts. Der Nil fließt bald unmittelbar am Bahndamm, bald legt sich eine schmale Alluvialebene zwischen den alten, heiligen Strom und das neue, unheilige Beförderungsmittel. Dabei hat man immerfort das Gefühl: „Herrgott, ist das Ländchen schmal; wenn’s nur der Wind nicht einmal überweht und zudeckt.“ Plötzlich treten die kahlen Hügel zur Linken zurück; eine weite Fläche tut sich auf, erst ganz weit hinten von den scharfen Konturen der arabischen Wüstenberge begrenzt. Wüste ist auch diese Ebene selbst, doch wie lange noch! Wende dein Antlitz zur Rechten, o Fremdling; dort erblickt dein Auge einen großen Gebäudekomplex. Er ist gar nicht ägyptisch und gar nicht arabisch; nichts vom Schmutz fellachischer Unkultur haftet ihm an, er verkörpert vielmehr den reinsten europäisch-amerikanischen Fabrikstil. Ihn zeigt auch der himmelhohe Schornstein, der das Ganze krönt. Der schaut so fremd auf das Silberband des Stromes zu seinen Füßen, auf den schmalen, grünen Streifen zu beiden Seiten dieses Stromes, und auf das unendliche Sandmeer der Wüste im Osten und Westen hernieder, als müßte er sich fragen:[S. 503] „wie komme gerade ich mit meiner überschlanken Röhrenform in dieses Land, wo alles so wuchtig, schwer und massig ist, die Häuser, die Tempel, die Gräber und die Pyramiden?“ Eine dichte Rauchwolke entquillt dem Schlot. Wende deine Augen nach vorn; siehst du dort das Silberband strömenden Gewässers, das sich in schnurgeradem Kanal in der Ebene verliert? Siehst du fernerhin die Gräben und Rinnsale, in die sich von jenem Kanal aus das Wasser des heiligen Stromes verteilt, vollkommen gesetzmäßig und gehorsam dem Willen des menschlichen Geistes? Des Rätsels Lösung ist einfach; der Gebäudekomplex ist eine Pumpstation, angelegt, jene zur Wüste gewordene Ebene von neuem zu bewässern. Jetzt ist die Ebene noch vollkommen kahl; in wenig Monaten wird sie ein unabsehbares Ährenfeld sein, dessen Halme hundertfältige Frucht tragen.
Die wirtschaftliche Erschließung der öden Sandflächen des oberägyptischen Niltals ist die gegebene Parallele für unseren eigenen Kolonialbetrieb. Ohne einen festen Willen, ohne Kapital und ohne eine genaue Kenntnis des Landes und seiner Eigenschaften würde auch jene englische oder amerikanische Gesellschaft im Niltal nichts erreichen. Alle drei Faktoren tun auch uns not, sofern wir weiterkommen wollen in Ostafrika, in Südwest, in Kamerun und Togo. Nur ein kleiner Unterschied ist dabei; der im Laufe vieler Jahrzehntausende angehäufte Alluvialboden des Niltales bedarf lediglich der Berieselung mit dem belebenden Wasser desselben Stromes, dem er seine eigene Entstehung verdankt, um sofort wieder ein Kulturboden allerersten Ranges zu sein. Der in seiner Wasserführung weise geregelte Nilstrom ist der Zauberstab, der die Verwandlung unfruchtbarsten Ödlandes in den besten Acker in einem kurzen Augenblick vollzieht. Für das Pori und die Steppen Deutsch-Ostafrikas fehlt uns dieser Zauberstab. Freilich hat das Land Flüsse und Bäche in großer Anzahl, doch sind diese Flußläufe in ihrer Wasserführung einstweilen noch nicht reguliert; keiner von ihnen ist auch in jenem großartigen Maßstabe schiffbar wie die Lebensader des Pharaonenlandes. Im Laufe der Zeit wird auch[S. 504] bei ihnen das alles kommen; man wird den Pangani zu einer Verkehrsader gestalten und auch den Rufidyi, vielleicht sogar den Grenzfluß Rovuma; doch das ist Zukunftsmusik, die die lebende Generation nicht mehr zu hören bekommen wird. Auch der Boden Deutsch-Ostafrikas hält den Vergleich mit dem des Niltals nicht aus; er ist kein abgesetzter, humusreicher Alluvialboden, sondern ein im allgemeinen ziemlich mageres Verwitterungsprodukt anstehender Gesteine; der Zauberstab des netzenden Wassertropfens allein tut’s also bei ihm nicht. Gleichwohl ist die Wasserfrage, soweit ich es beurteilen kann, die Kardinalfrage unserer ganzen kolonialen Agrikultur. Bei Saadani sind sie gleich in die Vollen gegangen: mit Dampfpflügen bearbeitet man dort gewaltige Flächen; Baumwollkultur im großen soll dem amerikanischen Monopol ein Ende bereiten. Das ist alles gut und schön gedacht; die Temperaturverhältnisse sind günstig, auch der Boden ist für jene Kultur vollauf geeignet; nur ein Faktor ist unsicher: Deutsch-Ostafrika kann ebensowenig wie Indien mit voller Gewißheit auf normale Niederschlagsmengen rechnen; wenn aber einmal der Regen ganz ausbleibt, was dann?
Man hat den dunkeln Weltteil oft und gern mit einem umgekehrten Teller verglichen; sanft und sacht steigt das Land ringsum vom Ozean aus an; allmählich wird der Neigungswinkel größer; schließlich artet die Küstenebene in ein vollkommenes Randgebirge von bedeutenden Abmessungen aus. Doch den Gebirgscharakter haben diese Berge nur von der Küstenregion her; ist man über sie hinweggeschritten, so ergeht es dem Wanderer wie auf den Höhen des Harzes oder des Rheinischen Schiefergebirges: die vordem so stattlichen Berge sind verschwunden, unbehindert kann er den gesamten Horizont überschauen, denn auch jenseits des Schollenrandes ist er auf nahezu gleicher Höhe geblieben. Um bei dem Bilde des Tellers zu bleiben: er hat den schmalen Aufsatzrand überschritten und spaziert nun auf der wagerechten Fläche des Bodeninnern bequem dahin.
Mit dieser ganz eigenartigen Oberflächengliederung muß auch unsere Kolonialwirtschaft stark rechnen. Zunächst ist die geringe oder[S. 505] ganz fehlende Schiffbarkeit der Flüsse durch sie bedingt; des weitern bringt es der Charakter unseres Luftmeeres mit sich, daß der Hauptteil der Niederschläge an jenem Schollenrande niedergeht, hinter dem dann die Zone einer Art von Regenschatten anhebt, die manchen Landstrich, wie z. B. Ugogo und die Nachbargebiete, zu nicht übermäßig üppigen Gefilden stempelt. Immerhin ist der größte Teil dieses Innern von einer Bodenbeschaffenheit, die das Fortkommen und Gedeihen aller für das äquatoriale Afrika überhaupt in Betracht kommenden Nutzpflanzen sehr wohl gewährleistet. Der Pflanzer ist dort in der glücklichen Lage, mit dem belebenden Einfluß der ständig scheinenden Tropensonne zu rechnen; diese zaubert selbst aus dem Sande wohlbestockte Fruchtfelder hervor. Dort unten im Süden habe ich mich tagaus tagein davon überzeugen können.
Überhaupt jener Süden. Er ist bisher das Aschenbrödel unter allen Bezirken unserer Kolonie gewesen, und ich fürchte, er wird es auch fernerhin bleiben; auf ihm lastet das Vorurteil, er sei unfruchtbar, und das schreckt die amtlichen und auch die privaten Kreise von seiner Erschließung ab. Es ist richtig: fett ist weder der Boden des Makondehochlandes noch des Mueraplateaus, noch der weiten Ebenen, die sich hinter beiden Bergländern zwischen dem Rovuma im Süden und dem Mbemkuru oder dem Rufidyi im Norden erstrecken; Sand und Lehm und Lehm und Sand hier, und Quarzgerölle dort, das ist die Signatur des Ganzen. Dennoch haben wir durchaus keinen Anlaß, an diesem Süden zu verzweifeln; denn wenn der Neger in ihm sein gutes Fortkommen findet, ohne Düngung sogar und ohne jede andere Errungenschaft unserer hochentwickelten intensiven Feldwirtschaft, wenn dieser selbe Neger außerdem in der Lage ist, erhebliche Bruchteile seiner Ernten an Sesam, Erdnüssen, Kautschuk, Wachs, Körner- und Hülsenfrüchten auszuführen, so wäre es verwunderlich, wenn der Weiße aus jenem Gebiet nicht noch mehr herausholen sollte.
Eins dürfen wir allerdings nicht vergessen: ein Schlaraffenland ist weder der Süden, noch Afrika überhaupt; niemand fliegen die[S. 506] gebratenen Tauben in den offenen Mund; Arbeit und immer wieder Arbeit ist vielmehr hier die Devise genau wie in minder glücklichen Klimaten auch. Gerade bei den Makonde, den Yao und den Makua haben wir genugsam Gelegenheit gehabt, diesen unausgesetzten Fleiß kennen und würdigen zu lernen. Des können wir jedenfalls sicher sein: viel bequemer wird es auch der europäische Pflanzer nicht haben, weder im Süden, noch im Norden, weder an der Küste, noch im Innern. Das schadet aber auch gar nicht; aus Müßiggängern sind noch niemals starke, lebensfähige Völker erstanden, auch in Kolonien nicht; im Gegenteil, je stärker die Anspannung und der Kampf um das Dasein gewesen ist, um so kraftvoller ist die Entwicklung auch aller Tochtervölker im Laufe der ganzen menschlichen Kolonialgeschichte gewesen. Die heutigen Vereinigten Staaten sind der klassische Beleg für diese Behauptung; die in der besten Entwicklung befindlichen Kolonien Südafrikas reden eine nicht minder deutliche Sprache. Andere Belege würde man mit Leichtigkeit zusammenstellen können.
Draußen gehen die Wogen immer höher; der „König“ ist mehr breit als hoch; er geht ganz ruhig, doch muß er es sich gefallen lassen, die Wasser des Mittelmeeres mehr, als ihm lieb ist, über sein Deck fegen zu sehen. Habe ich bei dem grandiosen Schauspiel wirklich die Pflicht, mich in unfruchtbare koloniale Ausblicke zu vertiefen? Der Ausspruch meines Freundes Hiram Rhodes von den „politischen Kindern“ war freilich mehr als hart, doch ein klein wenig Berechtigung hat er gleichwohl, auch über den Sansibarvertrag hinaus. Wir Deutschen sind 300 Jahre nach den anderen Völkern auf die koloniale Schaubühne getreten; trotzdem eifern Hinz und Kunz bei uns darüber, daß unsere vor ganzen 20 Jahren erworbenen Kolonien noch keine Überschüsse abwerfen; am liebsten möchten die braven Banausen, daß ihnen „Südwest“ womöglich ihre sämtlichen Steuern aufbrächte. Man könnte sich das Haupthaar raufen ob solcher Torheit und solchem Mangel an geschichtlichem Gefühl. In Deutschland werden die meisten Bücher gedruckt, keine gekauft und nur wenige gelesen. Unter diesen[S. 507] letzteren können kolonialgeschichtliche Werke kaum vertreten sein, sonst wäre es nicht möglich, daß selbst koloniale Fachkreise so wenig über jene tausend Kämpfe, Widerwärtigkeiten und Rückschläge unterrichtet sind, auf welche die Engländer in Indien, in der Südsee, in Afrika und Amerika mit wehmütigen Gefühlen zurückzuschauen Veranlassung haben, und welche den Niederländern, den Spaniern und den Portugiesen ihren ausgedehnten Kolonialbesitz sooft bis zum Überdruß hätten verleiden können. Uns schwebt unbewußt immer der Reichtum Englands und die Wohlhabenheit Hollands vor, die ja allerdings beide zum großen Teil auf dem Kolonialbesitz beruhen; dabei vergessen wir stets, daß drei Jahrhunderte ein fünfzehnmal längerer Zeitraum sind als unsere koloniale Ära, und daß bei beiden Völkern nicht weniger als zehn Generationen in harter, mühseliger, unausgesetzter Arbeit haben erringen und erkämpfen müssen, was uns Emporkömmlingen von gestern nach unserer Meinung mühelos in den Schoß fallen soll. Das ist ein Mangel an historischem Gefühl, auf den man gar nicht kräftig genug hinweisen kann; ich bin der festen Überzeugung, daß eine objektive Würdigung unseres schönen, großen Kolonialbesitzes auch erst dann Platz greifen kann, wenn wir diesem Mangel, der bei dem Volke der Denker doppelt unangenehm auffällt, durch einen besseren Unterricht abgeholfen haben werden.
Ein unfehlbares Mittel zur Gewinnung jenes historischen Sinnes ist das Hineinstecken von zwei Arten von Kapital in die Kolonien; das eine Kapital besteht in dem Menschenblut, das für ihre Erhaltung und Entwicklung vergossen wird, das andere in dem baren Gelde, das man für ihre Erschließung und Nutzbarmachung in ihnen selbst anlegt. Um die Größe des englischen Kolonialreiches und seine Verteilung über die ganze Oikumene zu veranschaulichen, wird häufig darauf hingewiesen, daß das Mutterland zu keinem Zeitpunkt ohne irgendeinen mehr oder weniger belangreichen Kolonialkrieg sei. Das stimmt für die Gegenwart; es hat jedoch auch seine Richtigkeit für die Vergangenheit; England hat in der Tat jederzeit um seinen auswärtigen[S. 508] Besitz zu ringen gehabt. Unzweifelhaft ist dieser dreihundertjährige Kampf um Haben und Nichthaben, der, auf spezifisch englische Verhältnisse übertragen, oft auch ein Kampf um Sein und Nichtsein gewesen ist, der Hauptgrund für das innige Zusammenleben der ganzen großen Familie von Mutterland und Tochterstaaten. Es hat wohl ein jeder einen Lieben da draußen in indischer oder in afrikanischer Erde liegen; das schafft zunächst eine schmerzliche Anteilnahme an jenem Lande; aus dieser aber entsprießen sehr bald auch anders geartete Interessen.
Die Richtigkeit dieser Lehre hat uns der blutige Krieg in Deutsch-Südwestafrika in ach so schmerzlicher Weise nur zu deutlich bewiesen. Der großen Masse bei uns war jenes Land, sofern sie überhaupt nur von ihm wußte, bestenfalls des neuen Deutschen Reiches Streusandbüchse; heute schlafen in seinem harten Boden ein paar tausend Söhne — und nicht die schlechtesten — den ewigen Schlaf; von ihnen ist der eine aus dem Palast, der andere aus der Hütte hinausgezogen an den Waterberg und in die Omaheke. Ist es da verwunderlich, daß jenes Land dem Volk seitdem ans Herz gewachsen ist? Wir möchten’s nicht missen, schon weil unsere Söhne und Brüder dort ausruhen von dem harten, schweren Kampf, der in der Reihe unserer größeren Kolonialkriege der erste gewesen ist, der aber vermutlich nicht der letzte sein dürfte. Das hat die Geschichte aller bisherigen Kolonialunternehmungen gelehrt.
Von dem anderen Kapital, den materiellen Werten, kann man bei unseren Kolonien nicht sprechen, ohne gleichzeitig die Bahnfrage zu berühren. Was ist geklagt worden über die unbesiegbare Zurückhaltung unseres deutschen Großkapitals den Kolonien gegenüber! Ich gehöre leider nicht zu der beneidenswerten Klasse glücksgütergesegneter Sterblicher; doch selbst wenn ich eine Million zu verlieren hätte, so würde ich mich doch noch sehr besinnen, sie in ein Land zu stecken, das durch keinerlei Verkehrswege erschlossen ist, durch natürliche überhaupt nicht, durch künstliche einstweilen nur mangelhaft. In der Heimat blickt[S. 509] man jetzt mit großen Erwartungen auf den neuen Lenker unseres kolonialen Karrens; Herr Dernburg ist ja Finanzmann; vielleicht erreicht er, was anderen vor ihm stets noch fehlgeschlagen ist: den Ausbau des längst geplanten großen Bahnsystems und den Zufluß der nicht minder nötigen großen Geldmittel.
Nicht ohne Bedeutung für die Zukunft Deutsch-Ostafrikas ist schließlich der Eingeborene; über ihn kann ich als Ethnograph auch wesentlich sicherer urteilen als über die anderen Fragen, zu denen unsereiner doch nur auf Grund seines gesunden Menschenverstandes Stellung zu nehmen befugt ist. Ein „unerzogenes Kind“ lautet das Urteil über den schwarzen Mann auf der einen Seite; ein „ausgefeimter Galgenstrick und unverbesserlicher Faulpelz“ auf der andern. Es gibt noch eine dritte Partei, die dem Ostafrikaner wenigstens eine oder ein paar ganz kleine Tugenden belassen will, doch diese wird niedergeschrien. „Kasi“ heißt im Suaheli die Arbeit; in der „Lustigen Ecke“ der „Deutsch-Ostafrikanischen Zeitung“ fand ich das Wort neulich anders übersetzt, da verdeutschte es der Suaheli mit dem Begriff „Gemeinheit“. Diese Auffassung vom schwarzen Mann ist an der Küste tatsächlich herrschend; nicht ganz mit Unrecht, wie man billig zugeben muß; der Stadtbevölkerung dort ist ernsthafte Arbeit wirklich ein Greuel und eine Gemeinheit.
Von dem ganzen großen übrigen Teil der Bevölkerung Deutsch-Ostafrikas glaube ich besser denken zu dürfen. Die zahlreichste Völkerschaft der ganzen Kolonie sind die Wanyamwesi; mit schätzungsweise vier Millionen Seelen füllen sie den ganzen zentralen Teil östlich des großen zentralafrikanischen Grabens. An ihrem Fleiß und an ihrer Kulturfähigkeit zu zweifeln hat bisher noch niemand gewagt; sie sind ausgezeichnete Feldbauer, gleichzeitig haben sie ein Jahrhundert hindurch den gesamten Karawanenhandel von der Ostküste bis zum Herzen des Erdteils aufrecht erhalten. In absehbarer Zeit wird dieser Trägerverkehr unwiederbringlich zu Ende gehen; wird jenes Volk damit überflüssig werden? Wirf, o Deutscher, einen Blick auf die Abschlußberichte[S. 510] der Ugandabahn und begreife sodann, welch wirtschaftsfrohes Element gerade du mit jenem starken Volke zu besitzen das Glück hast; sei allerdings dann auch klug und weise genug, die andere Folgerung zu ziehen, diese wirtschaftliche Tüchtigkeit für das eigene Volkstum zu fördern, weiter zu entwickeln und vor allem für dich selbst auszunutzen. Wir haben wahrlich keine Veranlassung, den Säckel eines Volkes zu füllen, das mit uns im schärfsten ökonomischen Wettkampf liegt.
Was den Wanyamwesi recht ist, ist der Mehrzahl der anderen Völkerschaften billig; auch jetzt noch, auf schwankem Schiff im Sturmestoben, komme ich nicht über den hohen Stand der Feldkultur hinweg, den ich bei meinen Freunden da unten am Rovuma als Norm vorgefunden habe. Völker, die bei aller Beweglichkeit so an der Scholle kleben, müssen unbedingt einen tüchtigen Kern in sich haben; all unsere Lehren der Völkerpsychologie und der Völkergeschichte würden sonst zuschanden werden. Erklären läßt sich diese unerwartet hohe Kulturstufe lediglich durch eine unmeßbar lange Dauer ihrer Entwicklung. Gegen das hohe Alter des Ackerbaues beim Neger spricht nichts; er ist konservativ, wie auch sein Erdteil konservativ ist; die paar fremden Elemente, die wir heute noch mit der Wirtschaftsform des Sammlers und Jägers behaftet finden, den Buschmann in den unfruchtbarsten Teilen des Südens, und den Pygmäen in den unzugänglichsten Teilen des zentral- und westafrikanischen Urwaldes, werden vermutlich schon vor sehr, sehr langer Zeit durch die ackerbauenden Bantu abgedrängt worden sein.
Die Feldbauform unseres Negers ist der Hackbau; dieser führt seinen Namen mit Recht nach der quergestellten schweren Hacke, mit der der schwarze Landmann den Boden seines Feldes kultiviert, lockert und reinigt, mit der er die Aussaat besorgt und zum großen Teil auch die Ernte, die, mit einem Wort, sein Universalinstrument ist. Wir sind nur zu sehr geneigt, in dieser Wirtschaftsform etwas Minderwertiges, Urwüchsiges zu erblicken. Insofern als der Hackbau keines Haustieres bedarf, weder zum Ziehen des Pfluges, der Egge, der[S. 511] Walze und des Erntewagens, noch zum Zweck der Dunglieferung, ist er wirklich rückständig; andererseits ist zu bedenken, daß große Teile unserer Kolonien Herde der Tsetsefliege sind, sodann, daß die mit dem Hackbau verbundene Beetkultur in Wirklichkeit eine sehr hohe Wirtschaftsstufe bezeichnet. Der beste Beleg dafür ist die Beibehaltung des schmalen Beetes auch in unserem Hausgarten, den wir im Range unmöglich hinter unseren Feldbau stellen können. Bezeichnenderweise nimmt der Feldbau, wo immer er zu der intensivsten Stufe unserer Agrikultur, zur Blumenzucht wie bei Erfurt, Quedlinburg, Haarlem usw., oder zur Gemüsekultur wie bei Braunschweig, Mainz, Hannover, ferner bei allen Großstädten, übergeht, sofort die Form des Beetes an. Zudem wüßte ich nicht, wie anders der Neger z. B. bei unserer breiten, unzugänglichen Feldform der Hauptgefahr seiner Pflanzung, dem Unkraut, beikommen wollte; sein schmales Beet gestattet ihm den Zugang von allen Seiten.
An die Form des negroiden Feldbaues wollen wir also nicht rühren; sie ist alterprobt und gut. Eine andere Frage ist es: wie machen wir unseren schwarzen Landsmann auf dieser Basis für uns nutzbar? Meines Erachtens gibt es da zwei Wege, die beide gleichviel für sich wie gegen sich haben; beide sind bereits seit längerer Zeit beschritten, so daß sich die Möglichkeit ergibt, die schließliche Entwicklung der ganzen Kolonie sehr wohl vorauszusehen. Der eine Weg führt direkt zur Plantagenkolonie. Dies geschieht in der Weise, daß man den Schwarzen in Haus und Hof nicht weiter fördert, sondern ihn zum Arbeiter auf den Pflanzungen der weißen Herren erzieht, die sich überall dort anbauen, wo geeigneter Boden und erträgliches Klima eine gute Kapitalsanlage versprechen. Die andere Methode hat den Neger und seine Entwicklung selbst im Auge; sie will seine eigene wirtschaftliche Produktionsfähigkeit nach Mannigfaltigkeit und Güte der Erzeugnisse vergrößern, ihm selbst dabei gleichzeitig größere Bedürfnisse anerziehen und ihn dergestalt auch kaufkräftiger machen. Für seinen Export soll er den unsrigen eintauschen.
[S. 512]
Ob sich das deutsche Volk nur für einen dieser beiden Wege entscheiden, oder ob es, wie bisher, beide auch weiterhin beibehalten wird, muß die Zukunft lehren. Für das Mutterland sind beide Methoden gleich viel oder gleich wenig wert, je nach der Intensität unserer gesamten kolonialen Betätigung; dem Neger würde allerdings die zweite mehr bringen. Als Plantagenarbeiter ist und bleibt er „Schensi“; als freier Besitzer seiner Scholle ist er entwicklungsfähig. Freilich muß man den Punkt dabei im Auge behalten, daß wir Kolonien gegründet haben in der Erwartung, für unseren rasch wachsenden Bevölkerungsüberfluß Auswanderungsgebiete zu bekommen; beansprucht der Neger die fruchtbarsten Teile seiner Heimat selbst, so ist es mit jenem ver sacrum nichts.
Von der durch uns einzuschlagenden Gesamtrichtung hängt es ebenfalls ab, ob wir an der physischen Verbesserung des Negers und seinem numerischen Anwachsen ein Interesse haben oder nicht. Unter dem Hauch der Zivilisation konnte das eine oder andere Naturvolk ganz oder nahezu dahinschwinden; die Tasmanier gehören der Geschichte an; die Maori von Neuseeland und die Kanaken von Hawaii nehmen an Zahl rasch ab; man spricht von den letzten Wedda auf Ceylon. Zu diesen Todeskandidaten gehört die Negerrasse nicht; im Gegenteil, wo immer sie mit den Weißen in Berührung getreten ist, erstarkt sie in jeder Beziehung; ihr Aussterben brauchen wir also nicht zu befürchten. Doch sollen wir ihren Vermehrungskoeffizienten durch künstliche Zuchtwahl noch zielbewußt heraufsetzen? Freilich sollen wir das, denn eine zahlreiche eingesessene Bevölkerung ist uns unter allen Umständen nutzbringend und dienlich; den Pflanzer befreit sie von der ewigen Arbeiternot, für den europäischen Fabrikanten aber und den Kaufmann ist eine große Kundschaft zweifellos angenehmer als eine kleine. Wie diese Verbesserung in die Wege zu leiten sein wird, darüber habe ich mich bereits früher (Seite 346 ff.), angesichts der vielfachen Krankheiten und Plagen des Erdteils, erschöpfend ausgesprochen; ich habe nichts weiter hinzuzufügen.
[S. 513]
In Europa gibt es dumme, mäßig begabte und ganz kluge Menschen; in Afrika ist es nicht anders. Wohl konnte gerade die ungeheure Lippenzier der Frauen da unten zuweilen den Eindruck hervorrufen, als hätte man es mit dem vielgesuchten Bindeglied zwischen Affe und Mensch, dem missing link der Deszendenzler, zu tun; auch manches Negerbübchen konnte zu deszendenz-theoretischen Vergleichen anreizen. Damit war indessen auch die Veranlassung, hochnäsig von oben herab zu schauen, zu Ende. In meinem während einer ganzen Reihe von Monaten durchgeführten Zusammenleben mit den Völkern des Rovumagebietes habe ich den Eindruck der Albernheit, den wir mit dem Neger gar zu gern verbinden möchten, niemals entdeckt; im Gegenteil, man konnte das Benehmen, mit dem nicht nur die würdigen Alten, sondern auch die feurigen Jungen mit uns beiden Europäern verkehrten, mit Fug und Recht als wohltuende Gesetztheit bezeichnen. Europäische Volkskreise von gleicher sozialer Stellung hätten sich ein Beispiel daran nehmen können. Auf Grund dieser guten persönlichen Erfahrungen glaube ich auch nicht an das Dogma des Mangels jeder Entwicklungsfähigkeit beim Neger; eine geistige Entwicklung ist ihm nicht einmal in Nordamerika abzusprechen, trotzdem die Hindernisse dort sicherlich größer sind als die Entwicklungsmöglichkeiten; warum sollte er also nicht auf die aufsteigende Bahn gelangen, sobald wir ihm die Gelegenheit dazu in richtiger Weise bieten? Nur nicht von heute zu morgen sollen wir das verlangen, das geht wider alle biologischen Entwicklungsgesetze; ganz ebenso wie die Erwartung einer wirtschaftlichen Blüte von heute zu morgen gegen jede geschichtliche Gesetzmäßigkeit verstößt. —
Es ist längst Nacht geworden; der „König“ muß den Kurs gewechselt haben, denn der Sturm faßt uns nicht mehr von vorn, sondern stark backbords; sicherlich geht es jetzt auf Kreta zu; morgen oder übermorgen werden wir an Griechenland vorüberfahren. Ich freue mich, offen gestanden, auf den Anblick des Landes, dessen antike Bevölkerung ich nicht so maß- und kritiklos verhimmele wie so viele[S. 514] Männer bei uns daheim, denen der alte Grieche die Verkörperung aller geschichtlichen und kulturellen Tugenden ist. Nur eins wird den alten Hellenen auch der Neid lassen müssen: kolonialen Unternehmungsmut haben sie in einem Ausmaß besessen, daß sie uns in dieser Beziehung für unsere ganze Zukunft als Vorbild dienen können.
Über dieser Zukunft liegt ein dichter Schleier. Wird uns Deutsch-Ostafrika ein zweites Indien werden? Nicht einen Augenblick bezweifele ich das; mein Auge sieht das weite Land durchzogen von Schienensträngen. Der eine folgt der alten, großen Karawanenstraße von der Küste bis zum Tanganyika. Den alten Trägerverkehr hat das schnaubende Dampfroß lahmgelegt; dafür beherbergt der ratternde Zug jetzt die früheren Träger selbst, außerdem Massengüter, denen bei der alten Art des Karawanenhandels der Weltmarkt verschlossen war. Zum Victoria-Nyansa läuft ein Schienenstrang und auch zum entlegenen Nyassa; wir gewinnen Anschluß an das britische Netz Südafrikas, an die Fahrstraßen des Kongostaates, an das Niltal. Vor dreißig Jahren noch war Stanleys Marsch zum Seengebiet und die Fahrt den Kongo hinab eine entdeckerische Großtat: wir Leute von heute fahren vielleicht noch mit dem Luxuszuge vom Kap bis Kairo, von Daressalam bis Kamerun.
[S. 515]
Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.
[S. 525]