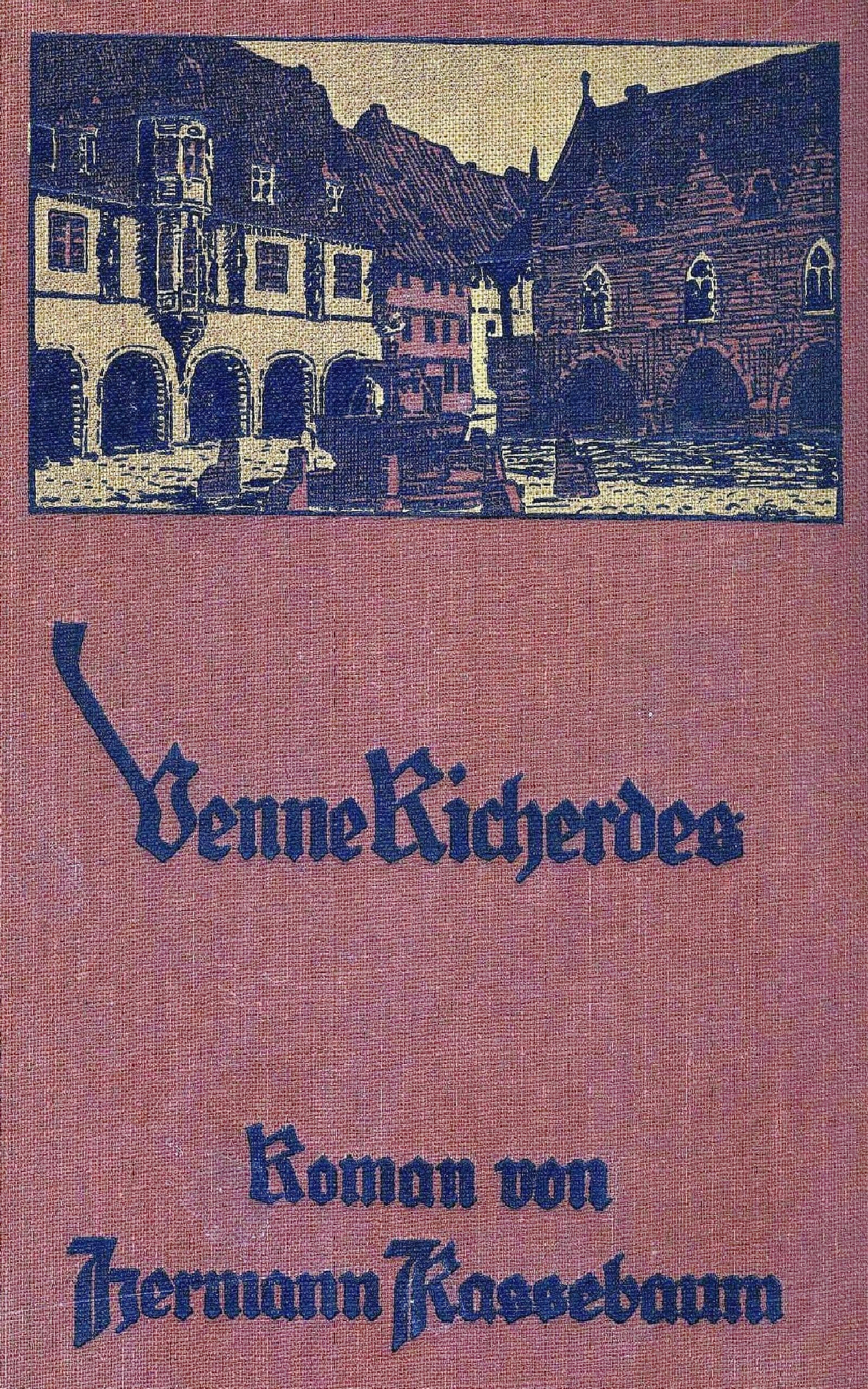
Title: Venne Richerdes
Roman aus der Geschichte Goslars
Author: Hermann Kassebaum
Release date: February 22, 2025 [eBook #75443]
Language: German
Original publication: Berlin: Verlag von Martin Warneck, 1925
Credits: Hans Theyer and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt; Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler sind stillschweigend korrigiert worden. Eine Liste der vorgenommenen Änderungen findet sich am Ende des Textes.
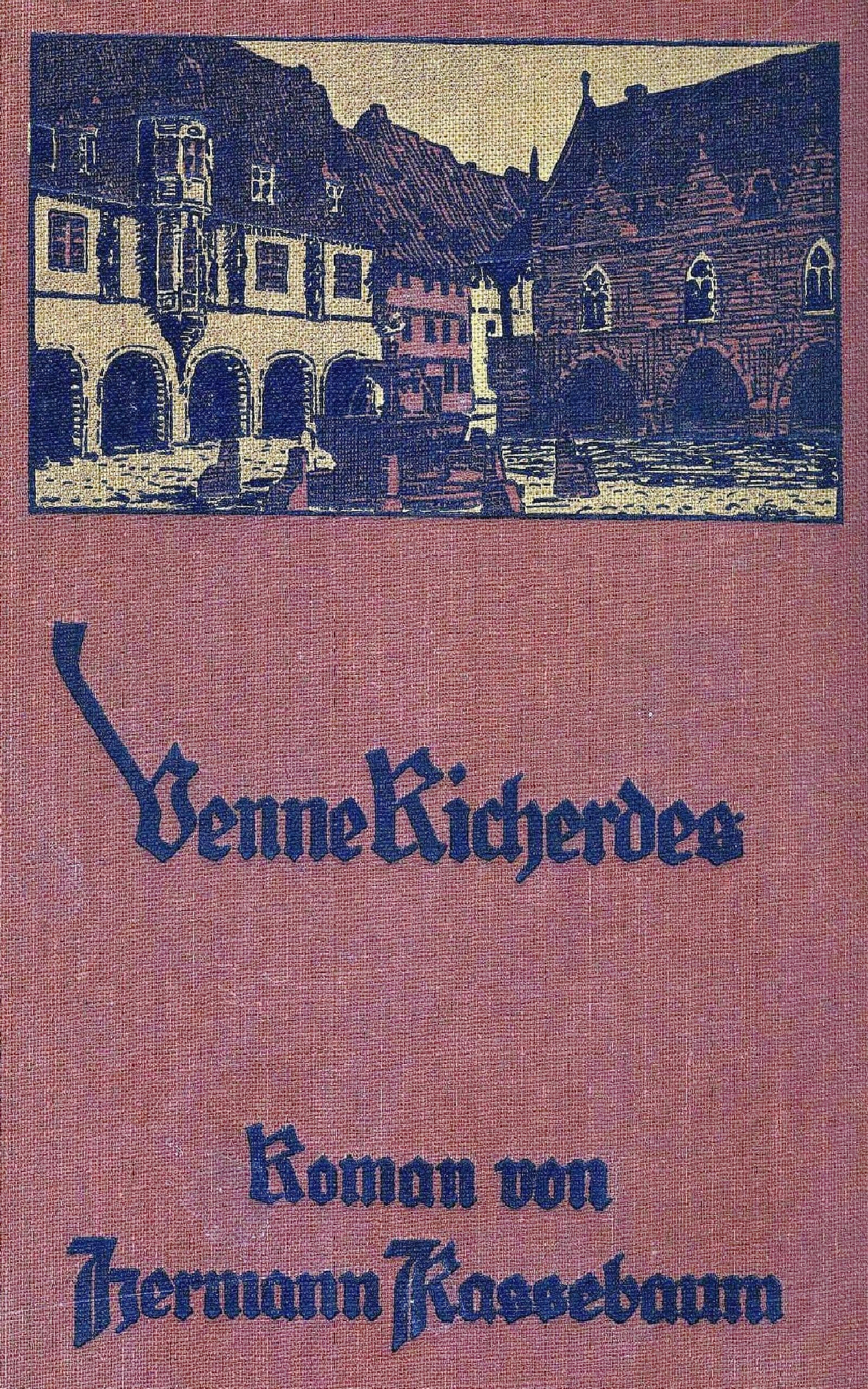
Roman aus der Geschichte Goslars
von
Hermann Kassebaum

Berlin 1925
Verlag von Martin Warneck
Alle Rechte vorbehalten
Copyright 1925 by Martin Warneck, Berlin
Herrosé & Ziemsen GmbH., Wittenberg (Bez. Halle).
Meiner lieben Heimatstadt
Goslar
[S. 7]
Die welschen Studenten nannten die beiden blonden Jünglinge insgemein ›li gemini‹, die Zwillinge. Halb war es Spott, halb Neid, der aus diesem Beinamen erklang. Besser noch trafen es die Bologneser Schönen, die den dritten, den braunlockigen Gottfried Kristaller, aus dem Bistum Straßburg gebürtig, in ihren Scherz mit einschlossen und die drei die ›Unzertrennlichen‹, ›li inseparabili‹, tauften. Hinter dem vorgehaltenen Fächer, hinter dem wohlverwahrten Fenster klang es immer wieder: ›Li inseparabili‹, wenn die drei Deutschen auftauchten oder vorübergingen.
Seit geraumer Zeit schon weilten sie auf Bolognas Hoher Schule, um dem Studium der Rechte obzuliegen, das hier nach wie vor seine vornehmste Pflegestätte hatte. Der Älteste von ihnen, Johannes Hardt, war der Semester vier hier, sein Vetter Heinrich Achtermann, gleich ihm in der alten Kaiserstadt Goslar am Fuße des Harzes daheim, kam vor mehr als Jahresfrist über die Alpen gezogen, und der dritte, Gottfried Kristaller, hielt die Mitte zwischen ihnen, was die Zeit des Studiums an der welschen Universität betraf.
Jetzt waren sie alle drei bereit, Bologna zu verlassen. Johannes hatte sein Ziel erreicht, denn er war unlängst zum Doktor der Rechte promoviert worden. Heinrich wollte mit ihm ziehen, weil es so geplant war und weil ihm der Zweck seines Aufenthaltes im Auslande erreicht zu sein schien, nämlich sich in der Welt umzusehen und sich dabei ein wenn auch bescheidenes Maß von juristischen Kenntnissen anzueignen, das[S. 8] ihm für die Ratsherrnstelle in Goslar, die ihm nach Geburt und Herkommen sicher war, nicht schaden würde und ihm auch für seine demnächstige Beschäftigung in dem umfangreichen Handelsgeschäfte seines Vaters, des Rats- und Kaufherrn Heinrich Achtermann, nur förderlich sein konnte. Und Gottfried endlich schied, weil er es ohne die Gesellen in Bologna fürder nicht glaubte aushalten zu können.
Die Abreise war beschlossen, der Tag dazu festgesetzt, der die Unzertrennlichen scheiden würde. Die beiden Goslarer wollten den kürzesten Weg in die Heimat einschlagen, den über den Brenner, während Gottfried Kristaller die Reise über Mailand und den Gotthardt wählte, um so gleichfalls möglichst schnell nach Straßburg zu gelangen.
Das bessere Teil fiel dabei Heinrich und Johannes zu, denn ihnen erblühte mit dem in Aussicht genommenen Wege das Glück, in anmutiger Gesellschaft bis in die Heimat zusammenreisen zu können. Es waren die Damen von Walldorf, des Feldobristen von Walldorf zu Braunschweig Ehegemahl und seine liebreizende und lebensfrische Tochter Richenza.
Man lernte die Damen in dem gastlichen Hause des Professors von Wendelin kennen, der am Collegium germanicum der welschen Universität die Rechte lehrte. Bologna genoß, wie schon angedeutet, dermalen noch den Ruf, die berühmteste Rechtsschule der Welt in seinen Mauern zu beherbergen, und die meisten Nationen, so auch das Deutsche Reich, unterhielten dort Akademien, die der Universität angeschlossen waren.
Professor Hieronymus von Wendelin weilte seit fast 30 Jahren als berühmter Lehrer in Bologna, und zu seinen Füßen hatte Johannes seit mehr als zwei Jahren gesessen.
[S. 9]
Auch die Freunde verdankten, was sie an geistiger Nahrung dort genossen, in vornehmster Weise Wendelin. Viel war das freilich bei Gottfried Kristaller nicht, und noch weniger hatte sich Heinrich Achtermann mit der trockenen Rechtswissenschaft den Magen verdorben. Er war Studierens halber in Italien, in Bologna seinetwegen, aber das Studium beschränkte sich nach seiner Ansicht nicht darauf, den spröden Stoff des römischen und kirchlichen Rechts zu zergliedern, wie es Wendelin und andere gelehrte Herren versuchten, sondern für ihn schloß es auch das Studieren von Land und Leuten in sich, und unter diesen wieder nahmen die Frauen sein Hauptaugenmerk in Anspruch, die schönen, wie sich versteht. Und so beharrlich schaute er den liebreizenden Bologneserinnen in die glänzenden Augen, bis die Besitzerinnen, was freilich nicht oft geschah, verwirrt die dunklen Wimpern über die leuchtenden Sterne herabsenkten oder er erforscht zu haben glaubte, was auf ihrem tiefsten Grunde an Geheimnissen und Seelenregungen geschrieben stand.
Gottfried Kristaller, der leichtlebige, bewegliche Alemanne, suchte es ihm darin gleichzutun. Was er an Wissen mit sich nahm, drückte ihn gewiß nicht nieder; aber er hoffte, die Lücken in seinen Kenntnissen daheim, in der gleichförmigen Ruhe des Vaterhauses bald ausfüllen zu können. So ergab es sich, daß er und Heinrich Achtermann in Wahrheit die Unzertrennlichen waren. Gemeinsam durchtollten sie die Nächte, gemeinsam verübten sie ihre losen Streiche, von denen dieser oder jener sie in nicht unbedenkliche Händel zu verwickeln drohte. Aber ihr unverwüstlicher Frohsinn half ihnen über alle Schwierigkeiten hinweg, und vor dem Freimut, mit dem sie ihre Sünden bekannten, glättete sich auch die düsterste Stirn.
[S. 10]
Nur selten eilten Heinrichs Gedanken in die ferne Heimat. Und was vor ihm alsdann auftauchte an altmodischer Tracht und Sitte im Vaterhause, vermochte ihn nicht lange zu fesseln. Er kehrte immer wieder schnell in die Wirklichkeit zurück, die ihn lachend und schmeichelnd umgab. Daheim lebte ihm der würdige Vater, immer und allerorts bestrebt, seiner Stellung als Ratsherr und Patrizier nichts zu vergeben, ihn, den Sohn und Erben, schon jetzt immer ermahnend, auf seinen künftigen Rang Rücksicht zu nehmen. Dort waltete die Mutter, die in ähnlicher Fürsorge an ihm arbeitete. Dort war alles auf die Form, auf den Anstand zugeschnitten, hier aber umgab ihn das lachende, sorglose Leben der Italiener, die in heiterer Ungebundenheit jeder Regung des Herzens unverhüllt und ungeschmält Ausdruck verleihen durften. Wäre es nach ihm allein gegangen, er hätte das sonnige Land noch länger zu seiner Heimat erwählt.
Auch eine Schwester war ihm beschieden, nur wenig jünger als er und im Wesen ihm nicht unähnlich. Aber die beiderseitige Lebhaftigkeit trug nur dazu bei, daß sie sich nach Geschwisterart ständig in den Haaren lagen, ohne daß eigentlich ernstliche Zerwürfnisse zwischen ihnen vorkamen. Doch Heinrichs Bedürfnis, zu necken und zu hänseln, erregte immer wieder den hellen Zorn des Schwesterleins, namentlich, wenn er es sich einfallen ließ, in ihr Zimmer zu kommen, während Freundinnen zu Besuch da waren. Drang er alsdann unbefugterweise ein, so konnte man darauf wetten, daß sein Abzug zuletzt ein unfreiwilliger war, der unter Schelten der Mädchen vor sich ging. Ihn aber focht das nicht weiter an, und noch heute gedachte er mit Schmunzeln der mancherlei Szenen, die es dabei gegeben hatte. Am lebhaftesten stand ihm die letzte[S. 11] vor Augen, die sich kurz vor seiner Abreise abspielte. Und auch die Gestalt der Freundin, um die es sich dabei handelte, war ihm in aller Lebendigkeit gewärtig.
Ein eigenartiges Mädchen, diese Venne Richerdes, wie sie ihm in der Erinnerung vorschwebte, lang aufgeschossen und noch ohne jede Rundung in den Formen. Weshalb gerade diese ihm besonders vor Augen stand, hätte er selbst nicht zu sagen vermocht. Vielleicht entwickelte sich das junge Ding noch einmal zu einer annehmbaren Mädchengestalt. Vorab aber fiel sie nur auf durch ihr sprödes, zurückhaltendes Wesen, das nicht selten sich in schroffen Meinungsäußerungen gefiel, besonders wenn sie mit seinesgleichen zusammengeriet.
Doch, eins hob sie aus dem Rahmen der übrigen hervor, das war die unnachahmliche Haltung des Kopfes mit dem wundervollen Rund der Zöpfe, die sich wie eine Krone um das Haupt legten, und dann das Spiel der Augen. Diese Augen, in deren unergründlicher Tiefe jetzt verhaltene Wehmut schlummerte, jetzt schalkhafte Teufelchen ihr Wesen zu treiben schienen und die in Augenblicken der Erregung flimmernde Blitze zu sprühen begannen. Ihm selbst war aus ihnen auch oft der Zornteufel entgegengefahren, wenn er sich nach seiner Art mit irgendeiner ihrer kleinen Eigenheiten beschäftigte. Selbst der Abschied von ihr verlief als ein solches Gewitter. Ja, zum Abschiednehmen kam es eigentlich gar nicht; denn als er sie am Tage vor seiner Abreise zufällig bei der Schwester traf, trat die zornige Spannung in ihrem Gesicht von Minute zu Minute deutlicher hervor. Die Schwester suchte ihn, wie so oft schon, auf schickliche Weise, hinauszubugsieren; aber in seiner behaglichen Dickfelligkeit pflanzte er sich nun erst recht breit in einen Sessel. Als das[S. 12] Gespräch zwischen den beiden Mädchen einen Augenblick stockte, suchte er es durch eine seiner gewöhnlichen Neckereien wieder in Fluß zu bringen. Noch schwieg die kampfbereite Venne, doch in ihren Augen wetterleuchtete es unheilverkündend, wie er mit innerer Freude feststellte. Nun bedurfte es nur noch geringer Mühe: hierhin einen kleinen Stich und dort einen Hieb, da war die Entladung da. Noch ein Wort, und Venne sprang auf und eilte zur Tür, ohne ihn eines Wortes zu würdigen; nur ein funkelnder Blick traf ihn dort noch, vor dem er sich, wäre er weniger dickfellig gewesen, hätte verkriechen sollen.
Der Erfolg verblüffte selbst ihn: Teufel auch, war das eine hitzige Kröte! Und nun setzte noch das Schmälen und Schelten der Schwester ein, daß er alle ihre Freundinnen weggraule. Es endigte zuletzt damit, daß sie ihn wutentbrannt aus dem Zimmer jagte. Er ging in dem nicht sehr behaglichen Gefühl, daß er vielleicht doch etwas zu weit gegangen sei, und es tat ihm halbwegs leid, daß sein Abschied von diesem Mädchen, das ihn durch ihre Eigenart immer wieder anzog, sich in so unfreundlicher Weise vollzogen hatte und daß sie seiner vielleicht mit Groll gedenke; denn Heinrich Achtermann war ein durchaus gutmütiger Gesell, dem es nicht entfernt beikam, einem Menschen absichtlich Unrecht zuzufügen.
Heute freilich lächelte er in der Erinnerung an jene dramatische Szene: Wetter noch einmal, hatte das Ding Temperament! — Wie mochte sie sich übrigens wohl inzwischen entwickelt haben? Ob sie seiner noch immer in unauslöschlichem Groll gedachte! — Da kehrten seine Gedanken in die Umwelt zurück und fanden sogleich das Ziel seiner Sehnsucht und Wünsche von heute, Richenza von Walldorf.
[S. 13]
Ja, die wenigen Wochen ihres Aufenthaltes im Hause der Wendelins und der rege Verkehr mit den Damen hatte genügt, um sein Herz lichterloh für die schöne Tochter des Obristen brennen zu lassen. Vergessen waren die liebreizenden Bologneserinnen, verdrängt von der lebensfrischen, sprudelnden Nichte des Professors.
Sie war zur Zeit unbeschränkte Alleinherrscherin in seinem Herzen. Auch die Freunde merkten seinen Gemütszustand und ließen es an harmlosen Neckereien nicht fehlen. Daß die kluge Richenza allein die Verheerung nicht erkannt hätte, die sie angerichtet, war kaum zu glauben. Sie ließ sich die Huldigungen des stattlichen Jünglings gern gefallen. Freilich besorgte sie nicht, daß er dauernd seinen Seelenfrieden an sie verlieren werde; denn die gelegentlichen Äußerungen der Freunde verrieten ihr, daß sie nicht die erste Rose sei, die er zu pflücken begehre. Über ihre eigenen Gefühle war sie sich nicht ganz im klaren, aber sie traute sich die Zurückhaltung zu, die gegebenenfalls, auch während der engeren Berührung, wie sie die gemeinsame Heimreise notwendig bringen mußte, eine Schranke festhalten würde, um ein allzu ungestümes Werben zu verhindern. Jetzt sahen sie sich täglich, ja die letzten Tage, seit die Studenten ihrer Verpflichtungen gegen die Universität überhoben waren, mehrmals am Tage, nachmittags bei gemeinsamen Spaziergängen, abends im Hause der Wendelins.
Ein besonderer Anlaß hatte die Walldorfschen Damen nach Italien geführt. Daheim lag das Brüderlein an langem Siechtum darnieder. Keine ärztliche Kunst konnte ihm Heilung bringen. Da riet der ihnen befreundete Prior eines Klosters der frommen Mutter, sie solle eine Wallfahrt nach Rom unternehmen, um den Segen des Papstes und die mächtige[S. 14] Fürbitte der Heiligen zu gewinnen. Der Vater, der rauhe Kriegsmann, murrte und sprach von pfäffischem Firlefanz, aber die Mutter ließ sich nicht beirren und brach mit der Tochter auf.
Rom lag hinter ihnen, und ihre Herzen waren voll froher Hoffnung; denn nicht nur hatten sie sich die Fürsprache im Himmel gesichert, sondern sie brachten auch die Vorschriften eines berühmten Arztes mit, von dessen Heilkunst sie in Rom erfuhren. Nach genauer Erkundigung über die Art des Leidens gab er ihnen seinen ärztlichen Rat mit auf den Weg.
Angesichts der Beschwerden der Reise war es für die Damen eine große Erleichterung, daß sie in den Wendelins Verwandte fanden, die ihnen auf der Hin-, wie auf der Rückreise gern Gastfreundschaft erwiesen. Dieser Aufenthalt bei dem berühmten Rechtsgelehrten, den sie, besonders Richenza, bisher kaum mehr als dem Namen nach gekannt hatten, bot ihnen nicht nur willkommene Rast, sondern zwischen der Tochter des Hauses, der lieblichen Gisela, und Richenza war eine aufrichtige Freundschaft und eine fast schwesterliche Liebe aufgeblüht.
Lag, als sie nach Rom wollten, noch die Sorge um den Sohn und Bruder wie ein Druck auf ihnen, so gab sich Richenza jetzt mit der ungebundenen Fröhlichkeit, die ein Grundzug ihres Wesens war. In den jungen Deutschen, die im Hause Wendelin ein und aus gingen, fand sie das willkommene Gegenstück zu ihrem eigenen Frohsinn, und Heinrich Achtermann wie Gottfried Kristaller waren immer bereit, auf ihre tausend Neckereien und Scherze einzugehen, während Johannes mehr zu der stilleren Gisela stand.
Die Aussicht, mit den beiden Goslarern die Heimreise antreten zu können, erfüllte Richenza mit heller Freude; denn[S. 15] auf die Dauer war von der frommen Mutter und dem bewährten Diener, den sie mitgebracht hatten, nicht allzuviel Kurzweil zu erwarten. Man beredete alle Einzelheiten der Fahrt, und der Tag der Abreise stand fest, da wurden ihre Pläne noch im letzten Augenblick über den Haufen geworfen.
Heinrich und Johannes wohnten in einem Hause der Karmelitergasse. Die Verbindung mit der Heimat war während ihres Aufenthaltes in der Fremde nicht allzu eng gewesen, ein Schreiben hin und her im Jahre oder deren zwei, das erschien beiden Teilen ausreichend, um sich von dem gegenseitigen Wohlergehen unterrichtet zu halten. Um so größer daher das Staunen, als Heinrich Achtermann kurz vor der Abreise noch einen Brief des Vaters ausgehändigt erhielt, der den letzten Teil seines Weges, von Trient ab, sogar mit besonderem Boten befördert worden war, da der Wagenzug der Kaufleute, die bis dahin den freundwilligen Beförderer abgegeben hatten, linksab, ins Val Sugano, einbog, um nach Venedig zu gelangen. Heinrich erbrach das Siegel voller Erregung, denn er ahnte, daß in dem Briefe Ungewöhnliches stehen werde. Kaum hatte er ihn durchflogen, da eilte er auch schon zu Johannes und pochte ungestüm an das noch verschlossene Zimmer.
»Auf, Langschläfer, mach' auf!« Und als der drinnen etwas von »Ruhestörer« murrte, rief er noch dringlicher: »Eile Dich, wichtige Nachricht von daheim!«
Da öffnete Johannes, der erst notdürftig bekleidet war, die Tür, und schon sprudelte ihm Heinrich die Neuigkeit entgegen.
»So lies doch, Mensch, lies doch«, drängte er, fuchtelte dabei aber mit dem Schreiben umher. Ruhig nahm es ihm Johannes aus der Hand und schickte sich an zu lesen, doch[S. 16] schon unterbrach ihn der Freund wieder: »Denk' doch, unser ganzer Reiseplan ist über den Haufen geworfen; nach Mailand sollen wir, über den Gotthardt, mit dem Ernesti ziehen!«
Etwas unwillig wehrte ihn Johannes ab: »Soll ich nun lesen, oder willst Du erzählen?«
Da ließ jener von ihm ab, konnte sich aber nicht enthalten, über dem Lesen immer wieder einen kleinen Fluch oder ein erregtes »Was sagst Du dazu?« einzuschalten. Johannes ließ sich indes nicht beirren, sondern las den Brief mit aller Gründlichkeit, und als er am Ende war, begann er noch einmal. Aber wiederum vermochte er nichts anderes herauszudeuten, als was er schon zum ersten Male gelesen.
Also schrieb aber der Vater und Ratsherr Heinrich Achtermann zu Goslar an seinen Sohn Heinrich:
»... demnach wir darauff gefaßt seyn undt erwarten, daß Deine Rückkehr, viellieber Sohn, sich noch umb mehreres verzögern werde, wasmaßen wir wünschen müssen, daß Du, ohngeachtet der größeren Strapazen undt Fatiguen, von Bologna den Weg uber Mediolanum, welches man jetzo heyßet Maylant, undt weyter uber den Sankt Gotthardtsperg wählen mögest, weyl Du in obgemeldeter Statt zum Anfang octobris den wohledlen undt wohlachtbaren Herrn Henricus Ernesti würst treffen, als welcher, nähmlich Herr Henricus Ernesti, dem hohen Rahte der Statt Goslar günstige Bottschaft von der römischen Curia, auch des Papstes Heyligkeyt zu erlangen beauftraget undt gewillt ist.
Obzwar nun vorbemeldeter Herr Henricus Ernesti unß solche Bottschaft in persona zu uberbringen bereyt, auch gehalten ist, er unß aber bittet, ihn vors erste davon zu befreyen, sintemalen er noch in denen hollandtschen Stätten zu weylen obligieret sey, haben wir unß dahin resolvieret, daß[S. 17] Du, viellieber Sohn, die obgemeldete Bottschaft uns, sigillo wohl verwahret, unversehret uberbringen mögest, undt seyn wir gewärtig, daß Du Dich der hohen Ehre, so Dir damit widerfähret, würst wohl gewachsen zeygen. Tun Dir auch zu wissen, daß es des Herrn Doctor Rudolpfus Hardt, als des Vaters Deynes Freundes undt Gesellen Johannes Hardt, Wille undt Befehl ist, selbiger möge Dir das Geleyt geben auf der Reyse gen Maylant zum Herrn Henricus Ernesti. Auch verhoffen wir, daß Ihr alle Fährlichkeyten der Fahrt möget wohl bestehen undt bey unß in Gesundtheyt werdet eyntreffen ...« Also schrieb der Ratsherr Achtermann an seinen Sohn Heinrich unter dem 25. Juni des Jahres 1515.
Johannes rieb sich die Stirn: Das warf ihre Reisepläne allerdings gründlich über den Haufen! Ihm selbst machte es ja schließlich nicht viel aus, ob er einige Monate früher oder später in Goslar eintraf, und da ihm Gelegenheit geboten wurde, das mächtige Handelszentrum Mailand zu sehen, wie die Schweiz und den Rhein, so sagte ihm die Änderung von Minute zu Minute mehr zu. Aber er verstand den Groll Heinrichs ebensosehr, kam dieser doch um die Möglichkeit, mit seiner neuen Herzenskönigin, der schönen Richenza, noch länger zusammenzusein.
Natürlich mußte auch Gottfried Kristaller sogleich von der veränderten Lage unterrichtet werden! Sie fanden ihn beim Frühstück. Er gewann der Sache sofort die beste Seite ab. »Aber das ist ja herrlich, prächtig, ihr Leute«, rief er begeistert. »Da reisen wir ja zusammen, und ich kann Euch unser altes, liebes Straßburg zeigen.«
»Du hast gut reden«, murrte Heinrich. »Dir mag es[S. 18] gelegen kommen, aber mir verdirbt es die ganze Rechnung.«
»Ach ja, ich verstehe,« schaltete Gottfried gutmütig lachend ein, »Du meinst, nun geht Dir das trauliche Zusammensein mit Richenza Walldorf verloren. Herzliches Beileid! Aber ich schaffe Dir Ersatz in unsern schönen Straßburgerinnen.«
»Geh mir mit Deinen Dummheiten. Was gehen mich Deine Straßburger Gänschen an!« grollte er. »Oho,« zürnte da Gottfried, dem der Schelm im Nacken saß, »das laß nur mein Schwesterlein hören! Gerade ihr wollte ich Dich präsentieren, von den noch schöneren Bäschen und Freundinnen ganz zu schweigen. Doch wenn Du nicht willst, so habe ich noch ein anderes Lockmittel: Unsern Wein wirst Du nicht verschmähen, und der wird Deine Lebensgeister schon wieder heben. Erst wird gehörig Rast im alten Straßburg gehalten, und dann mögt Ihr zu Euren Hyperboräern heimziehen. Mich friert jetzt schon, denke ich nur an Eure Eiswüsten da oben im Norden!«
Da mischte sich Johannes ins Wort. »Nun gebt einmal Ruhe, Ihr Streithähne, und laßt uns überlegen, was zunächst zu tun ist. Ich meine, vor allem müssen wir die Walldorfschen Damen von der Neuigkeit unterrichten.« Und das geschah denn auch.
Man war natürlich im Hause Wendelin nicht weniger überrascht, und besonders Richenza tat unzufrieden, daß die schönen Pläne ins Wasser fielen. Aber es zeigte sich doch, daß die Wunde, die ihrem Herzen geschlagen war, nicht allzu tief ging. Während die Mutter noch klagte, daß sie nun der angenehmen Begleitung und des Schutzes verlustig gingen, fand Richenza schon wieder ein munteres Wort. »Ei, so müssen wir uns also des Wiedersehens daheim getrösten,[S. 19] in Goslar oder in Braunschweig. Und nun wollen wir nicht länger Kopfhänger sein«, schloß sie herzhaft. »Die Tage schwinden schnell dahin, die uns noch bleiben. ›Carpe diem‹, heißt's nicht so, Ihr gelehrten Herren? Ich hörte es immer vom Oheim in Braunschweig, wenn ihm die Schaffnerin noch heimlich eine Flasche des guten Weines holen mußte, ohne daß es die Gattin sah. Also ans Werk, das heißt: Was wollen wir heute noch unternehmen?«
Die Auswahl war nicht groß in Bologna. Die dumpfen, glutheißen Straßen der Stadt boten kaum des Abends Erholung, und die Elemente, welche sie alsdann belebten, waren, wie andererorts, kein Anreiz für Damen. Es blieben nur die Uferwaldungen am nahen Reno übrig, dessen schattige Gänge man also am Spätnachmittage aufsuchen wollte. Der Fluß selbst war, wie die meisten Wasserläufe, die der Apennin speist, jetzt zu einem dünnen Rinnsal zusammengeschrumpft.
Der Schicklichkeit halber begleitete Donna Wendelin, die Mutter Giselas, die Ausflügler, obwohl diese lieber unter sich gewesen wären. Dem guten Gottfried fiel die Ehre zu, die Dame zu führen. Er machte zuerst ein etwas sauersüßes Gesicht, doch er fand sich bald mit Anstand in seine Würde, zumal er wußte, daß er den Freunden, mindestens Heinrich Achtermann, einen Gefallen erwies. Auch war Frau von Wendelin noch eine sehr hübsche Frau zu nennen, der man die erwachsene Tochter nicht ansah. Gottfried spielte seine Rolle als galanter Ritter so anmutig und war so unerschöpflich in seinen drolligen Einfällen, daß Frau von Wendelin aus dem Lachen nicht herauskam.
Die beiden anderen Paare gingen bald langsamer, bald[S. 20] schneller und beredeten, was ihnen am Herzen lag. Heinrichs Ungestüm drängte immer wieder zu einem entscheidenden Wort, aber Richenza hielt ihn mit ebensoviel Anmut wie Geschicklichkeit in Schranken. Als er dann doch von seiner Liebe zu reden begann, unterbrach sie ihn schelmisch lächelnd, wie wohl auch ihr bei seinen Worten ums Herz war.
»Ich bitte Euch, sprecht nicht weiter. Wir wollen den Tag nicht durch so ernste Dinge belasten. Ihr seid mir gut, das will ich glauben, wenngleich ...« — Heinrich wollte beteuern, da fuhr sie heiter fort: »Um Gottes willen, nur nicht auch noch einen schweren Eid bei dieser schrecklichen Hitze; ich will's Euch glauben, auch unbeschworen. Doch im Ernst, wir wollen jetzt vernünftig sein. Laßt erst einmal die Reise zwischen unserer jungen Freundschaft liegen, dann mag's sich erweisen. Übrigens wird auch mein Herr Vater noch ein Wort mitreden wollen, ein gar gestrenger Herr!« — Die Schelmin wußte, daß sie den Vater bisher immer noch dahin brachte, wohin sie ihn haben wollte, und sie verschwieg auch, daß just in diesem Augenblick das hübsche Gesicht eines Vetters von daheim vor ihr auftauchte, der ihr seine Neigung mit noch heißeren Worten kundgetan hatte, ohne daß sie auch darüber gerade ungehalten gewesen wäre.
Seufzend ergab sich Heinrich in sein Schicksal und machte ein so betrübtes Gesicht, daß die muntere Richenza hellauf lachte. »Um Gott, nicht diese Leichenbittermiene. Ich verschwöre es ja nicht, Euch später anzuhören, nur Geduld sollt Ihr haben. Vielleicht sehen wir uns demnächst in Braunschweig wieder, und vielleicht müßt ihr mich dort im edlen Wettbewerb mit andern zu erringen suchen, die auch mich[S. 21] garstige Person ins Auge gefaßt haben. Ich freue mich schon jetzt auf die Rolle der minniglichen Richterin über euch.« Das war wieder ganz der Schelm Richenza, und nun fand sich auch Heinrich wieder.
Währenddessen gingen Gisela und Johannes miteinander. Ihr Gespräch floß nicht so leicht dahin wie das der Übrigen. Namentlich Gisela wollte bisweilen, wie es schien, das Wort versagen.
Sie waren in der langen Zeit, seit Johannes in Bologna weilte, in ein fast kameradschaftliches Verhältnis zueinander gekommen. Als der junge Student vor nunmehr mehr als zwei Jahren ankam, brachte er die Grüße und Empfehlungen seines Vaters mit, der, jetzt ein gesuchter Arzt in Goslar, einst mit dem Professor von Wendelin in Leipzig zusammen studiert und Freundschaft gehalten hatte. Diese alte Bekanntschaft öffnete Johannes sogleich das Haus der Wendelins, und er ging dort bald wie ein Sohn ein und aus.
Die Studenten des Collegium germanicum hielten gleich denen der andern Nationen eng zusammen, und die Professoren, zumeist Deutsche, wie Herr von Wendelin, stützten diesen Zusammenschluß dadurch, daß sie die jungen Leute an sich zogen, blieb ihnen doch selbst die Verbindung mit der alten Heimat erhalten.
Nicht alle die wilden Gesellen jener Zeit der Scholaren und Vaganten vermochten sich im Zaum zu halten. Aber die Gutgearteten unter ihnen und die aus gesitteten Familien waren doch froh, daß sich ihnen hier im fernen Welschland ein Haus auftat, in dem deutsche Laute erklangen und deutsche Art gepflegt wurde. Auch die rohen Elemente vergaßen selten eine Wohltat, die ihnen von den Professoren erwiesen wurde. Und Herr von Wendelin hatte sich in dieser[S. 22] Hinsicht in mehr als einem Herzen ein Denkmal der Dankbarkeit gesetzt.
Von all diesem sprach Johannes heute zu Gisela, und aus seinen Worten erklang eine aufrichtige, ehrliche Dankbarkeit, daß es ihr warm ums Herz wurde bei so viel Anerkennung ihres geliebten Vaters. Und dann kam Johannes auf sie selbst zu sprechen und ihre Freundschaft, und er gab ihr seinen heißen Dank zu erkennen, daß sie ihn dieser Freundschaft gewürdigt habe. Einem Impulse folgend, ergriff er ihre Hände und sprach, während er sich zu ihr neigte: »Habt Dank für alles, was Ihr mir erwiesen. Ich weiß nicht, wie ich die Trennung von Euch und Euren lieben Eltern werde ertragen können. In meinem Herzen bleibt Ihr für immer. Bewahrt auch mir ein freundliches Gedenken.«
Gisela war unter den Worten ihres Begleiters errötet und erblaßt. Sie vermochte kein Wort zu sagen, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Da kam ihrer Verwirrung Gottfried zu Hilfe, der sich gerade näherte. Sie suchte sich zu fassen und zwang sich sogar ein Lächeln ab, als jener eine launige Bemerkung fallen ließ. Dann schickte man sich zur Rückkehr an.
Dies war nun der letzte Abend, den die jungen Deutschen in Bologna verlebten. Er beschloß die schönen Tage, welche dem Abschiede vorhergingen, und fand sie, wie begreiflich, im Hause der Wendelins.
Alle bemühten sich, den Scheidenden die Stunden so angenehm wie möglich zu machen. Aber sie konnten es doch nicht verhindern, daß ein Hauch leiser Wehmut über dem[S. 23] kleinen Kreise lag, je weiter die Stunden vorrückten. Besonders Gisela zerdrückte mehr als einmal eine stille Träne, wenn sie sich unbeobachtet glaubte. Dann glitt wohl ein schneller, heimlicher Blick nach dem Platze, wo Johannes neben der Mutter saß: Ach, er wußte ja nicht, wie ihm ihr junges Herz entgegenschlug und wie schwer sie an dem Gedanken trug, ihn morgen vielleicht für immer zu verlieren.
Die Mutter ahnte nicht, welche Verwirrung der junge Deutsche im Herzen ihres Töchterchens angerichtet hatte. Sie unterhielt sich mit ihm über die ferne Heimat ihres Gatten und sah sie durch den Mund des Freundes neu, in begeisterter Schilderung vor sich erstehen. Aber immer mehr senkten sich, von den Augenblicken angeregter Rede abgesehen, die Schatten wehmutsvoller Trauer herab. Noch einmal suchte die fröhliche Richenza die Stimmung zu retten mit einem Appell an die Jugend, wobei sie ihre Freundin Gisela besonders ins Auge faßte.
»Euch ist wohl heute nachmittag der letzte Trost auf dem Reno davongeschwommen, als wir an seinen Ufern uns ergingen. Laßt Euch nicht an Seelenstärke von einem schwachen Mädchen, wie ich es bin, übertreffen. Droht uns doch, meinem lieben Mütterlein, wie mir, in gleicher Weise die Stunde des Abschieds von diesem gastlichsten aller Häuser im Lande Italia. Ich aber habe mein Herz gewappnet gegen alle Trübsal und helfe mir über die Wehmut des Augenblicks mit einem herzhaften ›Auf Wiedersehen‹ hinweg.«
»Mach' es wie ich,« wandte sie sich nunmehr direkt an ihre Base, die liebliche Gisela, deren Gesicht sich bei den Worten der Freundin noch mehr mit Trauer überschattet hatte, »verhärte dein Herzlein, daß die Herren nicht meinen, sie hätten uns bezwungen.«
[S. 24]
Doch damit beschwor sie das Unheil erst recht herauf. Hatte sich Gisela bis jetzt noch tapfer gehalten, so rannen ihr nunmehr die Tränen unaufhörlich über die Wangen, und sie stürzte fluchtartig aus dem Zimmer, um ihr Herzeleid den übrigen zu verbergen. Bestürzt sahen diese ihr nach. Wohl hatten die Eltern bemerkt, daß eine Freundschaft zwischen ihrem Töchterlein und dem jungen Deutschen sich entwickelte; aber der unbefangene, fast kameradschaftliche Ton, in dem sie sich äußerte, ließ sie nicht ahnen, daß die Herzensruhe ihres Lieblings ernstlich gestört wurde. Nun schien dies dennoch der Fall.
Die Mutter wie Richenza eilten der Entflohenen nach. Der Vater blieb allein zurück mit den jungen Freunden.
Auch die Männer blickten betroffen drein. Der Vater erkannte, daß sich eben vor seinen Augen der Anfang eines Dramas abzuspielen begann, dessen Ausgang im dunkeln lag. Aber bei der Gefühlstiefe, die er an seinem Töchterchen als ein Erbteil seiner selbst zu jeder Zeit bezeugt gesehen hatte, mußte er besorgen, daß ihr schwere Stunden bevorstanden.
Heinrich Achtermann und Gottfried Kristaller waren am meisten überrascht. Daß die Tränen nicht ihnen galten, wußten sie genau. Ihre eigenen Angelegenheiten hatten sie immer so sehr in Anspruch genommen, daß sie auf Johannes und Gisela nicht sonderlich achtgaben. Nun zeigte es sich, daß die arme Gisela, die ihnen um ihrer anspruchslosen Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit willen ans Herz gewachsen war, ein Kummer bedrückte, der sie nach ihrer Eigenart besonders schwer treffen mußte. Sie schieden beide nur mit leichter Bürde auf dem Herzen, wenn auch Heinrich im Augenblick meinte, ohne Richenza nicht leben zu[S. 25] können. Doch ihm stand ja die Aussicht offen, sie in Deutschland wiederzusehen, während für Gisela und Johannes morgen der Abschied für immer bevorstand. Das tat ihm von Herzen leid.
Johannes durchzuckte ein Gefühl, halb des Schreckens, halb der Freude, als Gisela davoneilte. Hatte er bisher eine Art schwesterlichen Empfindens für sich bei ihr vorausgesetzt, so war er zuerst hieran irre geworden, als sie vor einigen Tagen am Reno ihre Gedanken über seine bevorstehende Abreise austauschten. Er sah ihre seltsame Erregung und Verwirrung und war geneigt, sie als eine Äußerung nicht nur rein freundschaftlicher Zuneigung zu deuten. Worüber er sich selbst nie zuvor klar geworden, was er für sich nie zu erhoffen gewagt hätte, das schien in ihrem Herzen Wurzel geschlagen zu haben. Damals schon durchzuckte ihn der Gedanke, sie könne ihn lieben, sie wolle ihm angehören, mit einem heißen Glücksgefühl. Jetzt fand er bestätigt, was er nicht auszudenken gewagt hatte.
Dieses junge Menschenkind, über das eine gütige Fee alle Holdseligkeit der Jugend ausgebreitet zu haben schien und das in seiner Brust gleicherweise die edelsten Gefühle echter Weiblichkeit barg, war ihm mehr als die Genossin frohseliger Jugendstunden, sie brachte ihm das Geschenk einer ersten, keuschen, zarten Liebe dar. Aber zugleich bestürmte ihn auch der Schmerz, daß er morgen schon verlieren sollte, was er eben erst gewonnen hatte. Die Trauer griff ihm ans Herz, denn er mußte sich bezwingen, um ihren Frieden nicht noch mehr zu stören, wie er sich Zwang angetan hatte, seit er selbst erkannte, daß die Liebe zu dem holdseligen Geschöpf seine Brust durchzittere.
Inzwischen waren die Mutter und Richenza um Gisela[S. 26] bemüht. Da sie argwöhnte, daß der junge Deutsche ihre Tochter durch seine Schuld um ihre Herzensruhe gebracht habe, wallte zuerst der Unmut gegen jenen in ihr auf. Aber beim ersten Wort, welches sie in dieser Hinsicht fallen ließ, warf sich Gisela sofort zum Verteidiger des heimlich Geliebten auf.
»Er ist gewiß ganz unschuldig an der Sache, die Schuld habe ich dummes Mädchen allein. Weshalb wußte ich meine Gefühle nicht besser zu verbergen. Nun habe ich zu dem Schmerz auch noch den Spott, denn die Freunde werden sich gewiß über mich einfältiges Ding lustig machen.«
»Das werden sie nicht tun,« fiel ihr Richenza ins Wort, »dazu sind sie viel zu ehrlich und anständig. Und Dein Johannes im besonderen, so darf ich ihn hier doch wohl nennen, denkt zuletzt daran; denn ich müßte eine schlechte Beobachterin sein, wenn nicht auch ihm der Abschied von Dir recht naheginge.«
Gisela wehrte unter Tränen lächelnd ab, doch die Freundin ließ sich nicht beirren. »Ich weiß, was ich weiß. Übrigens kann ich ihn ja erforschen, wenn Du es wünschest.« Erschrocken wehrte Gisela ab, während tiefe Röte ihr Gesicht überflutete.
»Daß Du Dich nicht unterstehst! Ich müßte mich ja zu Tode schämen; denn gewiß würde er glauben, Du handeltest in meinem Auftrage, um ihn auszuforschen.«
Richenza versprach zu schweigen. »Nun aber auch wieder ein fröhliches Gesicht aufgesteckt, daß die Herren sich nicht einbilden, Du habest um sie Dein Tränenkrüglein gefüllt. Ich weiß zudem noch einen Trost für Dein Leid. Es muß ja morgen nicht für immer geschieden sein. Wenn die Eltern es erlauben, besuchst Du uns daheim in Braunschweig. Der[S. 27] Weg zu uns ist nicht weiter als von uns zu Euch, und Du siehst, ich bin heil hier angelangt und hoffe, auch unversehrt wieder im alten Braunschweig einzutreffen. Von da nach Goslar ist's ein Katzensprung. Wollt Ihr also, so gibt es im nächsten Jahr ein frohes Wiedersehn bei uns daheim.«
Gisela lächelte schwermütig zu den Zukunftsplänen der Base. »Du glaubst ja selbst nicht, daß der Plan gelingen wird.«
»Das tue ich allerdings; es hängt nur von Dir und Deinen Eltern ab, ob und wann er in Erfüllung gehen soll. Ihr seht doch an mir und der lieben Mutter, daß auch ein Frauenzimmer den Weg über die Alpen wagen kann. Außerdem wirst Du immer reiche Gesellschaft finden, denn die Straße über den Brenner ist so begangen, daß jede Gefahr ausgeschlossen ist. Wenn Dich also nicht jedes Murmeltierchen schreckt, das ein Steinchen zum Herabrollen bringt, so mach' Dich getrost auf die Reise. An Kurzweil wird's Dir bei uns nicht fehlen. Nun aber laßt uns wieder zu den Herren hineingehen, daß sie nicht auf falsche Gedanken geraten.«
Auch die Mutter trieb dazu. Ihr Herz war von mehr Sorge erfüllt, als sie zu erkennen gab; denn sie kannte ihr Kind zu genau, um nicht zu wissen, daß die Wunde zu tief ging, um ohne ernsten Schaden geheilt werden zu können.
Im Zimmer ergriff Richenza sogleich wieder das Wort und suchte die Situation zu klären.
»Das sind die dummen Schwächen, unter denen wir Frauenzimmer leiden. Kaum freut man sich einmal wirklich, ist auch gleich so eine Migräne da, die uns bis zu Tränen niederzwingt. Aber, Herr Oheim, wir haben indes schon ein Plänchen ausgeheckt, das unsere Gisela heilen wird. Sie[S. 28] muß einmal heraus aus eurer Tropenluft hierzulande. Erlaubt, daß sie uns besuche daheim im lieben Braunschweig, wo ja auch Eure Wiege stand. Dann mögen Euch ihre roten Wänglein bei der Rückkehr verraten, daß wir gute Pflege gegeben haben; und was dabei noch für Euch, Herr Oheim, abfällt an lebendigen Erinnerungen an Eure liebe Heimatstadt, das nehmt als gern gegebene Draufgabe. Also entscheidet Euch kurzerhand und gebt die Erlaubnis. Ist's nicht für sogleich, so schenkt uns die Gisela für das kommende Jahr. Und wenn es die Herren Studiosi und Doctores gelüstet, uns zu besuchen, so wissen die Herren, daß es von Goslar nur ein Ritt von wenigen Stunden ist. Herr Kristaller muß sich allerdings schon von seinem fernen Straßburg herbemühen, will er, daß der lustige Kreis von Bologna in Braunschweig aufs neue erstehen soll.«
Der Vater war überrascht und suchte nach Einwendungen. Aber da er die leuchtenden Augen seines Lieblings während der Worte Richenzas sah, hielt er mit lauten Bedenken zurück und hoffte, daß die Zeit ihn der Notwendigkeit überheben werde, die endgültige Zustimmung zu erteilen. Doch nun legte sich auch Johannes für den Plan ins Zeug. Das war ja die Erfüllung einer Hoffnung, die er selbst gar nicht zu hegen gewagt hätte. Und den vereinten Anstrengungen gelang es, die endgültige Zusage zu erhalten. Er ahnte nicht, daß die Ausführung unter viel trüberen Umständen wirklich erfolgen sollte.
Die Stunde des Abschieds war gekommen. Als Johannes sich über die Hand Giselas neigte, flüsterte er ihr zu: »Ich weiß, daß wir uns wiedersehen; das macht mir den Abschied leichter. Bewahrt mir bis dahin ein Plätzchen in Eurem Herzen.«
[S. 29]
Ein lichtes Rot der Freude überflog das Gesichtchen Giselas, und eine reizende Verwirrung ließ sie noch lieblicher erscheinen. Aufs neue füllten Tränen ihre Augen, aber es waren Tränen seligen Glücks. Dann schloß sich hinter den Freunden das Tor des alten Palazzo Faba, in dem der Professor wohnte.
[S. 30]
Als am andern Morgen die Glocken von San Giacomo Maggiore die Frühmette einläuteten, traten Johannes und Heinrich, wie auch Gottfried, aus ihrer Wohnung und bestiegen die schon bereitgehaltenen Pferde, denen ihre Felleisen, das einzige Reisegepäck, welches sie persönlich mit sich führten, sorgsam aufgeschnallt waren.
Das Tor wurde gerade von dem halbverschlafenen Wächter geöffnet, als sie die Stadt auf dem Wege verließen, der als die uralte Via Aemilia vor dem Apennin entlang führt und nur jeweils in den Städten, die sie durchkreuzt, sich eine Abweichung von der schnurgeraden Richtung gefallen lassen muß, in der sie als ein endloses, weißes Band sich dahinzieht. Mit ihnen ging noch ein Mönchlein aus der Stadt, das dort wohl übernachtet hatte und nun in sein Kloster zurückkehren wollte. Es hielt indes nur kurze Zeit Schritt mit den rüstig ausgreifenden Rossen, und sie waren allein. Noch lag der Schatten des frühen Morgens mit seiner Kühle auf der Straße, und ein Frösteln überflog ihre Glieder. Aber munter ging es weiter.
»Du sinnst wohl noch über den Abschied von der lieblichen Gisela nach?« unterbrach Gottfried das Schweigen. Doch Johannes verspürte keine Neigung auf den scherzhaften Ton einzugehen. »Laß die Geschichte; Du tust mir weh mit dieser Art davon zu sprechen.« Da brach Gottfried das Gespräch ab, und sie ritten schweigend fürbaß. Auch Heinrich Achtermann zog wider seine sonstige Gewohnheit mürrisch und wortkarg dahin.
[S. 31]
Noch war nichts Lebendes auf der Straße zu sehen. Doch jetzt blitzte es im Morgennebel vor ihnen, und trapp, trapp, trapp kam es zu ihnen heran. Es waren Speerreiter des Podesta von Bologna, die ein paar armselige Lumpen mit sich führten. Auf einer nächtlichen Streife im Banngebiet der Stadt auf frischer Tat ertappt, trabten sie jetzt trübselig hinter den Pferden drein, an deren Schweif sie kurzerhand gebunden waren. Auch andere Frühaufsteher tauchten bald auf der Straße auf, Landleute, die ihr Geschäft in die Stadt führte, Bauern mit Ochsenkarren, welche Getreide und sonstige Früchte den Kaufleuten in Bologna bringen wollten, junge, rüstige Dirnen und alte Weiber, die Melonen und andere Früchte heimischen Fleißes am selben Ziel in Geld umzusetzen hofften.
Inzwischen war die Sonne hervorgebrochen und übergoß Land und Straße mit ihren wärmenden Strahlen.
Langes Schweigen war wider die Natur des lebhaften Gottfried.
»Wißt ihr übrigens, daß wir in unserm Stumpfsinn auf geschichtsschwangerem Boden dahinreiten? Hier erklang schon vor anderthalbtausend Jahren der eherne Tritt römischer Legionen, die auf Eroberung auszogen, und wieder um ein beträchtliches später zogen in umgekehrter Richtung die Gewappneten der deutschen Kaiser sie entlang, um in das Land Italia einzudringen?«
Die lachende Septembersonne verscheuchte auch die Grübeleien, in die Johannes versunken war, und die jugendliche Hoffnungsfreudigkeit siegte über die Zweifel, die sich ihm aufgedrängt hatten: Es würde doch alles gut werden, wie er es selbst gestern Gisela gesagt hatte. Und er konnte auf den fröhlichen Ton des Freundes eingehen.
[S. 32]
»Da kennst Du unsern guten Magister Sutor schlecht — den schlichten ›Schuster‹ vertrug seine Gelehrsamkeit schlecht, und wenn er uns einmal aus Unachtsamkeit oder Bosheit über die Lippen glitt, saß uns der Bakel schon auf dem Buckel. — Er hat uns haarklein den Weg gezeigt, den der große Cäsar mit seinen Heeren nahm, und die Tuben der Legionen des Varus hörten wir schon erklingen, wenn sie noch diesseits der Alpen, meinetwegen auf der alten Via Aemilia, ertönten, auf der wir jetzt selbst dahintraben. Ich wollte nur, ich hätte gleich ihnen erst die Alpen überschritten und zöge dem alten Goslar zu.«
Unterdes war die Sonne höher und höher gestiegen und sandte ihre Strahlen mit einer Glut auf die Reisenden herab, daß ihr Gespräch wieder versiegte. Auf den Feldern arbeiteten Bauern mit ihrem Ochsengespann, vor ihnen lag das weiße, schattenlose Band der Straße, auf der sich kaum ein Lebewesen zeigte, denn alles floh vor der sengenden Hitze.
Die Freunde hatten sich als Ziel des Tages Parma gesetzt; aber als sie Modena, etwa halbwegs zwischen Bologna und Parma, gegen Mittag erreichten, fühlten sie doch, daß sie gut täten, den Pferden, wie sich selbst nicht noch eine gleich große Wegstrecke zuzumuten, und sie blieben dort bis zum nächsten Morgen. Nach zwei weiteren, gleich ermüdenden Tagereisen trafen sie in Piacenza, der alten Brückenstadt am Po, ein, wo ihre letzte Raststätte vor Mailand sein sollte.
In Piacenza erfuhren sie in der Herberge von deutschen Landsleuten, die von Genua angekommen waren, daß der Kaufherr Ernesti tags zuvor hier eingetroffen, aber schon nach Mailand vorausgeeilt sei, weil er dort noch Geschäfte zu erledigen habe.
[S. 33]
Unterwegs schon hatte Gottfried nach diesem Ernesti gefragt, aber Heinrich wie Johannes vermochten ihm keinen Aufschluß über den seltsamen Mann zu geben, der als einfacher Kaufmann mit den Mächtigsten der Erde verhandelte, wie es sonst nur die Aufgabe kaiserlicher Ambassaden war. Wohl hatten sie in Goslar den Namen des Mannes aussprechen hören, doch nach Art der Jugend kümmerten sie sich wenig um Dinge, die sie und ihre Jahre nicht berührten. Beide, besonders Heinrich, fesselten viel mehr, da sie noch in der Münsterschule zu Goslar saßen und unter dem Joch des gestrengen Magisters Sutor seufzten, die Spiele mit den Altersgenossen und die Reigen mit den hübschen Goslarer Bürgermädchen, besonders der Lange Tanz, ein Reigen aus alter Zeit, welcher der Sage nach die immerwährenden Kämpfe zwischen den einheimischen Sachsen und den zugewanderten fränkischen Bergleuten beendet hatte. Alljährlich zur Fastnachtszeit fand er statt, und selbst ein hochweiser und gestrenger Rat sah dem lustigen Treiben wohlgefällig zu, das sich vor seinen Augen abspielte in dem anmutigen Schreiten und Sichneigen und Hüpfen lieblicher Jungfräulein und kühnstolzer Jünglinge, die jene geleiteten.
Man konnte also die Wißbegier des Freundes hinsichtlich Ernestis nicht befriedigen. Auch das, was die mitreisenden Kaufleute nächsten Tages auf der Reise von Piacenza nach Mailand über ihn zu sagen wußten, ließ noch vieles an diesem Manne im dunklen. Daß er ein seltsamer Mensch sei, erhellte zur Genüge aus ihren Worten, aber auch, daß er weltbefahren und über das gewöhnliche Maß hinaus angesehen und mächtig sein müsse, blieb demnach nicht zweifelhaft. Seine Beziehungen reichten von Italien bis Frankreich, und er war in den Handelsplätzen der Niederlande[S. 34] gleich bekannt wie in der berühmten Stadt Nowgorod am Ilmensee im fernen Reiche der reußischen Zaren.
Daß Ernesti in besonders wichtiger Mission vom Rate der Stadt Goslar zur Päpstlichen Kurie in Rom entsandt worden war, wußten sie aus dem Briefe von daheim. Heinrich ließ darüber den Kaufleuten gegenüber nichts verlauten, da er nicht wußte, ob das der Sache dienlich war, und Johannes schwieg ebenso selbstverständlich. Die Kaufherren erzählten, daß Ernesti als Heimweg von Rom nicht den Weg über die Abruzzen gewählt habe, wiewohl dieser der kürzere war, sondern in einem kleinen Küstenklipper nach Genua gefahren sei, um dort im Dogenpalast noch etwas zu erledigen. — Fürwahr, ein seltsamer, geheimnisvoller Mann, dieser Ernesti, dachte auch Johannes, dessen Gedanken sich allmählich mehr und mehr mit ihm beschäftigten, dem die Sache seiner Vaterstadt anvertraut war und mit dem ihn das Leben wahrscheinlich auch künftig noch mehr als einmal zusammenbringen würde, wenn er erst, wozu seine Studien den Weg bereitet hatten und was sein Vater sehnlich wünschte, im Rate der Stadt Goslar Sitz und Stimme hätte.
Der Wagenzug war durch ein Hindernis ins Stocken geraten. Während die Knechte unter der Aufsicht der Kaufherren noch mit der Beseitigung des Hindernisses beschäftigt waren, ritt Johannes mit den Freunden langsam voraus. Noch klangen in seinen Ohren die Worte der Mitreisenden über Ernesti wieder, aber seine Gedanken blieben an der alten, wehrhaften Stadt am Harz haften, die jenen gesandt hatte und durch ihn selbst von dem Ausfalle des Auftrages Kunde erhalten würde. Wie mochte es dort aussehen, was die Freunde und Gespielinnen treiben, von denen er nun schon manches Jahr fern weilte; denn auch vor den Jahren,[S. 35] die er in Bologna verlebte, sah ihn die Heimat nur selten, wenn er in den Ferien von der Universität Wittenberg zu Besuch kam. Die seltenen Briefe der Eltern gaben nur unvollkommen Auskunft über das, was gerade ihn interessierte.
Sollte Heinrich die Wahrheit sagen, so war er von Ernesti enttäuscht, als er ihn zum ersten Male im »Leuen« zu Mailand sah, und Johannes schien dieselben Empfindungen zu haben. Der Fremde entsprach in seinem Äußern durchaus nicht der Gestalt, die der junge Goslarer sich von ihm gebildet hatte. Ein Mann von der Bedeutung Ernestis müsse, so glaubte jener, neben der ragenden, gebietenden Größe, dem kühnen, entschlossenen Gesicht, auch in Wort und Ton die Macht zum Ausdruck bringen, die ihm eigne. Und nun trat ihm ein Mensch entgegen, der von alledem wenig oder gar nichts an sich trug. Schon am Abend der Ankunft in Mailand bekamen sie ihn zu Gesicht. Ein etwas mürrischer, wie es schien, sehr verschlossener Mann kam herein. Von Gestalt war er nicht mehr als mittelgroß; in dem fast alltäglichen Gesichte verriet nur das Spiel der beweglichen, ein wenig stechenden Augen den Reichtum der Gedanken, die sich hinter der hohen, kahlen Stirn bergen und kreuzen mochten.
Ernesti wandte sich alsbald mit einigen freundlichen, gleichgültigen Worten an die jungen Leute. Auf den Hauptzweck ihres Zusammentreffens hier ging er nur mit einer kurzen Bemerkung ein.
»Es tut mir leid, daß ihr die Beschwerden der Reise in[S. 36] höherem Maße auf euch nehmen müßt, als ohne den euch gewordenen Auftrag nötig wäre. Aber ich selbst kann die Botschaft an den Rat eurer Vaterstadt nicht persönlich überbringen, und sie verlangt eine zuverlässige Hand. Ich bin überzeugt, daß er keine besseren Boten hätte finden können, und ihr werdet euch des Vertrauens würdig erzeigen, das der Hochmögende Rat euch bei eurer Jugend bezeugt. In Köln werde ich euch das Schriftstück aushändigen. Ich hoffe, daß man in Goslar mit dem Inhalte wohl zufrieden sein wird. Von Köln ab habt ihr Gelegenheit, mit einem Zuge flandrischer Kaufleute, die nach Goslar wollen, um euer berühmtes Kupfer zu holen, die Weiterreise fortzusetzen.«
Das hieß mit anderen Worten, sie, Heinrich und Johannes, durften das wichtige Schriftstück unter den Augen und dem Schutz anderer tragen, von dem Inhalte erfuhren sie nichts. Einen Augenblick wollte etwas wie Unmut in Heinrich aufsteigen, aber schnell überwand er die Anwandlung, zumal in diesem Augenblick sein Freund Gottfried die Runde an seinem Tische mit einem Scherze zu lustigem Gelächter verleitete.
Am frühen Morgen des nächsten Tages ging die Reise nordwärts bis an das Südufer des Langen Sees, den man in einem der plumpen Schiffe hinauffuhr. Hier trat den Reisenden zuerst wieder die Majestät der Alpen vor Augen, namentlich im nördlichen Teil des Sees, wo die Felsenberge in jähem Absturz den engen See fast erdrücken durch ihre Wucht. Aus der Ferne dräute in ernstem Weiß der schimmernde Monte Leone, der nach dieser Seite hin die Vorhut bildet der noch gewaltigeren Monte-Rosa-Gruppe und all der anderen Riesen der Walliser Berge. In Locarno herrschte[S. 37] noch die fast sommerliche Glut des italienischen Frühherbstes. An der Straße ungeschützt die Palmen. Aus den laubdunklen Weingehegen lockten die schwellenden Trauben: »Nimm mich, nimm mich!« Doch die Reisenden hatten nicht Zeit, die Herrlichkeiten zu genießen, die ihnen das lachende Seegestade darbot. Noch einmal wurden die Warenballen auf plumpe Karren geladen. Aber das immer enger werdende Tessintal, in welchem die Fahrzeuge dahinrumpelten, setzte dieser Art von Beförderung bald ein Ende. Bis Biasca mühten sich die Zugtiere noch ab, die Wagen auf der holperigen, oft von tiefen Schründen durchsetzten Straße, die doch keine solche war, dahinzuzerren. Dann mußte man endgültig zu den Saumtieren seine Zuflucht nehmen.
Auch die menschlichen Siedlungen blieben immer mehr zurück und verschwanden von der Wegseite. Hatten bis dahin die Augen an den auf jähem Felsen wie ein Adlerhorst gebauten Schlössern und Burgen und den einsamen Kirchlein, die in gleich trutziger Lage von dem frommen Sinn des Erbauers zeugten, sich geweidet, so wurde nunmehr der Weg nur noch von kahlen Felsen begleitet, die in grausigem Absturz das enge Tal zu begraben drohten. Hier und da gab ein schmales Seitental den Einblick in eine gleich furchtbare Einsamkeit frei. Nur einmal noch traf das Auge der Reisenden auf menschliche Wesen, unweit Airolo, wo das wilde Val Tremola, das ›Tal des Zitterns‹, den Weg freigibt zum Aufstieg auf den St. Gotthardt. Es war ein Bild, das Johannes lange nicht vergessen konnte: Unter dem lärmenden Zuruf der welschen Treiber kletterten die Saumrosse das Tal empor. Da hockten am Wegesrande einige zerlumpte Gestalten, unter ihnen ein Mädchen von madonnenhafter Schönheit. Die Gesichter mehrerer von ihnen waren[S. 38] mit Lappen maskenartig verhüllt, nur die schwarzen Augen funkelten durch Löcher, welche in jene Lappen geschnitten waren. Von dem Rauschen des Gebirgsflusses halbverschlungen klang ihr klägliches »prego, prego« Johannes entgegen, der ein wenig der Karawane vorausritt. Doch schon eilten die welschen Treiber mit drohend geschwungenen Knütteln herbei und verscheuchten die Ärmsten in das nahe Seitental, aus dem sie gekommen sind und in dem sie, fernab von allen anderen menschlichen Wesen, sich vor ihren Mitmenschen bergen und einsam dem Tode entgegensiechen mochten. Ehe Johannes dazu gekommen war, ihnen eine Gabe zuzuwerfen, waren sie schon ein Ende zur Seite gewichen. »Leprosi, Leprosi«, heulten die Treiber noch immer, als ob es gälte, wilde Bestien zu verscheuchen. Die Aussätzigen hasteten weiter; aber Johannes fing noch einen Blick des schönen Mädchens auf, so voller Schmerz und Verzweiflung, daß er den Gedanken an das erschütternde Bild den ganzen Tag nicht los wurde. Er sah an ihrer Stelle Gisela, verlassen, verfolgt, dem Elend preisgegeben, und tiefstes Mitleid durchschnitt ihm das Herz.
Über die Paßhöhe, das Urserntal hinab auf der Nordseite, wo die junge Reuß ihre Kinderstube hat und längs des Saumpfades gischtet und tobt, und dann stetig ihr folgend, stieg man hinab bis dahin, wo in der Talsohle das flammende Rot der Edelkastanien das große Sterben in der Natur ankündete. Über den Vierwaldstätter See brachte sie eine der großen, sturm- und wettererprobten Nauen gen Luzern, und weiter ging die Fahrt bis an den grünen Rhein, den man bei der alten Handelsstadt Basel zuerst zu Gesicht bekam, aber nicht überschritt; denn die Fahrt ging ins Elsaß hinein, geradewegs auf das alte Straßburg zu.
[S. 39]
Gottfried Kristaller hatte recht prophezeit, als er in Bologna verhieß, Freund Heinrich werde über den schönen Augen der Straßburgerinnen den alten Schmerz vergessen. Im lustigen Geplauder mit Gottfrieds Schwester und ihren Freundinnen schwand der letzte Unmut aus seinem Herzen. Der neue Tag fand ihn schon völlig eingebürgert in der neuen Umgebung, und als man am Morgen des dritten Tages von dannen zog, war der Abschied so warm und lebhaft, als ob eine alte Freundschaft ihre erste Trennung erfahre. Johannes hielt die Hand Gottfrieds lange in der seinen. Er war kein Mann überschwenglicher Gefühlsäußerungen, aber wer seine Freundschaft erworben hatte, der konnte für immer auf ihn zählen, und Gottfried war ihm ein Freund geworden in Bologna trotz aller äußeren und inneren Verschiedenheiten.
Nun ging die Fahrt zu Schiff den Rhein hinab im breiten Graben der Oberrheinischen Tiefebene mit seiner melancholischen Weite. Sie bot wenig Kurzweil; denn die Reihen der Kaufleute war in Luzern wie in Basel und Straßburg bedenklich gelichtet worden, und die übriggebliebenen, die vom Niederrhein und aus Westfalen, hatten mit ihren eigenen Angelegenheiten so viel zu tun, daß sie sich um die beiden Goslarer wenig kümmerten. Um so mehr war es anzuerkennen, daß Herr Ernesti sich ihnen mehr zuwandte als bisher. Er hatte die drei Gesellen auf der Reise von Mailand her im Auge behalten und sie nach ihrer Eigenart zu bewerten Gelegenheit gehabt. So war es ihm nicht zweifelhaft, daß der Stetigere, Zuverlässigere Johannes Hardt sei. An ihn waren daher auch im Anfang zumeist seine Worte gerichtet. Heinrich Achtermann war darob nicht böse; denn der Gesprächsstoff nahm ihn, der gewohnt war, in seiner Umwelt zu leben, nicht immer gefangen. So kam es, daß[S. 40] sich zwischen dem berühmten Kaufherrn und Agenten und Johannes ein Verhältnis anbahnte, das mit jedem Tage freundschaftlicher wurde. Diesem gegenüber ließ Ernesti seine sonstige Zurückhaltung fallen und sprach mit ihm über seine Reisen und Erfahrungen.
Auch den Mitreisenden fiel der enge Verkehr zwischen den beiden auf, und sie gaben wohl gelegentlich ihrer Verwunderung Ausdruck. »Euer Freund muß es ja dem Ernesti angetan haben, daß er so gegen seine Gewohnheit redselig wird. Was besprechen denn die beiden nur immer?« Heinrich bemerkte wohl, daß unbefriedigte Neugier aus ihren Worten klang, und er gab nur eine allgemeine Antwort: »Das weiß ich ebensowenig wie Ihr, denn Ihr seht ja, daß ich mich wenig daran beteilige. Der Stoff ist mir zu langweilig.«
Aber das änderte sich doch, als sich das Gespräch mehr und mehr Goslar zuwandte. Ernesti selbst regte diesen Gegenstand immer wieder an, und so konnte sich Heinrich nicht enthalten, etwas neugierig und ungeschickt zu fragen:
»Weshalb verfiel der Rat von Goslar gerade auf Euch mit der wichtigen Sendung nach Rom? Ich sollte meinen, es hätte sich doch auch unter den Bürgern der Stadt jemand finden lassen, der sich der Aufgabe unterzogen hätte?«
»Daß er jemand gefunden hätte, bezweifle ich nicht«, erwiderte Ernesti mit einem leichten Lächeln. »Ob er aber auch Erfolg gehabt hätte, ist eine andere Sache. Euer Rat wird sicher gewußt haben, weshalb er mich wählte und nicht einen anderen. In Rom ist es mit dem Reden nicht allein getan. Man muß zugleich alle Sinne angespannt halten, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Das unscheinbarste Wort will auf seinen besonderen Wert hin gedeutet, die harmloseste Miene auf ihre versteckte Bedeutung hin geprüft[S. 41] und beobachtet sein. Ich bin im Verkehr mit den Großen der Erde, wie Euch die Schwätzer und Neider unter meinen Gefährten gewiß schon zugeraunt haben, nicht gerade unbeholfen; aber über jeden kleinsten Erfolg, den ich im Lateran davontrage, bin ich doppelt froh, und erkenne ich nachher, daß er nicht zu teuer erkauft, um ein Mehrfaches. Bei dem Auftrage, den ich für Goslar auszurichten hatte, will mir das scheinen, und ich gestehe Euch, daß mich das besonders freut.«
»So gestattet auch mir eine Frage, Herr Ernesti«, fügte Johannes hinzu. »Weshalb nehmt Ihr an Goslar dieses besondere Interesse? Soviel ich weiß, verbinden Euch doch nicht besondere Bande mit meiner Heimatstadt!«
»Gewiß,« entgegnete Ernesti, »ich verstehe Eure Verwunderung. Vielleicht raunte man Euch auch zu, ich täte es um des blanken Goldes willen.« Johannes wehrte ab, doch jener fuhr unbeirrt fort: »Ihr braucht weder Euch noch jene zu verteidigen; denn natürlich erhalte ich von Eurem Rat eine angemessene Entschädigung, wenn auch in anderer Art, als Euch vorschwebt. Derartige kostspielige und nicht ungefährliche Aufträge übernimmt ein guter Kaufmann und Familienvater nicht um bloßen Gotteslohn. Aber ich würde mich doch bedacht haben, nach Rom zu reisen, wenn ich nicht für Goslar ein absonderliches Interesse hegte. Ihr seid schon zu lange von Goslar fort und seitdem nicht oft wieder dort gewesen, um über meine Beziehungen zu Goslar unterrichtet zu sein. Ich bin in der Tat nicht selten dagewesen, auch als Ihr selbst noch dort weiltet; aber die Größe der Stadt — Ihr werdet Euch inzwischen ja selbst überzeugt haben, daß Goslar zu den ganz großen gehört — und Eure jugendliche Unbefangenheit hat mich Euch wohl verborgen gehalten.
[S. 42]
Ich komme gern nach Goslar und bedauere, daß es mir nicht vergönnt ist, die römische Botschaft persönlich zu überbringen; es wäre mir eine besondere Freude gewesen. Weshalb ich gern bei Euch weilte und weile? — Nun, einmal sind es verwandtschaftliche Beziehungen, die mich mit Goslar verbinden. Meine Vorfahren lebten bis auf den Großvater in Eurer Stadt. Das Geschlecht der von Ildehusen, das in der Geschichte Goslars nicht unrühmlich bekannt ist, gab uns den Ursprung, und wir haben mehr als einen Bürgermeister und Ratsmann gestellt, die am Aufbau Eurer mächtigen Vaterstadt mithalfen. Den Großvater verschlug das Schicksal nach der Stadt Soest am alten Hellweg. Übrigens haben wir noch heute nicht alle Beziehungen zu Goslar verloren. Mir lebt dort ein Vetter Richerdes, bei dem ich, weile ich im Harz, gern absteige.«
»Ist das etwa der ehemalige Ratsherr oder Sechsmanne Richerdes von der Gundemannstraße?« fragte Heinrich lebhaft. »Ganz recht«, lautete die Antwort. »Ei, so kennt Ihr ja auch die Venne Richerdes, meines Schwesterleins liebste Gespielin.« — »Und vielleicht auch Euch selbst nicht zuwider«, fiel ihm Ernesti lächelnd ins Wort. »Freilich kenne ich sie, ist's doch mein liebes Niftel, das ich selbst aus der Taufe gehoben habe, und über dessen prächtiges Gedeihen ich mich freue, wann immer ich sie sehe.«
»Da wundere ich mich nur um so mehr, daß ich Euch nie sah; freilich Euer Name fiel wohl auch aus dem Munde der Venne, aber ich gab des nicht acht.«
»Also liegt die Schuld immer wieder bei Euch; denn ich pflege nicht den Unsichtbaren zu spielen, wenn ich in Goslar bin. Doch Ihr hattet wohl Wichtigeres zu tun, als Euch um den fremden Mann zu kümmern. Und — Ihr seid mir noch[S. 43] die Antwort schuldig — was haltet Ihr selbst von der Venne?«
»Als ich Goslar verließ, verhieß sie, mit der Zeit vielleicht ein schönes Mädchen zu werden. Ich habe sie oft bei uns gesehen, und als Kinder haben wir auch bei ihnen, besonders in ihrem schönen Wallgarten, unsere Spiele getrieben. Ich fürchte nur, daß ich bei ihr nicht in dem Rufe unbedingter Ritterlichkeit stehe; denn wir Knaben waren arge Rangen, und die Mädchen, auch Venne, haben unser Ungestüm oft zu büßen gehabt. Von dem Abschied vollends wage ich gar nicht zu sprechen. Soll also Eure Frage ergründen, ob ich bei ihr in besonderer Gunst stehe, so kann ich das nur mit allem Vorbehalt zusagen.«
»Gut reserviert«, lobt der andere. »Ich sehe, Ihr habt Eure Studien nicht umsonst erledigt und werdet dermaleinst es verstehen, knifflige Fallen zu meiden. Auf jeden Fall darf ich Euch aber, da Ihr Goslar eher erreichen werdet als ich, bitten, den Richerdes meine Grüße auszurichten. Vielleicht nimmt Euch dann mein Niftel ob dieses Liebesdienstes wieder ganz zu Gnaden an.«
Dann kehrte man wieder zu ernsteren Dingen zurück. »Ihr fragtet mich nach dem Inhalt des Schreibens der römischen Kurie an den Rat zu Goslar. Glaubt mir, Ihr jungen Freunde, es ist nicht Geheimniskrämerei, die mir den Mund verschließt. Aber ich habe den Auftrag, Euch die Botschaft verschlossen zu übergeben, und ich weiß, daß es zu Eurem Besten ist, wenn Ihr ohne Kenntnis von dem Inhalte seid. Es sind überall Späher, auch um uns herum, und ein unvorsichtiges Wort könnte den ganzen Erfolg meiner Reise in Frage stellen; denn an der Auswirkung ist nicht Goslar allein interessiert.
[S. 44]
Ihr seid stolz auf die machtvolle Stellung eurer Stadt, mit Recht. Doch so viel werdet Ihr trotz Eurer Jugend auch schon gehört und gesehen haben, daß Goslars Glanz und Vormachtstellung mit dem Silber und Kupfer des Rammelsberges steht und fällt und daß als zweite unerläßliche Vorbedingung für ein weiteres Blühen Eures Gemeinwesens der ungestörte Besitz und die Nutzung der gewaltigen Forsten, welche Goslar umgeben, ist. Von dem ersteren, der Bedeutung des Bergwerks werdet Ihr in Köln aufs neue einen Beweis erhalten, wenn Ihr mit den flandrischen Kaufleuten zusammentrefft. Sie sind auf dem Wege zu Euch, um das ›keuvre de Gosselaire‹, das goslarsche Kupfer, zu holen, um es in den Kupferschlägereien zu Dinant und in den anderen Städten Flanderns und der Niederlande zu verwenden. Und kämet Ihr nach London oder gen Nowgorod im Reußenlande, so würdet Ihr dort den Namen ›Goslar‹ und ›goslarsches Silber oder Kupfer‹ mit derselben Geläufigkeit und Häufigkeit nennen hören. Euer Reichtum und Eure Macht sind aller Welt bekannt, es kennen ihn aber auch Eure Feinde und Neider, die Ihr zum Teil nicht weit zu suchen habt.
Es muß Eurem Rat nachgerühmt werden, daß er schon frühzeitig die Lage erkannt und danach zu handeln bestrebt gewesen ist. Schon unter König Wenzel, vor mehr als hundert Jahren, verstand es Goslar, sich eine Reihe von Gnadenbriefen zu verschaffen, welche der Stadt den Genuß ihrer Rechte auf Berg und Forst sicherten. Indes, wie Ihr wissen werdet, haben auch die Braunschweiger Herzöge verbriefte Rechte und Privilegien auf Berghoheit und den Zehnten. Zur Zeit sind diese Rechte nach dem Rate von Goslar verpfändet, und die ewige Geldnot der Herzöge[S. 45] hinderte sie bis jetzt, den Pfandschilling zu erstatten, aber laßt sie nur zu Atem kommen und den Appetit sich regen, dann wird sich's bald ändern. Ich fürchte, ich fürchte, die Anzeichen dazu sind schon wahrzunehmen.
Damals, als die Braunschweiger das Geld nahmen, wäre es ein leichtes gewesen, ihnen ihre Rechte um ein billiges abzukaufen, statt sie in Pfand zu nehmen; denn damals stand es schlecht um den Bergbau: Wassereinbrüche, deren man nicht Herr werden konnte, leere Erzgänge ließen das Ganze als wertlos erscheinen in den Augen Uneingeweihter. Damals war es Zeit zum Zugriff, damals mußte Goslar das Ganze an sich bringen, statt Pfandschillinge zu nehmen und eine Gewerkschaft zu gründen mit Bürgern und fremden Herren. Nun rächt sich die Versäumnis nach jeder Richtung hin.
Ihr habt einmal einen großen Mann gehabt, der die Aufgabe Eurer Stadt richtig erkannte. Hermann Werenberg hieß er und war Stadtkanzler; Ihr werdet seinen Namen gehört haben. Glaubt mir, er war einer der ganz Großen in der Geschichte Eurer Stadt. Was Goslar heute ist, verdankt es in erster Linie diesem Manne. Er bewies eine Staatskunst, die ihn auch befähigt hätte, ein größeres Staatswesen, als es Eure kleine Stadtrepublik ist, auf die Höhe irdischer Macht zu bringen und dort zu erhalten. Daß er dabei, wieder nach Art der wirklich Großen, alle Mittel nutzte, um die Gerechtsame auf Berg und Forst in den Besitz der Stadt zu bringen, wird ihm nur der kleine Geist als Schuld anrechnen.
Die Bahn war frei, aber Werenbergs Leben ward ein Ziel gesetzt, ehe der Erfolg im ganzen Umfange gesichert war. Er starb, und seine Nachfolger verstanden nicht, das[S. 46] Erworbene festzuhalten und auszubauen. Sie hätten die geldhungrigen Herzöge von Braunschweig abfinden, die Gewerken, unter denen das Kloster Walkenried und das reiche Domstift Simon und Juda in Goslar selbst zu nennen sind, aufkaufen sollen, ehe das Bergwerk wieder das wurde, was es war und jetzt ist: eine ungeheure Goldgrube für den, der es besitzt. Jetzt ist's zu spät, will mir scheinen. Niemand wird noch seine Rechte an die Schatzkammer aufgeben wollen, zu der er einen Schlüssel in der Hand hat, weder Kloster, noch Fürst, noch Bürger; denn auch diese sitzen unter den Gewerken noch heute. Es mag von geringem Sinn für das Wohl des Ganzen zeugen, daß sie sich sperren, ihre Rechte in die Hand des Rates zu geben, aber es ist so. Mein eigener Vetter, der Sechsmanne Richerdes, zählt ja auch zu ihnen.
Es ist zu spät, sage ich; denn wenn schon die eigenen Bürger nicht von Euch veranlaßt werden können, ihren Eigennutz hinter das gemeine Wohl zu stellen, so habt Ihr von den Fürsten erst recht nichts Gutes zu erwarten. Wenn mich die Anzeichen nicht trügen, rüstet man im Schlosse zu Wolfenbüttel bereits zu entscheidenden Schritten. Den Pfandschilling aufzubringen, wird ihnen nicht schwer fallen, denn es sitzen der Geldgeber genug in deutschen Landen, die auf ein so gutes Unterpfand hin gern helfen werden. Dann hat Goslars Schicksalsstunde geschlagen.«
Die Gesichter der Zuhörer verdüsterten sich unter den Worten Ernestis sorgenvoll. So hatten sie allerdings das Geschick der Heimat nicht gewertet, und so schien es auch niemand daheim einzuschätzen, alles war auf Freude und Stolz an der Blüte eingestellt.
»Ich sehe,« fuhr der andere fort, »daß Ihr bekümmert[S. 47] seid; aber es tut nicht gut, mit verbundenen Augen in das Leben einzutreten. Doch ich will Euch auch nicht ohne Trost lassen. Wie sehr und weshalb ich an Goslar hänge, ist Euch bekannt, und was ich tun kann, um das Unheil abzuwenden, wird geschehen. Mein Einfluß reicht weit, wie Ihr selbst schon gemerkt habt. Holte ich Hilfe aus Rom für Euch, so werde ich auch in der Nähe nützen können. Der Himmel hat dafür gesorgt, daß auch der Stolz der Herzöge nicht zu sehr ins Kraut schießt. Ihre liebe Stadt Braunschweig macht ihnen viel zu schaffen und wird, faßt man es richtig an, Euch von größtem Nutzen sein. Aber in einem könnt Ihr, das sage ich noch einmal, Euch nur allein helfen, das sind die Zustände in Goslar selbst.
Will man sich des Besitzes einer Sache ungestört erfreuen, so darf sie nicht der Gegenstand des Neides anderer sein, wie ich Euch schon sagte. Man muß sie im Urteil der Neidlustigen als minder begehrenswert hinzustellen verstehen oder die Zeitläufte benutzen, um die Aufmerksamkeit von ihr abzulenken. Beides haben die Goslarer vormals nicht versäumt. Als die große Bewegung der Kreuzzüge die Massen durchzitterte und aller Augen nach dem Morgenlande gerichtet waren, hat Goslar seine Position Schritt um Schritt verstärkt. Als dann die öffentliche Meinung vom Bergwerke als einer verlorenen Sache sprach, brachten sie die Gerechtsame des Berges an sich. Sehr schön, aber die Nachfahren haben nicht zu nutzen verstanden, was die Väter schufen. Jetzt ist's umgekehrt wie ehedem: Der Nachbar sieht dem Nächsten auf den Bissen, die Großen beneiden die Größten, und der Kleinen Begehr steht nach dem, worauf die Großen überlaut und unvorsichtig als ihr Eigen pochen.
[S. 48]
Erst waren es die Gilden. Nachdem sich Gevatter Schneider und Handschuhmacher durch das Aufblühen der Stadt den Beutel gefüllt hatten, kam ihnen auch der Machtkitzel, und sie wollten mitregieren, ob sie es auch nicht verstanden. Nun regieren sie mit, daß es Gott erbarme. Und schon regt sich's abermalen machtlüstern und beutegierig. Was dem Handwerker gelang, ließ auch die Masse des gemeinen Volkes nicht ruhen. Kommt sie zur Macht, dann gnade Gott Euch Goslarern, wie allen denen, wo die Plebs ihr Haupt siegreich erhebt. Videant consules! — der Rat mag sehen, daß er Herr der Lage bleibt. Reicht er der unvernünftigen Masse den kleinen Finger, so ist es um die ganze Hand geschehen. Mit dem Volke ist es wie mit den Kindern: Was das Kind hat, dünkt ihm nichts, sieht es in anderer Hand etwas, das es selbst nicht besitzt. Man gebe ihm, worauf es vernünftigerweise ein Recht hat, sonst ein hartes ›Nein‹. Euch fehlt ein Werenberg. Der würde wissen, was den Kindern, will heißen der Masse, frommt und was man ihnen geben darf, ohne daß sie sich den Magen überladen und das Gemeinwohl zu Schaden kommt.«
Das Schiff bog in den Rheingau ein. In der Ferne tauchten die Kuppeln und Türme des heiligen Mainz auf, übergossen von dem goldigen Glast der Abendsonne. Johannes stand an die Verschanzung gelehnt und nahm das glänzende Bild in sich auf, das mählich aus den Fluten des Rheins, wie es schien, aufstieg. Bald legte das Fahrzeug an, und das geschäftige Leben, das mit der Ankunft eines jeden Schiffes verbunden ist, riß die Reisenden auseinander.
Wieder hatte sich die Zahl der Kaufleute gelichtet. Dafür fand sich allerlei anderes Volk ein, Niedere wie Vornehme.[S. 49] Auch ein paar Domherren waren darunter, die nach Köln wollten. Ernesti stand im Gespräch mit ihnen.
»Ihr seht,« flüsterte einer der alten Bekannten Heinrich zu, »Euer Gönner hält es allerorten und immer mit dem Krummstab. Möchte wohl wissen, was er alles an geheimen Gängen hinter sich hat, die wenigen Stunden, die wir in Mainz waren und während wir uns einen ehrlichen Trunk gönnten.«
Eine Antwort wurde nicht erwartet, und Heinrich hätte sie auch nicht gefunden, denn ein abfälliges Wort über den Mann zu sagen, der ihnen so viel gegeben hatte, wäre ihm als schwarzer Undank vorgekommen. Übrigens kam Ernesti in gewisser Weise selbst darauf zurück; er hatte wohl gesehen, daß man über ihn sprach.
»Ich hatte mit der Erzbischöflichen Kurie zu tun, in nicht unwichtigen Fragen, wie Ihr Euch denken mögt. Mancher meint vielleicht, es sei mir bei den vielerlei politischen Dingen, die durch mich Erledigung oder Förderung finden, um das blanke Gold zu tun; ich lasse ihn reden, wie seine Mitschwätzer. Eins aber sei Euch beiden als Erinnerung an Mainz mit auf den Weg gegeben, und das sei die dritte und letzte der langatmigen Mahnungen, die ich Euch gab: Verderbt es in Goslar nicht ernstlich mit der Kirche.
Wir leben in einer unruhvollen Zeit: Kampfstimmung überall, wohin Ihr blickt, und nicht nur auf dem Gebiete weltlicher Machtkonflikte, auch die Kirche, die Religion ist davon betroffen, und es sind dunkle Kräfte am Werk, um ihre Grundpfeiler zu stürzen. Ich bin ein treuer Sohn der Kirche. Das hindert mich nicht, die ernsten Schäden zu erkennen, die ihr anhaften und wie böse Geschwüre an ihrer besten Kraft zehren. Das Schisma, die Spaltung in der[S. 50] Nachfolge Petri, hat den Boden bereitet, auf dem Blasphemie und Abtrünnigkeit ihre giftigen Blüten treiben können; die Völlerei und Zuchtlosigkeit in den Klöstern und unter dem Klerus haben gleicherweise dabei mitgeholfen. So finden die falschen Apostel gläubige Ohren, wo immer sie ihr Unkraut unter die Menge werfen. Auch in Niedersachsen blüht ihr Weizen, wie ich höre. Doch die Kirche ist zu fest gegründet, als daß sie nicht der Widerwärtigkeiten und Widerspenstigen Herr werden wird. Denn ihre Sache ist gut, und der Brunnen nur verunreinigt, der die ewigen Heilswahrheiten birgt. Aber nicht der Eifer des Zeloten und nicht der unreine Mund des Hetzers wird die Gesundung bringen, sondern die stetige, von echter Frömmigkeit und Liebe zur Mutter Kirche getragene Sorge, daß das Gefäß nicht zertrümmert werde, das so kostbaren Inhalt birgt. Die Kirche wird über alle Fährlichkeiten hinwegschreiten, weil sie siegen muß. Dann aber wehe denen, durch die Ärgernis gekommen ist; wehe auch den Städten, die als ungehorsame Töchter sich erwiesen, ihr Unglück ist besiegelt!
Auch bei Euch in Goslar werden die Schwarmgeister am Werke sein. Störet ihre Arbeit, wo und wie Ihr könnt; es ist zum Frommen der Stadt. Ihr habt der Feinde und Neider schon genug, ladet Euch nicht auch noch die Abgunst der Kirche auf; Ihr würdet sie nicht tragen können.«
»Ich fürchte, daß Ihr nur zu recht habt mit allem, was Ihr betreffs unserer Stadt sagtet«, antwortete Johannes dem Vielerfahrenen. »Sicher trefft Ihr ins Schwarze mit der Vermutung, daß Goslar selbst zuletzt den Schaden wird zu bezahlen haben. Die Klöster daheim, vornehmlich das reiche und mächtige Domstift, sind der Stadt schon sehr[S. 51] gram, weil der Rat manche ihrer Privilegien kürzte. Das Sankt-Jürgen-Kloster, wie die Chorherren des Petersstiftes liegen dem Bischof von Hildesheim seit langem in den Ohren ob angeblicher Mißachtung und Verletzung ihrer Rechte und respektwidriger Verunglimpfung durch die Bürger. Der Bischof selbst ist uns gram wegen unseres Verhaltens in der Stiftsfehde, die Euch bekannt sein wird. Fänden alle diese Mißgünstigen sich zusammen, diese offenen und geheimen Gegner, und einigten sie sich mit den Herzögen, die uns jetzt schon zwicken und zwacken, wo sie können, so wäre der Anfang vom Ende gekommen. Eure Mahnungen treffen also keine tauben Ohren. Auch der Vater sprach wohl schon mit mir über diese Dinge. Wir werden tun, was unsere Jugend zu leisten vermag, davon seid überzeugt, wie auch von der Aufrichtigkeit unseres Dankes für Euren freundlichen und weisen Rat.«
Kalte Oktoberstürme brausten das Tal des Rheins entlang und drängten die Wellen zuhauf, als wollten sie umkehren von dem Wege, den der ihnen innewohnende Drang nach dem Meere vorschrieb. Die Wälder an den Berghängen wurden des letzten Blättchens beraubt, das ihnen noch geblieben war von dem sommerlichen Festgewande; alles wies auf Tod und Sterben und Ruhe in der Natur. Langsam glitt das Schiff zu Tal. Man hoffte, vor Einbruch der Nacht noch in Köln zu sein; aber fast schien es, als solle man noch eine Nacht auf dem unwirtlichen Flusse verbringen. Da gab endlich eine letzte Biegung den Blick auf die alte Stadt mit ihren unzähligen Türmen und Zinnen frei. Sankt Severin, Sankt Georg, Sankt Maria im Kapitol, Sankt Gereon, so tauchten sie aus dem Grau des Abendhimmels auf, überragt von dem gewaltigen Bau des Doms,[S. 52] der mit den ungefügen Stümpfen seiner Türme wie ein gefesselter Riese die Hände gen Himmel hob.
Dann kam der Abschied von Ernesti. Wie hatte sich das Verhältnis zu dem fremden Manne seit der Abreise von Straßburg geändert! — Der ernste, zurückhaltende Mann war ihnen nahegerückt, als sei es ein lieber Verwandter. In schier väterlicher Weise hatte er die Jünglinge an die Hand genommen und in die Tiefen des politischen Lebens blicken lassen, die ihnen ohne diese Hilfe gewiß erst viel später und mit schmerzlichen Erfahrungen sich erschlossen hätten. Sie bereuten es nicht, den Umweg über den Gotthardt gemacht zu haben. Der Händedruck, der den Abschied besiegelte, trennte Freunde. Sorglich vermittelte Ernesti noch die Bekanntschaft mit dem Führer der flandrischen Händler, mit denen Heinrich und Johannes in die Heimat reisen sollten.
[S. 53]
»Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube!«
Kriege laß die andern führen; du, glückliches Österreich, freie!
Ein gewaltiges Gebäude war durch die Heiratspolitik der Habsburger im 15. Jahrhundert aufgeführt worden, das noch ungeheuerlicher wurde durch die Entdeckung Amerikas. Die Krone von fünfzehn Ländern ließ der alternde Kaiser Maximilian, der ›Letzte Ritter‹, für die Häupter seiner Enkel Karl und Ferdinand zurück. Doch in diesem Hause wohnte nicht Glück und Eintracht beieinander, sondern Unfriede und Haß wucherten überall wie üppige Giftblumen. Die Kirche war auf dem besten Wege, den Rest ihres Ansehens zu verlieren. Sie trug selbst die Schuld daran, aber es kam damit einer der Grundpfeiler aller bestehenden Ordnung ins Wanken. Daß durch diese Ordnung der Dinge sich alles in eine völlige Unordnung verkehrt hatte, war nur zu einem kleinen Teile der Kirche als Schuld beizumessen. Ein Teil der Deutschen fühlte sich bei diesem Zustande durchaus wohl, die Masse aber war in Elend versunken und suchte sich, dem Ertrinkenden gleich, durch gewaltsame Anstrengungen das Leben zu erhalten.
Im Gegensatz zu Westeuropa war in Deutschland eine Vielzahl von kleinen Machtzentren entstanden. Der Fürstentümer, Grafschaften und Herrschaften war Legion, nicht zu rechnen die Freien Reichsstädte, die hinter ihren trutzigen Mauern und festen Toren ungestört ihrem Handel und Wandel nachgingen, Reichtum und Macht aufhäuften und[S. 54] sich um Kaiser und Reich, um Fürsten und Große nur kümmerten, wenn es ihre Belange forderten. Alle diese waren sich, die Großen wie die Kleinen, in einem gleich: in dem Bestreben nämlich, die eigene Machtfülle zu mehren, um die eigene Person mit Schimmer und Glanz zu umgeben.
In den Städten lag die Herrschaft mit der Sicherheit des Erbes in der Hand weniger Familien. Der Handwerker, in zielstrebigen Gilden vereinigt, hatte Zeit gehabt, Kisten und Kasten zu füllen. Nun waren sie auf dem Wege, auch die Ratssessel einzunehmen, getrieben von eigenem Ehrgeiz und vielleicht auch auf das Drängen des Ehegesponses und der Töchter, die so der strengen Kleiderordnung entgehen zu können hofften und demnächst ein Fältel mehr am Gewande, eine Pelzverbrämung mehr am winterdichten Mantel dem Neide der Nachbarinnen preisgeben durften.
Neben ihnen und unter ihnen, in den lichtlosen Hinterhäusern, in den dumpfigen Hütten, die an die Stadtmauer sich schmiegten, wie die Küchlein an die Henne, das städtische Proletariat, das von den Brosamen seiner glücklichen Mitbürger lebte und die staunende, bewundernde Masse abgeben durfte bei dem Gepränge des Rates, bei den Schauzügen der Gilden. In ihr gor und glomm es, und es bedurfte nur des Funkens, um die Flammen des Aufruhrs emporlodern zu lassen. Auf dem Lande aber, unter der Botmäßigkeit des Herrn, ob Graf oder schlichter Edelmann, seufzte der hörige Bauer in unerträglicher Frone, der geringsten persönlichen Freiheit beraubt für sich, für Frau, Tochter und Sohn. War der Herr vernünftig und zugänglich, so ließ er seinen Leibeigenen wenigstens so viel vom sauer Erworbenen, daß die Arbeitslust und Körperkraft[S. 55] nicht zu schnell sich abnutzte. Viele aber, sehr viele der Gebieter sahen in ihren Bauern und deren Angehörigen nur das Material, um ein bequemes Leben zu führen und der Wollust nach ihrem Belieben bei ihren Töchtern die Zügel schießen zu lassen. Und allen endlich lieferte er mit seinem Leibe das Rüstzeug, wenn es galt, Fehde und Streitigkeiten mit anderen im Kampfe Mann gegen Mann auszutragen.
Der Druck war unerträglich, und der Gegendruck aus der Masse der Unterdrückten machte sich immer mehr wahrnehmbar; es gor und brodelte unter ihnen und schuf sich Luft nach oben in schrecklichen Taten der Verzweiflung, die wie die Blasen aus dem trüben Schlamm des Morastes aufstiegen und doch zuletzt wirkungslos zerplatzten. Der ›Arme Konrad‹, der ›Bundschuh‹ sind die Namensprägungen, unter denen sich die Bauern zusammenschlossen. Ihr verworrener Zorn griff die verrottete Kirche an, er stürmte an gegen die Gewalthaber jeglicher Art, er traf die Städter, wo er sie treffen konnte. Die Organisation der Bauern war eine wirre, unklare. Neben der großen Masse zogen sie in zahllosen Einzelhaufen durch das Land. Sie fanden sich zusammen, wie der Wolf sich zum Wolf gesellt, um gemeinsam auf Beute auszuziehen. Wen sie trafen, den schlugen sie nieder und bemächtigten sich seines Besitzes, und wer es konnte, der schlug sie tot wie tolle Hunde. Die Sicherheit im Lande, auf den Straßen war wieder einmal im deutschen Lande geringer denn je, und sie wurde noch verringert durch die adligen Schnapphähne, die bei der Aufteilung der Machtbelange unter ihre mächtigeren und einflußreicheren Standesgenossen übergangen waren. Sie lebten von der Hand in den Mund und hungerten und[S. 56] lungerten auf ihren zerfallenen Raubnestern, bis der Turmwärtel oder Spione das Herannahen einer Beute meldeten. Dann stiegen sie hinab, lauerten den Ankommenden auf, suchten die Beute zu erhaschen, schlugen, erschlugen oder wurden erschlagen.
Das größte Risiko bei dieser Art adliger oder bäuerlicher Wegeaufsicht trugen die Städter, wenn sie ihre festen Mauern verließen, um mit gefüllter Geldkatze im Osten oder Süden, im Norden oder Westen einzukaufen, oder wenn sie mit den erworbenen Warenballen oder Gewürzsäcken heimkehrten. Wer nicht reisen mußte, hockte daheim hinter dem Ofen; wen aber die Notwendigkeit veranlaßte, den Schutz der Stadtmauer aufzugeben, der sah sich nach genügendem Schutz um, damit er der Gefahr begegnen könne.
Auf dem Deutzer Ufer des Rheins lagerte und lungerte an einem der letzten Oktobertage des Jahres 1515 ein bunter Haufen kriegerischer Gestalten. Sie lagen und standen umher, wie es ihnen einfiel. Alle blickten nach dem gegenüberliegenden Köln, da, wo das Frankentor gegen den Strom zu den Austritt aus der Stadt freigab. Es waren deutsche Knechte, die in Frankreich abgelohnt wurden, nachdem der Herzog von Burgund mit dem jungen König Ludwig XII. einen Vergleich geschlossen hatte. Der Obrist konnte den rückständigen Sold nicht zahlen, dieweil der Burgunder die Zahlung weigerte, nun er die fremden Söldner nicht mehr gebrauchte. Die Truppe meuterte, der Hauptmann, der zu vermitteln suchte, wurde erschlagen. Dann[S. 57] waren sie gegen Osten zu gezogen, marodierend und schatzend, wo sie es konnten und wo sie es wagen durften. In den Städten ließ man sie nicht ein; es waren zu wilde Gäste, denen die eigenen Stadtsoldaten nicht gewachsen gewesen wären. Auch das erzbischöfliche Köln hielt ihnen die Tore verschlossen. Sie wurden unter geeigneter Bedeckung um die Stadt geleitet an den Rhein. Dort überließ man sie sich, nachdem man unter gegenseitigem Grüßen, wie »Pfaffenknecht« oder »Meuterer«, voneinander Abschied genommen hatte. Von den Bastionen spähten die Stadtsoldaten mit brennender Lunte zu ihnen herab, um einen Annäherungsversuch unfreundlich zurückzuweisen. Der Fährmann mit seinen Knechten war seitens der Stadt gedungen, sie unentgeltlich an das andere Ufer überzusetzen; so hoffte man, bald den großen Strom zwischen der Stadt und den wilden Gesellen als schützenden Wall zu haben.
Vielleicht aber hätten die fremden Gäste sich doch nicht so mit der Überfahrt beeilt, wenn ihnen nicht ein besonderes Angebot die Sache annehmbar gemacht hätte.
In Köln weilten zur Zeit die flandrischen und wallonischen Kaufherren aus Gent, Antwerpen, Brügge, Dinant, und wo immer sonst das Kupfer des alten Rammelsberges Verwendung finden mochte. Sie kamen mit gespickten Geldkatzen und kostbaren Warenballen, um im Tausch für sie das wertvolle Metall einzuhandeln oder die Erzeugnisse ihres eigenen Gewerbfleißes zuvor in den Städten Westfalens und des Niedersächsischen Kreises in Geld umzusetzen und dann mit dem Verdienten in Goslar das Gewünschte zu erwerben. Ihre Gesichter wurden besorgter, je mehr sie sich den Grenzen Deutschlands näherten; denn was sie über die Zustände im Reiche hörten, mußte sie mit[S. 58] den größten Bedenken hinsichtlich ihrer Person wie ihres Eigentums erfüllen. Sie zogen zwar unter dem reisigen Geleit einer Anzahl Gewappneter dahin, aber diese boten allenfalls Schutz gegen die landesübliche Unsicherheit einzelner Trupps von Wegelagerern und adligen Strauchdieben. Im Kampfe mit großen Haufen verzweifelter und verwilderter Bauern mußten sie erdrückt werden.
Da kam einer der Wagenknechte, der, vor der Stadt sich ergehend, den seltsamen Zug der Landsknechte gesehen und von ihrem Wegziel gehört hatte, auf den guten Gedanken, dem Herrn diese wagemutigen Gesellen als Geleit für den Weg vorzuschlagen. Sein Vorschlag fand Anklang, wenn auch mancher der Kaufleute abriet, sich der wilden Soldateska anzuvertrauen. Ein Versuch sollte wenigstens gemacht werden. So wurde ein Unterhändler zu ihnen geschickt. Was er berichtete, klang vertrauenerweckender, als man erwartet und gehofft hatte. Die meisten Leute wollten nach Niedersachsen, woher sie stammten. Sie waren des Kriegslebens müde und sehnten sich nach Ruhe, wenigstens zur Zeit. Die Bewaffnung sei gut, der Webel, der die Führung habe, besitze Gewalt über die Leute, und die Soldaten selbst machten keinen allzu schlechten Eindruck. Gegen ein gutes Handgeld und entsprechende Ablohnung nach Erfüllung des Auftrages seien sie bereit, den Schutz des Zuges zu übernehmen, mit der Einschränkung allerdings, daß es dem einzelnen freistehe, abzuschwenken, wenn die Heimat erreicht sei. Da indes die meisten, wie erwähnt, aus den braunschweigischen Ländern und noch darüber hinaus waren, so blieb bis in die Nähe von Goslar ein wirkungsvolles Geleit gesichert. Das Handgeld war ausgezahlt, und die Knechte warteten ihrer Schützlinge.
[S. 59]
Unter ihnen waren auch einige Blessierte und Schwerverletzte. Im Hintergrunde hielt der Wagen der Marketenderin, eines kräftigen Frauenzimmers. Immecke Rosenhagen hieß sie und stammte aus Salzwedel. Den Eltern war sie vor nunmehr manchem Jahre davongelaufen mit einem Gesellen des Vaters, der aus dem Stolz des eingeborenen Gildemeisters heraus sich dagegen sträubte, die einzige Tochter einem zugereisten Fremden zur Frau zu geben. Der Geliebte griff zur Hellebarde, sie bestieg das Wägelchen, in welchem sie allerlei Trink- und Eßbares für das Fähnlein mitführte. Übrigens hatte die beiden ein schnellbereiter Feldkaplan in christlicher Ehe zu Mann und Frau gemacht. Des Mägdeleins, das ihrer Liebe entsprossen, konnte sich der Vater nicht allzulange erfreuen; eine Stückkugel zerriß ihm vor den Wällen von Maastricht die Brust.
Immecke und ihr Töchterlein Monika blieben dem Regiment treu und zogen mit ihm von einem Kriegsschauplatz zum andern. Wo immer die Kartaunen rasaunten und die Hakenbüchsen krachten, hielt ihr Wägelchen in der Nähe. Manchen Verwundeten hatte sie gepflegt, manchem Sterbenden die brechenden Augen zugedrückt. Und es war rührend, wie das rauhe Soldatenvolk diese Treue vergalt. Wehe dem, der sich gegen Immecke oder ihre Monika vergangen hätte. Die Mutter hatte zwar selbst einen allzeit schlagfertigen Mund, um sich etwaiger Ungebührlichkeiten zu erwehren; aber dazu wurde ihr kaum Gelegenheit gegeben; sie war Respektsperson im ganzen Regiment und besonders des Fähnleins des Hauptmanns Hennecke, unter dem ihr seliger Mann gedient hatte und dem sie sich infolgedessen auch zugeschrieben erachtete. Selbst der Spitz, der[S. 60] unter dem Wagen daherlief, war in diesen Schutz eingeschlossen.
Immecke Rosenhagen gab mehr als einmal die Schlichterin bei bösen Händeln ab, wie sie Würfelspiel, Trunkenheit oder die Dirnen des Trosses wohl hervorriefen. Hätte sich eins dieser losen Weiber einmal unehrbietig gegen Immecke oder ihr Töchterlein benommen, es wäre ihm teuer zu stehen gekommen. Die Meuterei, bei welcher der wackere Hauptmann Hennecke das Leben eingebüßt hatte, verzieh sie ihren Kindern, wie sie ihre Soldaten zu nennen pflegte, lange nicht. Zwar war der tödliche Streich nicht von einem Angehörigen des eigenen Fähnleins geführt worden. Indes die Leute auch des Hauptmanns Hennecke hatten sich an dem Aufruhr beteiligt. Sie selbst war zur Zeit der Tat auf Einkauf fortgewesen und hörte erst bei der Rückkehr von dem Tumult. Die Tat war geschehen, und den guten Hennecke rief niemand mehr ins Leben zurück. Aber den Knechten seines Fähnleins wurde von Immecke eine Predigt darob gehalten, die sie lange nicht vergaßen.
»Ihr wollt ehrliche, deutsche Knechte sein? Eidbrüchige Schufte seid Ihr, die mit Mordbuben gemeinsame Sache machen, wenn sie die paar ihnen zustehenden Gulden nicht sogleich erhalten. Kann der Herr Obrist dafür, wenn ihm der welsche Fürst das gegebene Versprechen nicht hält? Hat der Hauptmann nicht allezeit wie ein rechter Vater für Euch gesorgt? Nun liegt er erschlagen vor Euch, und daheim warten Frau und Kind vergeblich auf die Wiederkehr. Pfui über Euch!«
Die Knechte krauten sich verlegen hinter dem Ohr und schlichen beschämt zur Seite. Seit dem Tage hatte Immecke sie noch fester in der Hand. Sie war die eigentliche Führerin[S. 61] auf dem Marsche in die Heimat, wenn auch der Weibel die äußere Leitung beibehielt. Alle waren kriegsmüde, die Soldaten wie die Marketenderin. Wo sie ihr Haupt niederlegen würde, wußte Immecke noch nicht. Aber sie wollte ihrer Monika eine Heimat geben.
Vor dem Wagen, auf dem sie hantierte, standen einige Knechte und leerten den Becher mit Branntwein, der ihnen die Morgensuppe ersetzen mußte.
»Nun geht's zur Mutter, Immecke«, rief ihr Klaus Bolte zu, der in Osterode am Harz zu Hause war.
»Na, die wird sich recht freuen, wenn Du mit Deiner zerhackten Visage vor ihr auftauchst. Sieh nur zu, daß wenigstens die Nase wieder etwas ins Gerade gerückt wird, sonst läuft selbst der Kater mit Grauen davon.«
»Schadet nichts, Mutter Immecke«, erwiderte Klaus ungerührt. »Freuen wird sie sich doch, denn zuletzt ist doch noch manches an dem Kerl geblieben, was sich sehen lassen kann. Wird für den verlorenen Sohn kein Kalb geschlachtet, so doch hoffentlich ein tüchtiges Stück Schinken aus dem Rauchfange geholt. Und der Vater soll's nicht zu arg machen. Dem Stöcklein sind wir mit der Zeit entwachsen; könnte uns ansonst gleich wieder die Klinke in die Hand drücken. Neugierig bin ich nur, wie wohl das Schwesterchen ausschaut, das ich vor Jahren als ein kleines Hutzelchen verließ. Muß etwa so alt sein wie Eure Monika. Ob sie freilich auch so schier und blank dareinschaut wie diese, weiß ich nicht.«
Da lief ein Schmunzeln über Immeckes Gesicht, und sie reichte Klaus Bolte einen Becher Branntwein. »Da, nimm's und trink's auf ihr Wohl, so verkühlst Du Dir den Magen nicht in diesem Schandwetter. Ansonst die Mutter Dich mit[S. 62] Kamillentee zurechtpäppeln muß, statt des Schlegels vom geschlachteten Kalbe.« Klaus lachte über das ganze Gesicht und setzte den Becher an die ewig durstigen Lippen.
Währenddessen war die Tochter, von der die Rede war, um einen Schwerblessierten beschäftigt, der mit noch zwei anderen auf einem Beiwagen im Stroh lag. Ihm war bei dem letzten Treffen das linke Bein zerschmettert, und die Säge des Feldschers hatte ihm nur einen armseligen Stumpf davon übriggelassen.
»Nun, wie geht's mit der Wunde, habt Ihr noch arge Schmerzen?« fragte das Mädchen mitleidig, während sie ihm das Strohkissen zurechtrückte, daß er bequemer sitze.
»Wie soll's anders sein,« murrte der alte Doppelsöldner, »natürlich zwickt's noch höllisch; aber das ist's nicht, was mich niederdrückt. Die Aussicht, den Bettelmann künftig zu spielen, als Lump hinter einer Hecke zu verrecken, das ist es, was einen ehrlichen Kriegsmann wurmt und auffrißt! Man hätte mich verbluten lassen und mit dem, was von mir da hinten bei Nanzig blieb, beiroden sollen!«
»Pfui doch, der garstigen Rede«, sagte Monika, während sie begütigend über das struppige Haar strich. »Dankt vielmehr Eurem Gott, daß er Euch das Leben ließ. Der wird auch weiter für Euch sorgen. Ihr habt doch noch Leute zu Hause, die für Euch sorgen werden.«
Der alte Veteran blickte gerührt zu ihr auf. »Du bist doch unser Engelein, Monika! Hast recht, so ganz verlassen bin ich nicht. Noch lebt mir das alte Mütterlein daheim; die freut sich, bringt ihm der Sohn auch statt güldener Ketten und anderer Schätze, die er auszog zu erwerben, nur ein Stelzbein mit. Und der Bruder, der das väterliche Anwesen erbte und bewirtschaftet, war auch keiner der Schlechtesten.[S. 63] Ist die Frau, die er inzwischen heimführte, von ähnlicher Gesinnung, so mag auch bei ihnen ein Plätzchen hinter dem Ofen für mich bereit sein, und den Kindswärtel kann ich zur Not auch noch spielen. Sag's nur der Mutter nicht, in welcher Laune Du mich getroffen, sonst setzt es noch ein Donnerwetter von ihr. Du weißt ja, wie sie ist.«
Immecke war derweil mit einem andern ins Gespräch geraten, der eine Binde über dem linken Auge trug.
»Wohl bekomm's, Erdwin Scheffer«, wünschte sie dem Einäugigen zugleich mit dem Becher, den sie ihm reichte. »Nun, freust Du Dich, daß wir glücklich über den Rhein sind? Jetzt geht's mit Macht der Heimat zu. Die Eltern werden sich freuen, wenn sie Dich wiederhaben.«
Ein verbissenes Lachen war die Antwort.
»Natürlich, die werden alle Türen bekränzen, wenn der Hansdampf in allen Gassen flügellahm wiederkehrt, der ihnen ausriß, weil es ihm daheim zu wohl war und weil er ihren gutgemeinten Plänen nicht gehorsamen wollte. Und die Freunde erst und die Jüngferlein, wie werden die sich um mich reißen, den Krüppel.«
»Laß die Mutter aus dem Spiel bei Deinem gottlosen Reden«, widerriet Immecke ernst und nachdrücklich. »Was weißt Du, was eine Mutter für ihr Kind im Herzen trägt.«
Sie kam nicht weiter mit ihrer Ermahnung, denn in diesem Augenblick begann am jenseitigen Ufer vor sich zu gehen, worauf alles schon wartete. Das Frankentor öffnete sich und ließ die Karren und Wagen der flandrischen Kaufleute heraus. Sie rumpelten nacheinander das abgeflachte Steinufer zur Fähre herab, die sie übersetzen sollte. Man sah, wie die Pferde unruhig aufstiegen, als sie das schwankende Gerüst betreten sollten. Dann kam die erste Last über[S. 64] den Strom und landete nach langer Zeit am Deutzer Ufer. Einmal nach dem andern fuhr der Fährmann mit seinen Knechten herüber und zurück, denn der Zug war lang, und die Fähre trug nicht mehr als zwei Gefährte zugleich. Es ging schon auf den Nachmittag, als der letzte Wagen den Uferrand bei Deutz heraufrollte.
Manches derbe Scherzwort fiel bei den Kriegsknechten über das Bild, das sich vor ihnen abspielte.
»Was mögen wohl die Ballen und Kisten an Kostbarkeiten bergen?« meinte neugierig lüstern Abel Wüstemann aus Zerbst. »Das kann Dir gleich sein«, fiel ihm Immecke ins Wort. »Für Dich ist's jedenfalls nicht bestimmt. Laß also Deine Gedanken und Finger davon, das rate ich Dir.«
»Nun, nun, man wird doch noch seinen Mund auftun dürfen«, brummte der also Gemaßregelte.
»Besser ist's schon, Du befolgst meinen Rat und behältst Deine Gedanken für Dich; wir kennen uns doch von Arras her, wo ich Dich durch ein gutes Wort vor dem Profosen rettete, als Du ein wenig von des Nächsten Gut an Dich gebracht hattest. Ein zweites Mal wird Dir meine Fürsprache fehlen. Wir wollen als ehrliche Leute in die Heimat ziehen.« Da schlich er beschämt zur Seite.
Verdrossen glitt der Blick Erdwin Scheffers über das Treiben am Strande. Unschlüssig stand er da über seine Hellebarde gebeugt, in seiner Lässigkeit doch die Kraft verratend, die in seiner schlanken, sehnigen Gestalt gefesselt stak. Das hübsche Gesicht wurde nicht einmal durch die schwarze Binde merklich entstellt. Die Hand glitt verloren durch das Bärtchen, welches die Lippen zierte. Monikas Blick folgte dem Abseitsstehenden. Sie wischte sich verstohlen die Augen, die ihr feucht geworden waren im Gedanken an[S. 65] sein Unglück; was war aus dem lustigen Gesellen geworden, der zu ständiger Kurzweil früher geneigt war. Ihr selbst kaum bewußt, schlug ihm ihr junges, unschuldiges Herz entgegen.
Erdwins Gedanken weilten indes weitab von ihr und vom Rhein. Die Berge des Harzes stiegen vor ihm auf und die Stadt mit den vielen Türmen, aus der er in trotzigem Übermut und Groll entwichen war. Wie mochte es jetzt daheim aussehen, was die Mutter sagen und der Vater denken, dessen starrer Sinn ihn beim eigenen Handwerk festhalten wollte, um ihn durch die Hand der Nachbarstochter noch unlöslicher mit der Heimat zu verbinden? Denn er kannte den unruhigen Sinn des Sohnes, der in die Ferne strebte und in unklarer jugendlicher Abenteurerlust jenseits der Berge die blaue Blume zu pflücken hoffte, von der die Mär erzählte. Erdwin hatte längst eingesehen, daß diese Blume im Lande Nirgendwo blühe und daß der ehrsame, gestrenge Vater zuletzt doch das Richtige mit ihm im Sinn hatte. Aber Trotz und Scham hielten ihn davon ab, als reuiger Sohn zurückzukehren, und auch die Aussicht, doch noch das Opfer der väterlichen Heiratspläne zu werden. Die breithüftige Maria Hellvogt, die man ihm zugedacht hatte, mit den guten, blauen Augen im rundlich-dummen Gesicht, konnte ihn auch heute noch nicht locken, zumal wenn er sie mit der zierlichen Monika verglich, die ihm in den Jahren der gemeinsamen Kriegsfahrt mehr als ein guter Kamerad geworden war. Nun kehrte er als ein Schiffbrüchiger heim, und er mußte vorliebnehmen, was ihm von der Eltern Gnade übrigblieb, wenn sie ihm nicht gar ganz die Tür verschlossen.
Ingrimmig stampfte er mit der Waffe auf; da fiel sein[S. 66] Blick auf einen der Männer, die ihre Rosse von der Fähre die Uferböschung hinaufführten: Wenn's nicht gar so närrisch wäre, sollte man meinen, das sei ein alter Bekannter von daheim. Noch einmal sah er hin und noch einmal. Wahrhaftig, kein Zweifel, das war ja der Heinrich Achtermann, des Ratsherrn Sohn, und der da neben ihm, war das nicht Johannes Hardt von der Poppenbergstraße? Und schon klang es auch von seinen Lippen: »Heinrich Achtermann, Johannes, Herr Johannes Hardt, bist Du es, seid Ihr es wirklich?«
Hallo, wer rief hier, in der Fremde, ihren Namen? Heinrich blickte sich erstaunt um.
Die Freude, einen Bekannten aus der alten Heimat, einen Jugendgespielen unvermutet zu sehen, überwog bei Erdwin jedes andere Gefühl. Eilig trat er näher. »Bei Gott, das nenn' ich eine Freude in all der Trübsal«, sprudelte er hastig hervor. »Aber sagt, erkennt Ihr mich denn immer noch nicht, den Erdwin Scheffer von Sankt Ägidien, mit dem Ihr so oft in des Nachbars Garten auf Raub gezogen und der ebensooft vom Vater den Buckel zerbleut bekam, weil er dem Stadtweibel eine Nase gedreht oder die Zöpfe der dummen Mädel aneinander festgebunden hatte, daß sie zeterten und schrien, als sei der Habicht unter die Hühner gestoßen?«
Nun erkannten auch sie den Jugendgespielen, und die Freude war nicht minder groß. Das gab ein Fragen hin und her. Über die Heimat wußten sie freilich beide wenig Neues; im Vordergrunde standen die Erlebnisse in der Fremde.
»Was hast Du denn mit dem Auge?« fragte Johannes.
»Das ist das traurigste Kapitel aus meiner Irrfahrt. Es ist dahin, und nicht einmal im ehrlichen Kampfe vor dem[S. 67] Feinde verloren, sondern ein eidbrüchiger Schuft stieß mir sein Messer hinein, als ich einen ehrlichen Mann, unsern Hauptmann, aus den Krallen der meuterischen Knechte befreien wollte. Er hat zwar seine Tat mit dem Leben gebüßt, denn die Kameraden schlugen ihm gleich danach den Schädel ein, aber ich bin ein Krüppel fürs Leben und weiß noch nicht, wie ich es trage und vor die Eltern treten soll, denen ich im aufgeblähten Stolz vor mehr als fünf Jahren davonrannte.«
Man sprach ihm gut zu, und die düstere Falte auf der Stirn glättete sich allmählich unter dem lebhaften Austausch von gemeinsamen Erinnerungen und dem »Weißt Du noch?« »Besinnst Du Dich?« Niemand aber war froher als das wackere Paar am Marketenderwagen, als sie sahen, daß ihr Liebling wieder etwas frohmütiger dreinblickte, und Monika rechnete es dem Heimatsgenossen als besonderes Verdienst an, daß ihm dies gelungen war.
[S. 68]
Der Zug der Kaufleute hatte das Bergische Land durchquert und war in die Soester Börde hinabgestiegen, vorbei an mehr als einem der Raubnester, die über den tiefen Taleinschnitt am Felsen klebten wie das Nest der Mauerschwalbe. Manch begehrlicher Blick eilte ihnen von da oben entgegen und geleitete sie im Vorbeiziehen, aber man wagte sich nicht an die Fremden heran, die wie ein kleiner Heereszug stattlich und sicher dahinzogen. Es waren der Kaufleute gar viele, die aus Flandern und Frankreich solchergestalt ins Reich zogen, denn manche von ihnen zogen noch über Goslar hinaus bis Leipzig, um dort auf den großen Märkten, den Vorläufern der heutigen Messe, den Warenaustausch bis nach dem fernen Osten hin zu vermitteln. Gemeinlich fand nur einmal im Jahre ein solcher Zug aus dem Westen her statt. In Goslar hielt man sich monatelang auf und handelte dort wie in Braunschweig und anderen Städten der Nachbarschaft, bis die Ostgänger wieder zurück waren und man nun mit dem begehrten Kupfer und anderen Schätzen die Rückreise antreten konnte.
In Goslar pflegten die Fremden bei ihren Geschäftsfreunden abzusteigen, während die Knechte und Handlungsgehilfen in den Herbergen Unterkunft fanden. Manche engen Beziehungen waren so entstanden zwischen Goslarer Familien und Häusern in Brabant oder Nordfrankreich. Fäden liefen hin und her, die nicht leicht zerrissen. Der bedächtige Kaufmann vertraute seine Sachen nicht gern fremden Händen[S. 69] an, und erst wenn das Alter zu sehr drückte oder der Sohn und Nachfolger Gewähr bot, daß die Geschäfte mit gleicher Gewissenhaftigkeit erledigt werden würden, trat der Alte zurück und überließ der jungen Kraft die Beschwerden der Reise. So kam es, daß Heinrich und Johannes Hardt auch Bekannte unter ihnen antrafen. Da war der weißhaarige Herr Jan Uytersprot aus Brügge, der beim Nachbar Borchardt abzusteigen pflegte und sich so gern mit den Kindern beschäftigte. Noch heute rechnete es ihm Heinrich hoch an, daß er sein Versprechen, ihm einen richtigen Bogen mit Köcher aus Brabant mitzubringen, getreulich gehalten hatte. Und Herr Gérard Dietvorst aus Dinant und Felix Vandepere aus Löwen und noch andere, sie alle tauchten vor ihm mit bekannten Gesichtern auf. Er selbst mußte sich freilich ihnen erst wieder in Erinnerung bringen, denn seit der Kindheit war manches Jahr dahingerauscht, und den aufwachsenden und in die Fremde ziehenden Jüngling hatten sie aus dem Gesicht verloren. Von seinem Auftrage war natürlich nicht die Rede, und ihre Geschäfte nahmen sie mehr in Anspruch als der Gedanke, wie die jungen Goslarer hier in ihren Zug kamen.
In Soest fand Heinrich Achtermann Gelegenheit, die Grüße des Vaters im Hause Ernestis zu bestellen und sich zu überzeugen, welches geschäftige Leben in der alten Hansestadt pulsierte. Ernestis Wohnwesen stellte mit seinen Höfen, Speichern und Stallungen eine Handelsburg für sich dar. Der Mann mußte ein ganz Großer unter seinen Berufsgenossen sein!
An der Weser gab es unerwünschten Aufenthalt, denn die Brücke bei Höxter war wieder einmal abgetragen oder davongeschwemmt. Argwöhnisch schielte man sich von beiden[S. 70] Ufern an: hier die kurmainzischen Mönche von Corvey mit den erzbischöflichen Knechten in der Stadt, drüben die Mannen des braunschweigischen Vogts. Also galt es, noch einmal auf der Fähre den Fluß zu überqueren.
In Köln hatte sich dem Zuge auch ein Händler Hans Römer aus Helmstedt angeschlossen, der die günstige Gelegenheit zur Heimreise benutzen wollte. Seine Gewandtheit und seine Kenntnis des Flämischen wie des Französischen machte ihn zu einem willkommenen Begleiter für diesen und jenen der Kaufleute, denen das Deutsch etwas polterig vom Munde floß. Dabei war er am Rhein mit Land und Leuten ebenso vertraut wie in Westfalen, und seine Beweglichkeit half manchen Zusammenstoß mit den Landesbewohnern wie mit Behörden vermeiden. An Heinrich und Johannes schien er einen besonderen Gefallen gefunden zu haben. Wo es nur anging, hielt er sich in ihrer Nähe auf und verstand es auch meistens, in derselben Herberge mit unterzuschlüpfen. Johannes vergalt diese Freundlichkeit nicht mit gleichem Entgegenkommen. Es lag etwas im Wesen des Mannes, was ihn abstieß; war es der unsichere Blick der ewig auf der Wanderung befindlichen Augen oder die aufdringliche Zutraulichkeit; er wußte es selbst nicht. Heinrich war weniger mißtrauisch. Seine Vertrauensseligkeit hatte bisher noch keinen groben Stoß im Leben erlitten. Einmal wurde allerdings auch sein Argwohn rege, als er den Helmstedter im Morgengrauen, da alles noch schlief, bei seinen Habseligkeiten fand. Römer war um eine Ausrede nicht verlegen, als Heinrich ihn fragte, was er an seinen Sachen zu tun habe. Es lag natürlich ein Versehen vor, das sich aus dem unsicheren Licht erklärte, und tatsächlich befand sich das Bündel des Mannes dicht dabei, so daß ein Irrtum möglich war.
[S. 71]
Der Argwohn erhielt aber neue Nahrung durch eine Mitteilung Erdwin Scheffers, dem es Monika Rosenhagen sagte. Sie hatte Römer mehrere Male im geheimen Gespräch mit einigen Landsknechten gesehen und dabei auch den Namen »Achtermann« deutlich vernommen. Da jener Wüstemann dabei gewesen war, dem die Mutter eine unreine Hand nachsagte, so nahmen sie an, daß irgendein Schelmenstück geplant werde. Man konnte aber zunächst nichts weiter tun, als die Augen offen halten. Und das taten Monika mit ihrer Mutter wie Erdwin Scheffer und Johannes Hardt seitdem noch mehr als Heinrich selbst.
Die Zahl der Landsknechte verringerte sich inzwischen mählich, aber stetig in dem Maße, wie die Heimat des einzelnen näher kam. Als man sich dem Harz zuwandte, waren es nur noch ihrer dreißig. Man mußte der wilden Schar nachrühmen, daß sie ihre Aufgabe auf der langen Reise redlich erfüllt hatte. Freilich hatten die Kaufleute tüchtig in den Beutel greifen müssen, aber die Vorsicht lohnte sich doch, und man konnte hoffen, die Mehrkosten wiedereinzubringen, sei es durch vorteilhafte Einkäufe in Goslar oder durch Aufschlag auf die Waren daheim. Ein Jauchzen rang sich von den Lippen Heinrichs, als die Berge des Harzes jenseits Gandersheim in der Ferne aufblauten.
»Die Heimat, Kinder, die Heimat winkt uns«, rief er den Gesellen zu, die in seiner Nähe gingen.
»Für Dich ja, aber für mich?« erwiderte Erdwin traurig. »Auch für Dich, guter Erdwin«, redete Johannes ihm tröstend zu. »Auch für Dich wird sich noch alles zum besten wenden. Jetzt freue dich mit uns, daß wir dem alten, lieben Goslar näher kommen.«
Man kam durch Ildehausen, wo ehedem Ernestis Ahnen[S. 72] hausten. Vor ihnen erhoben sich die Berge in immer machtvollerer Fülle, und dann zogen sie in das kleine Städtchen Seesen ein, das die letzte Raststätte vor Goslar sein sollte.
In Seesen verließen noch einige Landsknechte die Gesellschaft. Da man aber dem Ziel nahe war und die unsicheren Gebiete hinter sich wußte, glaubte man das Endstück der Reise unter dem Schutze der eigenen Bewaffneten und des Restes der Soldaten wohl zurücklegen zu können.
In diesem Städtchen verschwand auch Römer, und man trauerte dem unleidlichen Gesellen nicht nach. Erdwin Scheffer war noch immer nicht ganz beruhigt. »Ich kann mir nicht denken, daß der Kerl irgendeinen Plan hegte und nun ohne weiteres auf die Ausführung verzichtet, ohne den ernstlichen Versuch zu seiner Ausführung unternommen zu haben.« Aber Heinrich, wie jetzt auch Johannes, waren guten Mutes, und man verließ anderen Morgens die kleine Stadt. Sie hofften, schon in den frühen Stunden des Nachmittags in Goslar einzutreffen; doch ein Radbruch beim Neuen Kruge gab unliebsamen Aufenthalt, und es sanken schon die frühen Schatten des Novembertages herab, als man sich den Goslarer Bergen näherte.
Der Vogt des festen Hauses in Langelsheim, das den Braunschweigern gehörte, gab mürrischen Dank auf den Gruß, den man ihm bot.
»Wie seine Herren«, sagte Heinrich lachend, dessen frohe Ungeduld mit jedem Schritt wuchs. Vor ihnen verließen ein paar Bewaffnete den Ort, wahrscheinlich Knechte des Herzogs, die mit Botschaft nach Langelsheim gekommen waren oder solche mit sich nahmen. Sie ritten, daß die Funken stoben. »Die haben es eilig, daß sie unsere Gesellschaft meiden«, rief Erdwin hinter ihnen her.
[S. 73]
Als man in den hohlen Fahrweg einbog, der das letzte Stück des Weges vor Goslar bildete und etwas westwärts vom Kloster Riechenberg begann, war die Dunkelheit völlig hereingebrochen. Der Weg führte in der tiefen Rinne dahin, die vom Wasser in der Hauptsache gegraben war und ihm auch weiter als Abflußrinne diente. Die Wagenknechte suchten fluchend die Laternen hervor und hieben auf die müden Gäule ein. Da durchschnitt plötzlich ein schriller Pfiff die Luft. An der Spitze des Zuges krachten Schüsse, und alles geriet ins Stocken. Von der Höhe sprangen Bewaffnete herab und schleuderten Feuerbrände in den Wirrwarr auf der Talsohle. Die Pferde scheuten und suchten durchzubrechen. Überall Kampfeslärm und Waffengeklirr. Man dachte zunächst nichts anderes, als daß man zuletzt doch noch das Opfer eines Überfalls von Strauchdieben geworden sei.
Heinrich ritt mit Johannes ziemlich an der Spitze des Zuges; denn die Ungeduld trieb sie voran. In ihrer Nähe war auch Erdwin Scheffer mit noch anderen Knechten. Sie wollten umkehren, um die Wagen zu schützen; aber da traten ihnen mehrere Bewaffnete entgegen. »Der da ist es«, rief einer der Fremden mit einer Stimme, die Heinrich bekannt vorkam. Sie warfen sich auf ihn und suchten ihn zu überwältigen. Heinrich wehrte sich kräftig, doch die Überzahl war zu groß. Ihm schwanden die Sinne, er merkte nur noch, daß ihm die Brusttasche entrissen wurde. Da kam Hilfe von Erdwin und Johannes, die sich bis jetzt selbst ihrer Gegner zu erwehren gehabt hatten. »Dachte ich's doch, daß der Schuft seine Hand im Spiele habe.« Damit warf er sich auf die Angreifer und drang bis zu Heinrich vor; denn er sah, daß der, den er meinte, es war der Helmstedter,[S. 74] mit seiner Beute davonwollte. Da holte diesen ein Schlag mit der Hellebarde herab. Mit gespaltenem Schädel sank er zu Boden.
Mit dem Falle des Anstifters schwand auch die Angriffslust der übrigen. Sie suchten nur noch ihren Rückzug zu decken und klommen kämpfend den steilen Hang hinan. Erdwin, in dem die alte Kampfeslust erwachte, drängte hitzig nach. Hier und da krachte noch ein Schuß, zersplitterte noch ein Lanzenschaft. Noch ein Feuerstrahl zuckte aus einer Hakenbüchse auf, er galt und traf Erdwin Scheffer. Als letzter im Kampfe sank er dahin. »Die Tasche!« flüsterte er noch dem Nächsten zu, dann brach er zusammen. Man hörte den Galopp von fortjagenden Reitern, dann blieb die Nacht allein mit den Überfallenen zurück. Man suchte zu ordnen, so gut das bei dem Wirrwarr und der Dunkelheit ging. Johannes war um Heinrich Achtermann bemüht, den er für schwerverletzt hielt; Erdwin Scheffer blieb zunächst sich selbst überlassen.
Der nächtliche Kampf hatte leider nicht nur blutige Köpfe gekostet, einige Knechte waren tot. Verwundete ächzten und riefen um Hilfe. Herabgezerrte Warenballen sperrten den Weg. Angstvoll suchte Monika im Hohlwege vorzudringen. Ihnen war nichts geschehen, der Angriff hatte sich von vornherein auf die Stelle gerichtet, wo man Heinrich Achtermann vermutete. Ihre Sorge galt Erdwin Scheffer, dem fröhlichen Gesellen mancher kurzweiligen Stunde im Tumult des Krieges, dem Geliebten ihres Herzens, wie sie in der Stunde der Gefahr mit blendender Klarheit erkannte. Ihr Fuß strauchelte über Wurzeln, sie versank in Rinnsale des Weges, aber sie ruhte nicht, bis sie ihn gefunden hatte. Und als sie ihn vor sich liegen sah, mit wunder Brust, aus[S. 75] dem der warme Strahl hervorsickerte, da sank sie mit einem Aufschrei über ihn hin.
»Erdwin, mein Erdwin, bleibe bei mir, verlaß mich nicht, Einziger Du!« Irre, hilfesuchend blickten ihre Augen umher im Dunkel der Nacht. War denn niemand da, der helfen konnte? Da kam die Mutter heran, die Vielerfahrene. »Laß ihn mir, Monika. Wenn ihm zu helfen ist, bringe ich ihm Rettung.«
[S. 76]
Die steile Höhe des Erzweges hinauf, der vom Granetal über das Joch zwischen Hessenkopf und Thomas-Martinsberg ins Tal der Gose führt, erklangen die Glöckchen der Grautiere, die ihrer Last ledig waren, welche sie auf dem geduldigen Rücken von den Gruben des Rammelsberges zu den Erzrösten im Granetal geschleppt hatten. Rüstiger schritten sie aus, als die Höhe erreicht war. Auf dem Rückwege drückte nur leichte Bürde ihren Rücken: Kupferbarren, Bleibrote, der Gewinn aus der umständlichen und unvollständigen Art der Verhüttung, waren ihnen anvertraut. Vergnüglich klang das »I—ah« des Leitesels in die kühle Novemberluft, als wolle er seiner Freude Ausdruck geben über den warmen Stall und die gutgefüllte Krippe, die seiner harrten.
Unten im Granetal verhallten die letzten Axtschläge der Holzfäller an den Berghängen, die in den Waldungen der Silvanen, der Waldherren, das Holz fällten, welches zum Rösten und Sintern des Erzes nötig war. Vom Glockenbrunnen her, der das klare Wasser des Glockenberges dem Tage wiedergibt, lagerten sich die dicken Schwaden schwefligen Rauches über der Talsohle, wo die Rosthaufen des Erzes unter der Hut rußiger Wächter schwelten.
Zwei Männer verließen die Stätte und wandten sich ebenfalls dem Erzwege zu. Mager und langstelzig der eine, kurz und rundbäuchig der andere.
»Gemach, gemach, Nachbar Richerdes«, mahnte der[S. 77] kleine Dicke. »Wir wollen kein Wettrennen veranstalten. Ihr kommt noch rechtzeitig in der Bergstraße an, um Euch von der Eheliebsten den Abendtrunk kredenzen zu lassen.«
Der Lange verhielt etwas im Schritt, bis der Begleiter ihn wieder eingeholt hatte. »Wollte hoffen, es wäre so«, sprach der Hagere grämlich. »Aber Ihr wißt doch, daß die Frau seit Monaten siecht. Zu Hause sehe ich schon lange kein fröhliches Gesicht mehr.«
»Entschuldigt, Nachbar, es war nicht böse gemeint«, begütigte der Waldherr Ludecke Bandelow. »Ihr habt aber doch wenigstens die Venne; die muß Euch doch ein wahrer Augentrost sein in diesem Ungemach, Euch und Eurer Frau.«
»Ich will es nicht leugnen und danke Gott, daß er sie uns schenkte für diese Zeit der Trübsal, doch lange wird ihr jugendlicher Frohsinn auch nicht mehr vorhalten, fürchte ich. Die Mutter aufheitern und den grämlichen Vater beruhigen, das ist nicht Jugendarbeit auf die Dauer. Ihr seht, ich male mich selbst nicht schöner, als ich bin. Aber der Henker soll auch die gute Laune behalten bei all dem Ärger mit dem Berge und dem Rat.«
»Wie steht Ihr denn jetzt mit ihm?« forschte Bandelow.
»Das könnt Ihr Euch leicht vorstellen, solange Karsten Balder regierender Bürgermeister ist. Ihr wißt ja, wie er es, offen und versteckt, gegen mich hat, er wie seine Freunde. Sein Gelüste kenne ich, ihm steht der Sinn nach meiner Gerechtsamen; die Ursachen liegen tiefer: mich trifft er, aber eine andere will er treffen.«
»Ich weiß, ich weiß, es gilt Eurer ...«
»Wozu die Namen?« unterbrach ihn Richerdes, »das ändert nichts an der bestehenden Gegnerschaft. Die Hauptsache ist, daß man den Gegner als solchen kennt.«
[S. 78]
»Ja, das ist das schlimme, daß es möglich ist, ehrsamen und pflichttreuen Bürgern das Leben schwer zu machen unter der Flagge der Fürsorge für die Stadt. Eine nette Fürsorge das, die darauf hinausläuft, einem das bißchen Eigentum zu nehmen. Das scheint ja freilich im Zuge der Zeit zu liegen; denn wie man bestrebt ist, Euch die Berg- und Grubengerechtsame abzujagen, so will man uns unsere wohlerworbenen Anrechte auf die Forst abnehmen. Aber gebt nicht nach, keinen Zoll breit. Mit uns hat es der wohlweise Rat ja ähnlich vor; solange ich jedoch da bin, erhält er nichts.«
»Nun, ›abjagen‹ ist vielleicht nicht das richtige Wort,« fiel Richerdes ein, »Ihr wißt ja, daß er mich und andere auskaufen will. Daß der Preis nicht zu hoch gehalten ist, dafür sorgt aber schon der Regierende. Es sei im Interesse der Stadt, der Allgemeinheit, so bemänteln sie es gar schön. Aber ich kann und will das nicht einsehen. Weshalb soll denn jetzt auf einmal verkehrt sein, was man vor nicht gar zu langer Zeit selbst betrieb. Damals, als es hieß, Geld zu finden, Gewerke zusammenzubringen, war mein Vater gut genug zur Hergabe des Geldes. Ich weiß von ihm selbst, wie er sich gesperrt und gesträubt hat, ehe er den Beutel zog. Damals drängte und mahnte der Rat, es sei eine Tat für das Gemeinwohl; jeder Bürger, der es könne, müsse einspringen. Jetzt wollen sie es nicht recht haben, jetzt, wo die Sache nach den vielen Scherereien und Opfern sich als ergiebig zeigt.«
»Das ist's, damit habt Ihr ins Schwarze getroffen: sie gönnen Euch den Gewinn nicht, und da muß das Gemeinwohl herhalten. Bleibt nur fest wie ich. Meinen Anteil an der Forst bekommen sie nicht, und wenn sie noch so viel darum tun. Recht muß Recht bleiben.«
[S. 79]
So tauschten die beiden wackeren Bürger ihre Meinungen aus über den habgierigen Rat, wie sie sein Vorgehen deuteten, und stiegen von der Höhe herab, vorbei an der Ratsschiefergrube, die schon von den Werkleuten verlassen wurde; denn die Schatten des Abends sanken immer mehr herab. An der Gose entlang klapperten der Wassermühlen unermüdliche Räder.
An dem Stadtgraben trennten sie sich mit einem Handschlag, denn Bandelow hoffte noch durch das Mauerpförtchen an der Frankenberger Kirche Einlaß zu gewinnen, die ragend und dräuend von der Höhe durch das Grau des Abends herabdämmerte. Richerdes aber folgte der Fahrstraße zum Klaustor, die seiner Wohnung in der Bergstraße näher lag.
Das Haus in der unteren Bergstraße war schon versperrt. In der Dunkelheit des Abends konnte man von ihm nicht mehr erkennen als die gewaltigen Umrisse, die in der engen Straße doppelt stark wirkten. Ein großer Torweg zu oberst war schon verschlossen, wie Richerdes feststellte; also mußte er den Klopfer des Haustores in Bewegung setzen, daß ihm Einlaß wurde. Die Hausglocke schnepperte noch eine Weile in immer mehr verklingenden Tönen nach, als er über den mit Steinplatten abgedeckten Hausflur schritt, um noch einen Blick auf den Hof und in die Stallungen zu werfen.
»Ist Besonderes vorgekommen?« fragte er eine Magd, die ihm begegnete. »Nein, nur die Frau hat des öfteren nach Euch gefragt.« Da gab er sein Vorhaben auf und wandte sich sogleich der Wohnung zu, die um wenige Stufen höher, zur Seite des Flures lag. In dem großen Wohnzimmer sandten die Kerzen eines mehrarmigen Leuchters ihre Strahlen umher. Sie scheiterten indes bei dem Versuch,[S. 80] bis in die dunkeln Ecken des Gemaches zu dringen. So dunkel war es nach der Rückwand zu, daß man kaum die Tür bemerkte, welche dort in die Schlafkammer führte. Sie öffnete sich in diesem Augenblick, und Venne, die Tochter, trat heraus, um den Vater zu begrüßen, da sie die Hausglocke gehört hatte.
»Wie geht es der Mutter?« war die erste Frage.
»Sie ist etwas unruhig, seit Ihr fort seid. Ich war froh, daß in Eurer Abwesenheit Schwester Jutta vom Kloster Mariengarten hier war. Ihr wißt ja, daß sie auf Mutter immer einen wohltätigen Einfluß ausübt. Auch heute legte sich unter ihrem gütigen Zuspruch die Gespanntheit der Nerven. 's ist eine gute Frau, diese Jutta; wir schulden ihr einen Gotteslohn. Ist es nicht gerade, als ob unter ihrer kühlen Hand und dem gütigen Trostwort alles Ungemach davonfliege?«
»Ja, wir haben allen Anlaß, ihr dankbar zu sein in dieser schweren Zeit«, antwortete der Vater. »Ich weiß nicht, wer durch diese treue Freundschaft mehr geehrt wird, die Mutter, der die fromme Frau auch unter dem Schleier noch die Zuneigung bewahrt, oder jene selbst, deren edle Eigenschaften durch diese Pflege alter Beziehungen in ein um so schöneres, helleres Licht gerückt werden. Aber jetzt geht es ihr doch besser, der Armen, Leidgeprüften?« fragte er besorgt.
»Sie schläft. Ich mußte sie über Euer langes Ausbleiben beruhigen, wolltet Ihr doch schon am Nachmittage zurück sein.«
»Wollte ich auch, und wäre ich auch, wenn ich nicht den Montanen, Herrn Bandelow, getroffen hätte, mit dem es ein langes und breites über Holzleistungen und -lieferungen[S. 81] zu besprechen gab, und auch sonst ist noch manches zwischen uns beredet worden.«
»Dachte ich's mir doch, daß Ihr einem Schwätzer wie dem in die Hände gefallen wäret. Laßt Euch mit dem nur nicht zu sehr ein; ich werde die Sorge nicht los, daß Euch und uns durch seine Einmischung zuletzt noch Übles widerfährt«, hielt Venne dem Vater entgegen.
In Richerdes' Augen war ein froher Glanz getreten, als er die Tochter bei ihrem Eintritt ins Zimmer mit dem Blick umfaßte. Der ganze Mann schien geändert, seitdem er das Zimmer betreten hatte; nichts mehr von der düsteren, grämlichen Stimmung, die ihn im Gespräche mit Bandelow beherrschte. Es war für ihn ein ungeschriebenes Gesetz, alles, was er an Verärgerung draußen erlebte, nicht über die Schwelle des Hauses dringen zu lassen. Nur über seine Gegensätze zu dem regierenden Bürgermeister war die Tochter durch die Mutter unterrichtet. Darauf bezogen sich auch wohl ihre besorgten Worte. So lautete auch die Erwiderung auf Vennes letzte Worte mehr zärtlich freundlich als abweisend:
»Du gibst es ja Deinem alten Vater tüchtig, kleiner Schulmeister; doch sei unbesorgt, was ich mit Bandelow besprochen habe, brauchte nicht das Licht zu scheuen. Daß er den Mund gern etwas voll nimmt, weiß ich besser als Du und richte mich von vornherein darnach. Aber das Geschäftliche muß schon mit ihm beredet werden; und Du weißt ja, daß er mein hauptsächlicher Holzlieferant ist. Die Verhältnisse im Berge liegen leider so, daß ich mehr auf ihn angewiesen bin, als mir lieb ist. Doch nun genug vom Geschäft und seinem Ärger.«
Venne strich ihm zärtlich über das Haar. Es war ein[S. 82] großes, schlankes Mädchen, das hier von dem gelben Lichte der Kerze übergossen wurde.
Wer die Venne Richerdes nach dem Bilde sich vorstellte, welches Heinrich Achtermann von ihr mit in die Fremde nahm, würde sie kaum wiedererkannt haben. Nur die stolze Haltung des Köpfchens und die seelenvollen Augen, über die im Augenblick noch ein Schatten der Trauer um die kranke Mutter gebreitet lag, erinnerte an die Venne von ehemals. Aus der unscheinbaren Puppe hatte sich ein glänzender Schmetterling entwickelt. Nichts mehr gemahnte bei Venne an das eckige, unbeholfene Ding, das vor Heinrich Achtermann davongelaufen war.
Das lang herabwallende, faltige Hausgewand, das sich lose um die königliche Gestalt schmiegte, ließ die edlen Formen des Körpers erraten. Mit lässiger Anmut bewegte sie sich um den Vater, während sie mit der klangvollen Stimme ihm Rede und Antwort stand auf seine Fragen.
»Soll ich uns den Abendtisch decken lassen?« fragte sie weiter. In diesem Augenblick erklang durch die angezogene Tür des Schlafgemaches die Stimme der Kranken, die nach dem Vater fragte. Statt der Antwort trat dieser sogleich zu ihr herein. Behutsam beugte er sich zu ihr nieder, und alle Zartheit und Liebe, die er für diese Frau empfand, klang aus seiner Stimme. Sie mußte ehedem eine schöne Frau gewesen sein; jetzt lagen die Schatten der langen Krankheit auf ihrem blassen Gesicht. In Venne stand ihr verjüngtes Ebenbild vor ihr. Nur ein leichter, kritischer Zug um den Mund unterschied diese von der Mutter. An der Kranken war, von dem leidenden Zug abgesehen, der seine Runen in ihr Antlitz gegraben hatte, alles Weichheit, Hingabe, während Venne über eine nicht alltägliche Entschlossenheit[S. 83] gebot, die ihr, dem jungen Mädchen, den Gehorsam des Hauspersonals sicherte, vom letzten Eseltreiber bis zur alten Katharina in der Küche, ihrer Kindsmagd, mit der sonst niemand anzubinden wagte und von der selbst der gestrenge Hausherr ein Wort mehr annahm, als er sonst von irgend jemand gelten ließ.
»Wie geht es Dir, Liebste? Ich höre von Venne, daß Du wieder besonders mit Dir zu tun gehabt hast. Schwester Jutta hatte ja, wie so oft, ihr Bestes an Dir getan, aber soll ich nicht doch noch den Doktor Henning holen lassen?«
»Nein, nein, ich bitte Dich. Mir ist jetzt nach dem kurzen Schlaf sehr wohl. Es war auch weniger das Leiden, das mir zusetzte, als eine innere Unruhe, die wuchs, je länger Du ausbliebest. Es lag auf mir wie die Vorahnung von einem Unheil.«
»Nun bekomme ich von Dir auch noch eine Strafpredigt,« scherzte Richerdes gutlaunig. »Vorhin hat mich Venne schon ins Gebet genommen. Wenn ich nun Besserung gelobe für die Zukunft, willst Du dann auch mein braves Weib sein und Dich alsogleich völlig beruhigen?«
Ihm zärtlich von ihrer Lagerstätte zunickend, ließ sie den Blick an seiner hohen Gestalt emporgleiten. Ein leiser Seufzer entrang sich ihrer Brust. »Was hast Du noch?« fragte er aufs neue besorgt. »Nichts, es ist nur der Kummer, daß ich Euch das Leben mit meinem Siechtum belaste. Ihr könnt das gar nicht auf die Dauer ertragen.«
»Das ist mir das rechte Medikament«, rief der Gatte gutmütig polternd. »Jetzt habe ich meine ganze ungeschlachte Liebenswürdigkeit an diese eigensinnigste aller Frauen verschwendet,[S. 84] um nun zum Dank von ihr zu hören, daß sie uns lästig falle. Nun sprich Du ein Machtwort, Venne; vielleicht, daß Du Dir mehr Respekt verschaffst.«
Venne umschlang die geliebte Mutter zärtlich behutsam und barg ihr Gesicht an der Wange. »Ach, böses, liebes Mütterlein, der Vater hat nur zu recht. Wie sollten wir unsere Liebe zu Euch besser zum Ausdruck bringen, als daß wir Euch umhegen und umgeben mit unserer Pflege. Ihr sollt uns ja bald gesund sein und werdet uns gesunden; aber, daß ich's sage, Gott verzeihe mir die Sünde: ich wünschte nicht, daß Ihr krank gewesen wäret oder je wieder würdet; doch desungeachtet möchte ich, und der Vater gewiß mit mir, nicht diese Zeit missen, wo wir Euch Eure Liebe wenigstens zu einem kleinen Teile vergelten konnten. Nun fügt Euch nur noch eine kurze Zeit unserer strengen Vormundschaft, und dann wird eines Tages mein Mütterlein wieder rüstig und flink durchs Haus trippeln, und wir werden uns auf die Bärenhaut legen; gelt, Vater?«
Gerührt blickte die Kranke auf ihr Mägdelein, und eine Träne rann über die blasse Wange.
Ach, wenn es doch so käme, wie Venne es ihr prophezeite!
In diesem Augenblick wurden sie durch wirren Lärm von der Straße aufgescheucht. Stimmen und Schreie erklangen durcheinander, und alsbald erhob die Sturmglocke der benachbarten Marktkirche ihre wimmernde Stimme. Angstvoll schrak die kranke Frau zusammen und griff nach dem Herzen. Venne eilte ihr sogleich zu Hilfe. Auch ihr wie dem Vater war sehr bange, denn man glaubte nicht anders, als im nächsten Augenblick das gefürchtete »Feuerjo« draußen zu hören, welches verriet, daß der schlimmste Feind der[S. 85] mittelalterlichen Städte sein rotes Banner auf den Dächern der Stadt aufgepflanzt habe. Richerdes, der zu den Führern der Feuerwehr gehörte, die pflichtmäßig alle nicht bresthaften Bürger mit den ledernen Feuerlöscheimern zur sofortigen tätigen Hilfe bei Ausbruch eines Brandes veranlaßte, stürzte nach einem kurzen, hastigen Abschiedswort davon und ließ die Frauen in banger Spannung zurück. Der Lärm draußen verlor sich bald, und auch das Gewimmer der Glocke erstarb. Die Annahme, daß eine Feuersbrunst ausgebrochen war, schien demnach irrig zu sein; wahrscheinlich handelte es sich um irgendeinen Angriff oder Überfallversuch, wie die unruhigen Zeiten ihn nicht selten brachten. In angstvoller Erwartung harrten die beiden Frauen der Rückkehr des Vaters und Gatten. Endlich, viel zu spät für ihre Ungeduld, ertönte der Klopfer, und Venne beeilte sich, zu öffnen, da das Gesinde inzwischen zur Ruhe gegangen war. Der Überfall auf die flandrischen Kaufleute bei Riechenberg hatte den Tumult veranlaßt. Noch kannte man nicht alle Einzelheiten. Es sollte viele Tote und Verwundete gegeben haben und Plünderung der Waren, wie das Gerücht bei solchen Anlässen zu wüten pflegt. Die Kunde war von einem Knechte überbracht worden, der auf schweißbedecktem Roß vor dem Sankt-Viti-Tor in der Dunkelheit auftauchte und um eilige Hilfe und Schutz bat. Die Stadtsoldaten unter ihrem Hauptmann und ein großer Haufen bewaffneter Bürger waren sofort ausgezogen, und zur Stunde, so durfte man hoffen, hatten die Bedrängten schon Hilfe gefunden, und sie selbst waren unter sicherer Bedeckung im Anzuge gegen die Stadt.
Richerdes kehrte nur zurück, um die Frauen zu unterrichten und sie zu beruhigen. Er verließ bald darauf wieder[S. 86] das Haus, um den Ausgang und weitere Aufklärung des Falles zu erfahren. Auch bei ihm sprach seit Jahren einer der Kaufleute vor, der auch dieses Mal dabeisein mußte. Noch mehr Grund also, zur Stelle zu sein, wenn die Überfallenen ankamen, um dem alten Geschäftsfreunde zugleich hilfreich zur Seite zu stehen, wenn er die Stadt betrat.
[S. 87]
[S. 88]
Im Kamin prasselte ein lustiges Feuer und verbreitete eine angenehme Wärme über den Raum, in dem die Familie Richerdes am reichgedeckten Frühstückstisch mit dem Gaste, Herrn Emile Delahaut aus Dinant, saß. Das Gespräch drehte sich natürlich um den gestrigen Überfall. Er war so weit geklärt, daß man wußte, das Stücklein ging, wie man gleich vermutete, von dem berüchtigten Bandenführer Hermann Raßler aus, der, wie jedermann bekannt war, im geheimen Dienste des Herzogs von Braunschweig stand und die Goslarer schatzte, daß ihnen der Atem auszugehen drohte. Zwei seiner Knechte, mit denen er den frechen Überfall gewagt hatte, blieben verwundet in den Händen der Goslarer, und aus ihrem Munde erfuhr man alle Einzelheiten. Demnach war der eigentliche Urheber des verruchten Planes jener Händler aus Helmstedt, der selbst bei der Tat seinen Lohn erhalten hatte. Er traf morgens in aller Frühe in Riechenberg ein, wo man ihm den Schlupfwinkel Raßlers anzeigte. Die Knechte, die beim Herannahen des Zuges in Langelsheim so eilig Fersengeld gaben, waren Kundschafter, die melden sollten, wann mit dem Eintreffen am Hohlwege zu rechnen sei. Es stellte sich nunmehr als sicher heraus, daß der ganze Überfall nicht den Kaufleuten, sondern Heinrich Achtermann gegolten hatte und jedenfalls dazu dienen sollte, ihm das wichtige Dokument abzunehmen. Was unterwegs mit List nicht gelungen, das wollte man zum Schluß mit Gewalt herbeiführen.
Damit war auch der Auftraggeber ohne weiteres erkannt: es konnte nur der Braunschweiger sein, dem an der Vernichtung des päpstlichen Schreibens allein lag. Durch seine Spione in der Stadt mußte er irgendwie von dem Auftrage und dem Wege der Heimreise Heinrichs Kunde erhalten haben und hatte danach seine Maßnahmen getroffen. Sein unmittelbarer Vorfahre, Heinrich der Ältere, hatte den besonderen Schutz der Stadt Goslar noch für 400 Gulden im Jahre 1497 auf zehn Jahre übernommen. Die Herzöge Philipp und Erich ließen sich noch vom Jahre 1500 ab zehn Jahre lang für die gleiche Leistung 1200 Gulden im voraus geben. Heinrich der Jüngere trat in diesen Vertrag ein. Das hinderte ihn aber nicht, im geheimen seine Blut- und Beutehunde gegen die Stadt loszulassen. Der Streich war mißglückt, doch man wußte, wessen man sich in Goslar von dieser Seite zu versehen hatte trotz aller Schutzbriefe. Da der Angriff auf herzoglichem Gebiete erfolgte, der Nachweis geführt war, daß Raßler der Anstifter gewesen und offenbar bei den dem Herzoge befreundeten Mönchen von Riechenberg Unterstützung genossen hatte, ging ein geharnischter Protest des Rates nach Wolfenbüttel ab, wo der Herzog residierte. Der Erfolg war freilich vorauszusehen. Der Herzog lehnte mit der für diesen Fall gebotenen Entrüstung jede Mitwissenschaft und Teilnahme ab. Die wirklich Leidtragenden waren die beiden Schelme, die man gefangen hatte; sie baumelten bald darauf am Galgen, der sein Gerüst auf dem Georgenberge drohend ins Land reckte.
Auch der Fremden wegen erhob man den Einspruch beim Herzoge, um ihnen zu zeigen, daß man alles tue, um ihnen Genugtuung zu geben. Denn sie führten natürlich auch ihrerseits, sei es auch nur, um ihr Geschäft günstig zu beeinflussen,[S. 89] bewegliche Klage über die erlittene Unbill und die Unsicherheit der Wege in unmittelbarer Nähe der Stadt; Schaden an Eigentum war kaum erlitten, abgesehen von einigen Warenballen, die von den Wagen gestürzt und etwas beschädigt waren. Dem Anschein nach hatten die Raubgesellen, obwohl ihr Auftrag nur dahin ging, sich des goslarschen Gesandten zu bemächtigen, doch ihrer oft bewiesenen Beutelust nicht widerstehen können, zu nehmen, was sich ihnen bot. Der steile Hang und der fluchtartige Rückzug hinderten sie dann aber an der Mitnahme.
Über der Besprechung des gestrigen Ereignisses vergaß man nicht, den guten Sachen Ehre anzutun, die der Tisch bot. Venne ging ab und zu, um nach der Mutter zu sehen und den Mägden eine Anweisung zu geben. Im hellen Licht des Tages sah man erst, welch vollendete Schönheit sie war. Die Anmut ihrer Bewegungen, der Wohllaut ihrer Stimme vereinigten sich gleichermaßen, um den Fremden gefangenzunehmen.
»Wetter noch einmal,« warf er dem Gastfreunde zu, als Venne sich auf einen Augenblick entfernt hatte, »ist das ein Mädel geworden, seit ich sie zuletzt sah! Wie das den Kopf trägt und sich bewegt! Wahrhaftig, wenn ich nicht schon ein alter Knabe wäre, könnte mich Eure Venne noch zu Abenteuern verleiten. Verwahrt den Schlüssel zu ihrem Herzen gut, sonst fliegt sie Euch über Nacht davon. Lange werdet Ihr sie sowieso nicht mehr halten, sonst müßten Eure Jungen hier Fischblut in den Adern haben.«
Richerdes lächelte behaglich zu dem Lobe der Tochter: »Vorläufig scheint ihr selbst noch wenig an dem Ausfluge aus dem Elternhause zu liegen, dazu hält sie die Pflege der kranken Mutter viel zu fest. Findet sich aber einmal der[S. 90] Rechte, so werden wir sie nicht halten wollen. Denn es ist der Eltern wie der Kinder Los, sich trennen zu müssen, wenn sie des anderen Wert erkennen.«
Man kam noch einmal auf das gestrige Abenteuer zu sprechen und auf die Goslarer, die dabei zu Schaden gekommen, Heinrich Achtermann und Erdwin Scheffer. Dieser, der Sohn eines achtbaren Mitgliedes der Schustergilde, war am übelsten davongekommen, und man wußte nicht, ob er am Leben bleiben werde. Heinrich Achtermann dagegen hatte, wie es hieß, keinen ernsten Schaden erlitten. Durch das Würgen der Angreifer und den Sturz auf einen Stein verlor er die Besinnung. Als die Hilfe aus der Stadt kam, war er schon wieder zum Bewußtsein zurückgekehrt.
Nach dem Frühstück gingen die Herren zum Geschäftlichen über. Da schlüpfte Venne aus dem Hause, um sich in der Stadt umzuhören und bei den Achtermanns vorzusprechen, die mit ihrer Familie befreundet waren. Sie wurde beim Eintritt ins Haus von der Schwester Heinrichs begrüßt. Von ihr vernahm sie, daß es dem Bruder schon wieder leidlich gehe, und sie konnte sich selbst davon überzeugen, denn sie traf ihn im Zimmer, wo er mit den Eltern und dem flandrischen Gastfreunde zusammen saß. Die überstandene Gefahr hatte keine Spur zurückgelassen, außer einer leichten Blässe im Gesicht.
Als Venne ihn unvermutet vor sich sah, war sie einen Augenblick befangen, denn die Stunde stand ihr vor Augen, als sie zuletzt die Flucht vor ihm ergriff. Sogleich stieg auch der alte Trotz wieder in ihr auf, und das herzliche Wort, das sie ihm zur Begrüßung gönnen wollte, wurde zu einem kühlen Gruß. Heinrich glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen, als Venne eintrat, ja, er, der nie Verlegene,[S. 91] starrte sie einen Augenblick wie entgeistert an: War denn dieses Mädchen von vollendeter Schönheit das hagere, eckige Ding, das er vor langem verlassen hatte? Und er wäre nicht der Mann mit dem für Frauenschönheit empfänglichen Herzen gewesen, wenn nicht dieses holde Menschenkind sogleich in ihm höchste Bewunderung mit der Regung jener Sehnsucht gepaart hätte, die der Schönheit im eigenen Herzensschrein einen Altar zu errichten gewillt ist. Er war bisher der Schmetterling, der an allen Blüten naschte. Für die reizenden Bologneserinnen schwärmte er, der lebensfrischen Richenza Walldorf flog sein Herz entgegen, aber ihre Spur war verwischt, ausgelöscht vor dem wundersamen Geschöpf, das da vor ihm stand. Wie ein Schlag durchzitterte es seine Brust: Die hält Dein Schicksal in ihrer Hand, Venne Richerdes mußt Du besitzen oder keine!
So standen beide sich einen Augenblick verwirrt gegenüber. Venne sah seine Blicke auf sich gerichtet, aber sie ahnte nicht, welche Gefühle ihn durchzitterten. Da fand Heinrich zuerst das Wort. Um seine Befangenheit zu meistern, griff er zu dem alten Mittel tändelnden Scherzes und war dabei in Gefahr, alles schon im ersten Augenblick zu verderben.
»Euch trieb gewiß die Angst um mein Befinden hierher, aber Ihr seht ja, Unkraut vergeht nicht.« Venne suchte sich sogleich mit ihrer ganzen kühlen Unnahbarkeit zu wappnen. »Ihr irrt Euch; ich kam vor allem, um Eure Schwester zu besuchen. Daß mich auch Sorge um Euch erfüllte, will ich nicht leugnen; aber ich sehe ja, daß Ihr wohlauf seid, so will ich Euch auch mit meiner Teilnahme nicht lästig fallen.«
»Gut gegeben, Jungfer Dornenhag«, antwortete Heinrich[S. 92] munter lachend. »Aber um Euch zu versöhnen, will ich Euch auch etwas Angenehmes sagen. Ratet nur, was!«
»Ich bin nicht allzu begierig darauf, denn ich versehe mich keiner besonderen Schmeicheleien von Euren Lippen«, entgegnete Venne halb ablehnend.
»Eine Schmeichelei ist's auch nicht, aber ein schöner, herzlicher Gruß von Eurem Oheim Ernesti. Eigentlich sollte ich auch den dazugehörigen Kuß mit überbringen,« log er hinzu, »aber das habe ich als lebensgefährlich abgelehnt.« Venne achtete auf die letzten Worte kaum noch. »Vom Oheim Ernesti und der Muhme wahrscheinlich? Oh, das ist schön. Erzählt doch nur gleich, wo Ihr ihn trafet und wie Ihr sie fandet.« Und Heinrich berichtete ausführlich über sein Zusammensein mit dem Oheim und seine Aufnahme in Soest.
In diesem Augenblick trat Johannes Hardt ins Zimmer, der ebenfalls kam, um sich nach dem Befinden des Freundes zu erkundigen. Der Ratsherr forschte nach allen Einzelheiten der Reise und kam dann von Ernesti und dem gestrigen Überfall auf die Zeitläufte zu sprechen. Da überließ die Jugend die Alten ihren ernsten Gesprächen. Die Mädchen schlüpften hinaus in das Zimmer der Schwester. Für heute erhielten auch Heinrich und Johannes dort Zutritt, denn man war doch gar zu begierig, über ihre Erlebnisse im Wunderlande Italien Einzelheiten zu erfahren. Und die beiden Wanderer erzählten und erzählten, und ihre Zuhörerinnen wurden nicht müde, ihnen zuzuhören.
»Aber eins fällt uns auf,« warf Venne, zu Johannes gewendet, schalkhaft ein. »Von den schönen Bologneserinnen haben wir bis jetzt gar nichts vernommen. Sind sie ausgestorben,[S. 93] oder habt Ihr ihnen dauernd Eure Gunst vorenthalten? Das wäre ja ein gräßliches Verbrechen.« Einen Augenblick wollte der junge Mann erröten, aber schon kam ihm Heinrich zu Hilfe: »Es gibt ihrer noch genug,« antwortete er, »sogar recht liebreizende, aber unsere Beziehungen zu ihnen werden wir Euch erst enthüllen, wenn Ihr uns verratet, in welchen Herzen Ihr Vernichtung angerichtet habt.«
»Da werde ich lange auf Eure Enthüllungen warten können, denn ich bin mir nicht bewußt, irgendeinem Herzen Unglück zugefügt zu haben.«
»Na, na,« warf da die Schwester lächelnd ein, »glaubt ihr nicht so ohne weiteres. Sie ist eine Heimliche. Ich möchte die Seufzer nicht auf meinem Herzen tragen, die ihr nachgeklungen sind. Und sie ist auch selbst nicht unversehrt geblieben, will mir scheinen. Ich müßte sonst die mancherlei Fragen mißdeuten, die sie immer wieder über einen gewissen abwesenden jungen Herrn stellte. Soll ich Namen nennen, Venne?« fragte sie neckend.
»Daß Du Dich nicht unterstehst, du Garstige«, wehrte diese lachend ab, während ein tiefes Rot über ihre Wangen flammte. Die Verwirrung erhöhte noch ihre Lieblichkeit. »Zur Strafe für diese Verleumdung will ich auch gleich aufbrechen.« Aber sie gab doch dem Widerspruch der anderen nach; es hätte ja auch zu sehr nach einem Zugeständnis ausgesehen; und man blieb noch eine kurze Zeit in traulichen Gesprächen beisammen. Dann mußte sie Abschied nehmen, da die Mutter nicht lange ohne Wartung bleiben durfte. Auch für Johannes war es an der Zeit, sich festlich anzukleiden, denn er sollte mit Heinrich zusammen die besondere Ehre genießen, dem Hohen Rat die Schrift des[S. 94] Papstes, die sie mit Gefahr des Lebens verteidigt hatten, in der für die Mittagsstunde anberaumten Sitzung überreichen zu dürfen.
Die Mitglieder des Goslarer Rates hatten in feierlicher Amtstracht sich im Sitzungsraum versammelt, und nun warteten sie des päpstlichen Boten mit der Antwort auf ihr Begehren.
Die Jünglinge wurden von dem Ratsboten hineingeführt, die Ratsherren erhoben sich, und der regierende Bürgermeister, Karsten Balder, begrüßte sie mit freundlichen Worten.
»Ihr seid Träger der Botschaft vom Heiligen Vater, die uns Herr Henricus Ernesti freundwillig vermittelt hat. Wir hören,« wandte er sich dann im besonderen an Heinrich Achtermann, »daß Euch zuletzt noch arges Ungemach getroffen hat. Empfangt mit unserem Bedauern über die erlittene Unbill zugleich unseren Dank für den wichtigen Dienst, den Ihr Goslar geleistet habt.
Es geht um nichts Geringes in dem Schreiben, wie Ihr Euch denken könnt. Ihr habt das Geheimnis treulich an Eurer Brust gewahrt und mit Eurem Leibe verteidigt, so sollt Ihr und mit Euch Euer Freund auch der erste sein, der außer uns von dem Inhalt Kenntnis erhält.«
Damit öffnete der Bürgermeister und gab den Inhalt der päpstlichen Bulle preis.
Demnach versicherte Papst Leo X. seine fromme und getreue Stadt Goslar mit seinem Segen zugleich seines Schutzes, bestätigte in Erneuerung der Briefe des Königs Wenzel ihre ausschließlichen Vorrechte und Ansprüche auf das Bergwerk und die Forsten, versprach ihr seinen Beistand und drohte allen denen mit schweren Kirchenstrafen,[S. 95] welche sie im Genuß dieser Rechte stören oder sie ihnen streitig zu machen versuchten.
Das war ein voller Erfolg. Befriedigt sahen sich die Ratsherren an: Dieses Schriftstück lohnte den Eingriff in den Stadtsäckel, den man getan hatte, um Henricus Ernesti in den Stand zu setzen, sein Anliegen nachdrücklich zu unterstützen. Nun mochten die Braunschweiger kommen; diese Stunde machte die letzte Nichtswürdigkeit wett, deren man den Herzog hier im Rate offen zieh.
»Ihr habt Euch, Herr Heinrich Achtermann, und Ihr ingleichen, Herr Dr. Johannes Hardt, als ehrenfeste, tapfere Männer gezeigt. Der Stadt ist durch Eure Hilfe ein sehr wichtiger Dienst erwiesen, wie Ihr soeben hörtet. Sie wird sich ihres Dankes gegen Euch geziemend zu entledigen wissen. Ihr aber werdet, wie Euer Verhalten beweist, treue, zuverlässige Bürger sein, auf die sie allezeit mit Zuversicht zurückgreifen kann.«
Rot und stolz vor Freude verließen die Freunde das Rathaus und kehrten zu den Ihrigen zurück.
An ihre Stelle trat bald darauf eine Abordnung der fremden Kaufleute, um Beschwerde vorzubringen über den Unglimpf, der ihnen hart vor den Mauern der Stadt widerfahren war. Der Rat wies nach, daß der Überfall nicht auf Goslarer Gebiet vor sich gegangen sei, daß geharnischte Beschwerde an den Herzog abgehen, die ergriffenen Übeltäter hingerichtet werden würden und im übrigen er, der Rat, es als eine selbstverständliche Pflicht übernehme, allen erlittenen Schaden zu ersetzen. Daneben verhieß er tatkräftige Unterstützung bei dem Abschluß ihrer Handelsgeschäfte, bei denen der Rat ja zu einem großen Teile selbst in Frage kam. So zogen auch diese Männer befriedigt ab.
[S. 96]
Am Nachmittage besuchte Heinrich den armen Erdwin Scheffer, der inzwischen von seiner tiefen Bewußtlosigkeit erwacht war, die, wie anfangs zu befürchten schien, unmittelbar in den Tod überzuführen drohte. Die Sonde des Arztes hatte das Geschoß gefunden und es mit aller Sorgfalt entfernt. Unter den schmerzhaften Verrichtungen des Arztes war er abermals in Ohnmacht gesunken; jetzt schlief er. Der Doktor hatte zwar die Verwundung für sehr schwer erklärt, aber doch nicht alle Hoffnung aufgegeben. Nun mußte es sich zeigen, ob der junge, kräftige Körper dem Kranken zur Genesung verhelfen würde. Auch nach Monika erkundigte er sich: der Vater war unwirsch über die Dirne, die dem Sohne bis ins Haus nachlaufe. Sie sei schon am frühen Morgen dagewesen und habe angstvoll nach dem Kranken gefragt. Auch die Mutter, die in dem fremden Mädchen wenig mehr als eine fremde Landstreicherin sah, war ihr ablehnend begegnet. Nur Maria, die Schwester, hatte sich ihrer im Flur angenommen. Sie redete dem jungen Mädchen, das sich in seiner Angst und Sorge keine Hilfe wußte, herzlich zu.
»Ich werde Euch auf dem laufenden halten über die Entwicklung der Krankheit«, sagte sie, indem sie Monika an sich zog. »Will's Gott, so wird doch noch alles gut.«
Bald darauf fand sich auch Gelegenheit, die gute Immecke aufzusuchen. Sie hatte bei der Witwe eines ehrbaren Handwerksmeisters Wohnung gefunden. Noch war sie sich nicht schlüssig, wohin sie ihre Schritte lenken werde. Erst wollte sie abwarten, wie sich der Zustand Scheffers gestaltete, denn Monika erklärte, daß sie nicht von Goslar weichen werde, bis sie darüber im klaren sei. Die Wanderfahrt im Kriege hatte der braven Marketenderin manchen Gulden eingebracht,[S. 97] und wenn sie den Inhalt des Beutels wog, den sie wohlverwahrt hielt, war ihr um ihre und der Tochter Zukunft nicht bange.
Die Herren aus Flandern und Frankreich prüften die goslarsche Ware und fanden wenig auszusetzen. Die Stapel der erworbenen Metallbarren wurden immer größer, die Geldkatze immer magerer. Hier und da erfuhr sie eine vorübergehende Auffüllung durch günstigen Absatz der mitgebrachten flandrischen Waren: Teppiche, Gewebe, feine Tuchstoffe, die in den benachbarten Städten wie in Goslar selbst willige Käufer fanden. Neben dem Erwerb des kostbaren Metalls war indessen die Aufmerksamkeit der fremden Kaufleute noch auf ein anderes gerichtet.
Als der Rat von Goslar zur Wiederbelebung des namentlich durch Wassereinbrüche verunglückten Bergwerkes einen Zusammenschluß der Berechtigungen in einer Form erstrebte und ins Werk setzte, die man heute als Gewerkschaft bezeichnen würde, behielt er von vornherein das Ziel im Auge, die Anteile später durch stillen Ankauf in seine Hand zu bringen. Er wußte es daher mit Geschick zu erreichen, daß die Mehrzahl der Anteile, soweit er sie nicht selbst besaß, in den Händen von Bürgern blieb, von denen er sie später erwerben zu können hoffte. Daß er dabei bei mehr als einem auf hartnäckigen Widerstand traf, bewies der Montane Richerdes. Karsten Balder, derzeitiger regierender Bürgermeister, war durchaus nicht von der Voreingenommenheit gegen Richerdes beseelt, die dieser ihm unterschob. Zwar hatte er als Jüngling der schönen Mathilde von Hagen, des[S. 98] Ratsherrn und Silvanen von Hagen Tochter, gehuldigt, und sie als sein Eheweib heimzuführen, war sein sehnlicher Wunsch gewesen. Aber er fand sich längst damit ab, daß Richerdes ihm den Rang abgelaufen. Er lebte selbst in glücklicher, mit Kindern gesegneter Ehe, und sein gerader, ehrliebender Charakter hätte es nie zugelassen, seine Machtstellung in den Dienst der Willkür zu stellen, um für vermeintlich oder wirklich erlittene Unbill Vergeltung zu üben. Was er mit Richerdes wie mit anderen Berechtigten verhandelte, was er von ihnen forderte, lag im wohlverstandenen Interesse der Stadt. Er handelte schließlich nur als der Verwalter des von Werenberg hinterlassenen Erbes, wenn er dessen Pläne zur Ausführung zu bringen versuchte. Bei dem Argwohn, den ihm Richerdes von vornherein entgegenzubringen sich bemühte und den er auch seinen Angehörigen einzureden verstand, war es nicht zu verwundern, daß dieser in allem, was von Balder ausging oder vom Rathause kam, eine Falle witterte und daß der Verkehr mit dem Rate für ihn eine Quelle ständigen Ärgers war.
Damals, als der Bergbau im argen lag und der Rat mit großen Kosten fremde Techniker heranzog, wie Meister Nikolaus von Ryden, um des Wassers Herr zu werden, war auch der Ertrag des Bergbaus sehr gering, und statt eines Gewinnes hatten die Gewerke dauernd Zubußen zu zahlen. Das goslarsche Kupfer, das sich den Weltmarkt zu erobern im Begriff gewesen war, verschwand mehr und mehr, und sein Name erklang weniger in den Kreisen derer, die darauf angewiesen waren. Jetzt aber bildete es eine der Lebensnotwendigkeiten für den gewerbfleißigen Westen. Die Zahl der Käufer wuchs von Jahr zu Jahr. Was Wunder, wenn den Flamen und Holländern der Wunsch[S. 99] kam, die Quellen selbst mit ausschöpfen zu können, Mitbesitzer des Bergwerks durch die Erwerbung von Anteilen zu werden. Beim Rate hatte sie, wie sie bald merkten, auf Erfolg nicht zu rechnen, da er in zielbewußter Verfolgung seiner Politik im Gegenteil darauf aus war, alle Anteile in seiner Hand zu vereinigen. Aber auch bei den Bürgern stießen sie auf Widerstand. Vergeblich bewiesen sie dem Besitzer des Anteils, daß die aus dem Kapital sich ergebende Rente besser sei als das in seiner Ergiebigkeit unsichere Recht. Je eifriger sie zuredeten, desto größer wurde der Widerstand.
Auch der Gast- und Geschäftsfreund des Bergherrn Richerdes, Herr Emile Delahaut aus Dinant, suchte diesen zum Verkauf seiner Anteile oder eines Teiles derselben zu bewegen, doch auch er wandte vergeblich seine ganze Beredsamkeit auf. Richerdes wie die anderen Goslarer, deren Ansprüche die Freunde erwerben wollten, wurden durch das eifrige Werben nur um so mehr in ihrer Meinung von dem Werte ihrer Rechte bestärkt. So gelang es den Ostgängern, die alljährlich nach Goslar kamen, kaum, einen oder den anderen Anteil zu erwerben. Freilich waren Richerdes wohl einmal leichte Zweifel an dem dauernden Werte seines Anrechtes aufgestiegen, und letzthin hatten sie sich noch verstärkt. Wie er Ludecke Bandelow auf dem Heimwege vom Granetal her klagte, befriedigte der Erfolg seiner Grube seit längerer Zeit nur wenig; und einmal war er wirklich einen Augenblick schwankend geworden, vor nicht langer Zeit nämlich, als der Ratsherr Achtermann, ein Mann von großem Reichtum und Ansehen, bei ihm vorsprach, um mit ihm noch einmal über den Verkauf an die Stadt zu reden. Zunächst lehnte Richerdes, wie früher schon, schroff ab, aber[S. 100] Achtermann, vor dessen Geschäftstüchtigkeit auch jener große Achtung hatte, ließ sich nicht beirren.
»Ich will Eure verstockte Voreingenommenheit gegen Karsten Balder, die ich wohl kenne, einmal außer acht lassen; versucht Ihr dasselbe. Ihr könnt ja zuletzt doch tun und lassen, was Ihr wollt. Daß uns viel an dem Besitz liegt, wißt Ihr; weshalb, ist Euch ebenfalls bekannt, wie endlich auch, daß wir ihn nicht geschenkt haben wollen. Wir wissen beide, daß es mit dem Gewinn aus Euren Gruben nicht zum besten aussieht, im Augenblick wenigstens nicht«, warf er auf eine ablehnende Bewegung von Richerdes ein. »Sie kann wieder ergiebiger werden, die Erzader kann sich aber auch ganz erschöpfen oder als taub ausweisen. Was dann? Dann seid Ihr ein armer Mann.
Damit Ihr seht, daß ich es wirklich ehrlich meine, will ich ganz offen gegen Euch sein. Ihr habt eine hübsche Tochter, die Euch ans Herz gewachsen, ich einen Sohn, dem sie, wie ich glaube, nicht gleichgültig ist. Ich könnte mir vorstellen, daß hier etwas im Werden ist, das wir durch entschlossenes Eingreifen stören, durch stilles Gewährenlassen aber der Reife entgegenblühen sehen können. Ich will und werde mich nicht in Liebesgeschichten meines Sohnes einmischen; handelt Ihr ebenso, dann haben wir uns später nichts vorzuwerfen. Eure Venne ist mir lieb und wert und ich würde mich, ungeachtet der Unterschiede in unseren Verhältnissen, nicht bedenken, sie als Schwieger willkommen zu heißen. Ich werde aber nie einwilligen, daß mein Sohn die Tochter eines Bettlers heimführte. Entschuldigt das harte Wort, indes es muß gesprochen werden, denn Offenheit, zumal bei diesem heiklen Punkte, liebe ich vor allem.«
[S. 101]
Damit weckte aber Achtermann alles, was an Trotz und Widerspruchsgeist in Richerdes schlummerte. »Ich dränge meine Tochter niemand auf, jetzt nicht und niemals. Wenn Ihr also keine weiteren Gründe für Euer Anliegen vorzubringen habt, so hättet Ihr Euch die Mühe ersparen können.«
»Nichts für ungut«, erwiderte Achtermann, ungerührt durch die Heftigkeit seines Gegenübers. »Ich sehe gern klare Verhältnisse vor mir.« Dann lenkte er, sich zum Aufbruch anschickend, mit einer teilnehmenden Frage nach dem Befinden der kranken Hausfrau auf ein anderes Gebiet über.
»Ich hörte kürzlich in Braunschweig von einem neuen Mittel, das bei Leiden der Art Wunder wirken soll. Ich habe es im Augenblick vergessen, will mich aber, kann ich Euch damit einen Gefallen erweisen, gern danach umtun. Im übrigen halte ich mich Eurer armen Frau Eheliebsten bestens empfohlen, bitte, ihr auch von meiner Frau die besten Grüße mit dem aufrichtigen Wunsch baldiger Genesung ausrichten zu wollen. Sie hofft, bei guter Gelegenheit nächstens sich selbst nach ihr umsehen zu können. Und nun,« damit schied der Einflußreiche und versetzte ihm einen leichten Schlag auf die Schulter, »alter Murrkopf, einen schönen Gruß auch dem Töchterlein!« Lächelnd schied er, und lächelnd gab ihm Richerdes das Geleite. Dann kehrte er in die Stube zurück.
Die Worte Heinrich Achtermanns gingen ihm durch den Kopf, und die Sorge wurde damit nicht geringer. Wenn die Befürchtungen des Ratsherren eintrafen, stand es allerdings schlecht mit ihm und den Seinen, und er selbst war dann, wenn kein Bettler, doch ein armer Mann, dessen Tochter zu freien, mancher sich scheuen würde. Was Achtermann[S. 102] von den Beziehungen zwischen den Kindern sagte, war ihm neu. Er beschloß, mit der treuen Lebensgefährtin auch dieses zu besprechen. Sie, die ihm so manches Mal schon guten Rat gewußt hatte, würde gewiß auch dieses Mal das Rechte treffen. Das Glück ihrer Venne stand beiden am höchsten, und diesem Glück sollte auch sein Eigensinn und sein Widerwillen gegen Karsten Balder nicht entgegenstehen; das nahm er sich vor.
[S. 103]
[S. 104]
Der Tribut des Alters an die Zeit ist Verblassen und Verblühen, ist Schwinden von Schönheit und Kraft. Was im Werden und Vergehen des Menschen gilt, hat auch im Leben der Städte nur allzuoft eine traurige Bestätigung gefunden. Von der Herrlichkeit einer alten großen Zeit zeugen heute nur noch kärgliche Reste, hier und da ein brüchiger Turm oder die ins Leere starrenden Zinken einer Turmruine, ein Stückchen Stadtmauer, eine hochragende Kirche, welche die Armseligkeit der sie umlagernden Häuserzeilen nur um so greller hervortreten läßt. Das ist das Schicksal so mancher Stadt geworden, die einst wohlgegürtet hinter Wall und Mauer ihre Rechte verteidigte und mit Herzögen und Königen auf der Stufe des Gleichberechtigten verhandelte. Das schien auch Goslars Los zu sein. Von der Höhe seiner mittelalterlichen Macht war es durch schlimme Kriegsläufe und, damit zusammenhängend, durch das Versiegen seiner Geldquellen, des Bergwerkes und der endlosen Forsten, Stufe um Stufe herabgeglitten. Was um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts übrigblieb, wies alle Anzeichen eines schnellen unaufhaltsamen Verfalles auf. Die Zahl der Einwohner war erschreckend gesunken, in den weiten Mauern wohnte ein armseliges, müdes Geschlecht, das in seinem Elend mit dem Erbe einer großen Vergangenheit nichts Besseres anzufangen wußte, als daß es sich aus dem alten Gewande neue Stücke schnitt, um seine Blöße zu verbergen. Es ist die böse Zeit, wo die Brüderkirche niedergelegt, wo der ehrwürdige Dom auf Abbruch verkauft wurde. Die Domkapelle, die allein von dem alten Münster noch Zeugnis ablegt, läßt uns ahnen, was in jenen Jahren unwiederbringlich verlorenging. Gar manches Kapitäl oder Gesims, an verlorener Stelle in eine Gartenmauer eingefügt oder einem Speicher als Eintrittsschwelle dienend, erinnert an diese schlimme Zeit, wo das sterbende Goslar sich seines Schmuckes zu entkleiden begann, um als Bettler ins Grab zu steigen.
In dieser Zeit des Verfalles, und noch später, ist vieles dem Unverstande wie der Not zum Opfer gefallen, auch von den ehemals geschlossenen Festungsanlagen; aber vieles blieb doch auch erhalten und legt noch heute Zeugnis ab von dem wehrhaften Sinn der Altvordern, so die gewaltigen Tortürme, deren am Breiten Tore, die Stirn dem Braunschweiger zugewandt, gleich ein ganzes Rudel auftritt. Sie ragen noch heute ebenso trutzig wie zur Zeit ihrer Errichtung in die Lüfte.
Die stattlichsten unter ihnen, der große Turm am Breiten Tor, der Dicke Zwinger in der Nähe der Kaiserpfalz, dessen 24 Fuß starke Mauern noch heute das Staunen der Besucher erregen, der Papenzwinger, sie verdanken ihren Ursprung der Zeit, da unsere Geschichte spielt. Die Goslarer wollten ihre Stadt zu einer uneinnehmbaren Festung ausbauen. Sie hatten Anlaß dazu; denn die Zahl ihrer Feinde und Neider wurde größer in dem Maße, wie der Wohlstand und die Macht der Stadt wuchs. Ernesti hatte Johannes Hardt die Lage richtig geschildert, aber auch der Rat war sich der Gefahr wohl bewußt und suchte ihr durch geeignete Maßnahmen zu begegnen.
Schon im Anfang des neuen Jahrhunderts war der[S. 105] Grundstein gelegt zu einem weiteren, mächtigen Bollwerk. Um die Herstellung der Anlagen, besonders der Zwinger, hatten sich jeweils einige Bürger verdient gemacht; so war der Papenzwinger der Aufsicht des Worthalters der Gemeinen, wie die Versammlung der Vertreter der Bürgerschaft hieß, Kips anvertraut gewesen. Das neue Bauwerk, das am neuerbauten Rufzen- oder Rosentor sich zu dessen Verstärkung erheben sollte, unterstand dem Schutze des Ratsherrn Achtermann. Er war nicht nur um die Weiterführung besorgt, sondern steuerte auch zu den Kosten einen erheblichen Teil bei. Es entsprach daher nur einem Akt der Dankbarkeit, wenn man das gewaltige Bauwerk ihm zu Ehren als ›Achtermann‹-Zwinger benannte. Es ist der dicke, ungefüge Geselle, der dem Rosentor vorgelagert ist und heute noch die Besucher Goslars beim Eintritt in die Stadt als erster Zeuge seiner ehemaligen Wehrhaftigkeit begrüßt.
Mehrere Jahre hatte der Bau gedauert, einige Male mußte er unterbrochen werden. Jetzt stand er da, riesig und gewaltig, und das Ereignis der Beendigung sollte durch ein Fest besonders gefeiert werden. Die untere Halle, ein gewaltiger Rundraum, war mit Tannengrün festlich geschmückt. Kerzenglanz erhellte den düsteren Raum und ließ einen Abglanz auf den freudig erregten Gesichtern der Festteilnehmer.
Ein üppiges Festmahl, ohne das in jener genußfreudigen Zeit ein Fest schwer denkbar war, leitete die Feier ein. Der Wein floß in Strömen, und die fremden Gäste, die flandrischen Kaufleute, die vertreten waren, konnten sich von der Freigebigkeit ihrer Wirte überzeugen. Auch das Volk draußen, welches den Turm umlagerte, erhielt seinen Anteil,[S. 106] und nach der Stärke des Jubels und freudigen Lärms zu urteilen, mußte es gleichfalls befriedigt sein. Der Rat saß zu oberst an besonderer Tafel. Die Reden, welche gewechselt wurden, galten der Wichtigkeit des neuen Bauwerks und dem Mann, dessen Tatkraft es in erster Linie zu verdanken war.
Achtermann, der im Mittelpunkte der Feier stand, ließ die vielen Lobeserhebungen mit einem gewissen freudigen Gleichmut über sich ergehen; er wußte, was er geschaffen und weshalb er es geschaffen. Das neue Bollwerk bildete einen Markstein in der Befestigungskunst seiner Stadt, der Stadt, die er liebte, weil sie seine Heimat war und ihn zu Ehren und Ansehen gebracht hatte. Mit ihrer Wehrhaftigkeit, des war er sich in all dem Trubel sehr wohl bewußt, erhöhte er aber nicht nur ihre Sicherheit, sondern auch den Schutz des eigenen Besitzes, des Erbes der Väter, das er gut verwaltet und vermehrt hatte, so daß er es seinerzeit mit Stolz den Kindern überlassen konnte.
Je länger die Feier dauerte, desto größer wurde die Ungeduld der Jugend, die den langatmigen und gewichtigen Reden der Alten nur wenig Geschmack abzugewinnen wußte. Hier und da hatten sie sich zu Gruppen zusammengefunden, liebreizende, weißgekleidete Jungfrauen und hübsche Jünglinge, denen das grüne oder schwarze Samtjäckchen mit den Längspuffen und den lang herabwallenden Ärmelschlitzen trefflich zu Gesicht stand, wie der Degen, auf dessen goldenen Knauf sie die Linke stützten. Alte Bekannte hatten sich gefunden, Johannes Hardt, der mit der Tochter des Bürgermeisters lebhaft plauderte und von Heinrichs Schwester Maria geneckt wurde, Venne Richerdes, die wie eine Lichtgestalt aus dem Schatten der Seitenwand mit Heinrich[S. 107] Achtermann heraustrat, gleichfalls in ein angelegentliches Gespräch versunken. Langsam schreitend kamen sie durch die Halle auf die anderen zu. In Marias Augen blitzte es schalkhaft auf, während die Tochter Karsten Balders verstimmt zur Seite blickte. Ihr Herz schlug dem schlanken Jünglinge entgegen, der an Vennes Seite in anmutiger, jugendlicher Kraft daherschritt. Bitter stieg es in ihr auf, als sie die beredten Blicke sah, mit denen Heinrich Achtermann auf die blühende Gestalt an seiner Seite blickte: Warum blieb ihr versagt, was jener mühelos, wie es schien, zufiel? — Oder spielte sie nur die Spröde, um ihn um so sicherer an sich zu ketten?
»Nun, Ihr Unzertrennlichen,« redete Maria sie mit liebenswürdigem Spott an, »wollt Ihr uns auch einmal die Ehre schenken?«
Auf Vennes Stirn zeigte sich eine Falte des Unmutes. »Maria«, sagte sie nur vorwurfsvoll.
»Nun ja, nur nicht gleich so empfindlich, Närrin«, fiel Maria ein. »Ist's denn eine Beleidigung von mir oder eine Sünde von Euch, wenn ich Euch nachsage, daß Ihr die letzten Male, da wir uns trafen, oft zusammenhocktet?«
»Von mir ging das ›Zusammenhocken‹ sicher nicht aus«, erwiderte Venne empfindlich.
»Die Jungfer Venne hat recht«, mischte sich da Heinrich Achtermann ein. »Ihr kann niemand nachsagen, daß sie sich aufdrängt. Ich will also reumütig alle Schuld auf mich nehmen; auch für heut bekenne ich mich schuldig. Übrigens ist es kein Geheimnis, was wir verhandelten. Ich möchte sogar Eure Hilfe in Anspruch nehmen, um ein unparteiliches Urteil herbeizuführen.«
»Wir geloben feierlich, unbestechlich zu sein, selbst wenn[S. 108] es auf unsere, der Frauen, Kosten geht«, erklärte Maria übermütig, ehe noch die anderen ein Wort sagen konnten.
»Das ist gut,« entgegnete Heinrich Achtermann, »denn um sie handelte es sich tatsächlich. Wir waren nämlich dabei, die hochwichtige Frage zu lösen, ob wohl die hiesigen Jungfrauen den neuen französischen Reigen, von dem Herr Dehard so begeistert sprach, nicht ebenso zierlich aufführen möchten wie die Pariserinnen. Jungfer Venne bestreitet es; ich plädiere dafür, daß sie es können.«
»Natürlich können wir es«, rief Maria und andere junge Mädchen, die noch zu dem Kreise getreten waren. »Gebt uns nur einen richtigen Tanzmeister, dann werden wir es jenen schon gleichtun. Von Venne aber ist's eine Ketzerei, uns so herabzusetzen.«
»Ich bekenne mich schuldig,« rief sie lachend, »aber ich dachte dabei nur an meine Ungeschicklichkeit.«
»Ungeschicklichkeit, hört ihr's?« drohte Maria mit verstelltem Zorn, »ungeschickt sie, die uns immer voranschreitet im Reigen. Aber sie bekennet sich schuldig, und auf Schuld gehört Sühne. Wer nennt die Buße?«
»Einen Kuß«, rief der Chor. »Wem?« fragte eine andere. »Uns allen«, hieß es von anderer Seite. »Nein, mir«, begehrte Achtermann kühn. »Also ihm,« entschied Maria, »denn er hat die Beleidigung gehört.«
»Laß die Scherze«, sagte Venne unmutig. Aber Maria, welche die beiden zusammenbringen wollte, bestand darauf, auch daß die Buße heute abend noch gezahlt werden müsse. Da legte sich Heinrich selbst ins Mittel. »Ich schlage vor, daß wir den Ausgang abwarten. Zum Langen Tanz wird es sich zeigen können. Dann aber bestehe ich auf meinen Schein.«
[S. 109]
»Ich für meinen Teil erlasse Euch die Strafe schon jetzt«, entgegnete Venne spöttisch.
Die Tafel war aufgehoben; die Jugend forderte nun ihr Recht. Die Paare traten zum Reigen an. Zunächst erschienen auch die Alten mit auf dem Plan. Wie die Ehre des Abends es gebot, führte den Reigen der regierende Bürgermeister, Karsten Balder. Ihm zur Seite schritt, der Auszeichnung sich wohl bewußt, die Frau des besonders zu Ehrenden, des Ratsherrn Achtermann.
Das stattliche Paar fesselte nach Gestalt wie Gewandung die Aufmerksamkeit aller. Der strengen Kleiderordnung entsprechend, deren Übertretung durch eine Puffe oder eine Verbrämung man streng ahndete, durften nur diese vornehmsten der Frauen an sich zeigen, was die Kleiderkünstler an Glanz und Pracht für die Umrahmung weiblicher Schönheit oder Schwäche ersonnen. Gar stolz schritt die Patrizierin einher, zierlich geführt von dem hochmögenden Partner. Die Linke hielt den Überwurf, der auf der Unterseite blau abgefüttert war, zugleich mit dem gleichfarbigen bauschigen Kleide gerafft empor, um ein Schreiten zu gestatten. Goldene Sterne über das Ganze gesät, hoben sich leuchtend von dem Untergrunde ab.
Die Büste war durch ein goldenes Band wirkungsvoll abgegrenzt. Um den weit ausladenden Halsausschnitt legte sich edles Geschmeide. Gleich kostbare Ketten hingen von der weißen, mit Goldstreifen verzierten Kappe herab, auf der ein goldener Bausch den stimmungsvollen Abschluß bildete.
Der Bürgermeister war angetan mit einem schweren, dunkelverbrämten Samtmantel, mit breitem, umgelegtem Kragen seltensten Pelzwerkes. Die Linke hielt den weiten Mantel über der Brust verschränkt, indes die Rechte, auf[S. 110] deren Zeigefinger ein gewaltiger Siegelring im Flimmer der Kerze strahlte, die Dame zierlich geleitete.
Langsam und stattlich bewegten sie sich dahin im Reigen. In bedächtigen Intervallen lud die Musik zum Schreiten, Sichneigen und Sichwenden, langsam, viel zu langsam für die Ungeduld der Jugend, die in verbotenem Übermut wohl das Kichern sich verbiß und sich heimlich stieß, in abfälliger Kritik über dieses oder jenes Paar der Würdigen, deren schlecht getragene Majestät der Bewegung ihre Lachlust reizte. Dann war dem Brauch Genüge geschehen, und das Alter wie die Würde zogen sich zurück zu der ihm besser anstehenden Art des Zuschauens. Die Herren verschwanden auch wohl in einer Ecke, einen ungestörten Trunk zu tun und in ernstem oder eifrigem Disput zu bereden, was ihnen am Herzen lag; wieder andere hockten an herbeigeholten Tischen, auf denen das Schachzabel aufgestellt wurde.
Die Reigen, welche die Jugend aufführte, waren die alten, schönen Tänze unserer Altvordern, die der Persönlichkeit freien Spielraum ließen, sich im Rhythmus auszugeben. Ein Sichneigen, Sichheben und Drehen mit der Anmut und Geschmeidigkeit der Jugend, ein Sichfinden und Sichmeiden, das die Gefühle der jungen Herzen in liebreizendster Weise verkörperte. Die Stadtzinkenisten bliesen, die Geigen seufzten und jubilierten in einem Atem, die Flöten tirilierten, als wollten sie zerspringen vor Lust über so viel Jugend und Anmut, die sich zu ihren Füßen im Saal im Rhythmus durcheinanderwand.
Immer höher stieg die Lust, immer kühner wurden die Blicke der Jünglinge, hingebender die Bewegungen der Jungfräulein; Terpsichore sank die Leier aus der Hand, Bacchus drohte die Herrschaft zu gewinnen, da gab Karsten[S. 111] Balder das Zeichen zum Schluß des Festes. Ungestüm bat und drängte die Jugend, man möge noch ein kleines verweilen; das eigene Töchterchen Karsten Balders wurde zum Ansturm auf das väterliche Herz vorgeschickt, aber der Angriff scheiterte an seinem Willen. Sein unbeugsames »Nein« verhinderte, daß das schöne Fest wie so viele seinesgleichen in jener Zeit wilden Genußlebens in eine Bacchanalie ausartete.
Sittsam brach man auf; die kalte Nachtluft verscheuchte die losen Geister, die im Saale die Vernunft zu unterjochen drohten. Die Jungherren geleiteten ihre Damen, die unter züchtig gesenktem Blick das Verlangen verbargen, das eben noch in ihnen aufgewallt war. Ehrbar klangen die Worte, die Ohren der begleitenden Eltern von der Wohlanständigkeit des Begleiters überzeugend. Ein geflüstertes Wörtchen, ein leise gehauchter und verstohlen gewährter Wunsch entging trotzdem ihrer Aufmerksamkeit.
Heinrich Achtermann schritt an der Seite Vennes. Der Vater war auf eigenen Wunsch daheim geblieben bei der kranken Mutter, trotz des Widerspruches Vennes. Sie sollte nicht um die Freuden der Jugend betrogen werden, da sie schon mehr als ihre Freundinnen Entsagung üben mußte durch die Pflege der geliebten Mutter.
An dem stillen Abend, den der Mann am Lager der Kranken verbrachte, kam manches zur Sprache. Auch der Besuch des Ratsherrn Achtermann wurde erörtert und sein Hinweis auf ein enges Band zwischen den beiden Familien.
»Wir sollten dem Glück unserer Venne kein Hindernis in den Weg legen«, meinte die Gattin. »Im Schoße des angesehenen Achtermanns ist sie nach irdischer Voraussicht[S. 112] wohl aufgehoben, und wir können, wenn wir abberufen werden, beruhigt die Augen schließen.«
Richerdes sah das wohl ein; auch gegen die Person des Bewerbers ließ sich nichts Ernstliches einwenden, wäre nur nicht die Bedingung des Ratsherrn gewesen. Auch hier riet die Frau zur Nachgiebigkeit. »Du hast doch selbst in letzter Zeit nicht selten über die zunehmende Unergiebigkeit der Grube geklagt. Wie nun, wenn zuletzt doch Achtermann recht behielte mit einem gänzlichen Zusammenbruch unserer Erwerbsquelle?«
»Aber Karsten Balder«, warf Richerdes ein.
»Ja, Karsten Balder ist der störende Flecken in dem Bilde«, gab sie zu. »Aber sein Triumph, wenn er's so auffaßt, sollte uns doch nicht blind machen gegen den eigenen Vorteil. Und wer weiß, ob wir ihm nicht doch zuletzt unrecht tun. Ich habe in stillen Nächten wohl darüber nachgesonnen. Wir können ihm keinen greifbaren Beweis seines Übelwollens nachweisen, und der Argwohn ist zuletzt ein schlechter Berater. Soll ich ehrlich sein, so weiß ich mich aus der früheren Zeit keines Zuges zu entsinnen, der auf Arglist oder Hinterhältigkeit hindeutet.«
»Daß er mich gern gemocht hat,« fügte sie mit einem errötenden Lächeln hinzu, das ihr Gesicht seltsam verschönte, »ist doch keine Todsünde, die ihm für immer vorbehalten bleiben müßte. Und über die Enttäuschung wird ihm gewiß seine Stellung wie das Glück in der Familie hinweggeholfen haben.«
»Nun gehst Du auch mit fliegender Fahne in des Feindes Lager über«, klagte Richerdes mit einer scherzhaften Resignation. »Da werde ich mich wohl auf eine ehrenvolle Kapitulation einrichten müssen. Nun wollen wir aber das[S. 113] schwerwiegende Gespräch abbrechen, das dich gewiß erregt. Ich will's beschlafen, Mathilde. Zuvor aber gib mir noch ein Weilchen Urlaub für den Schreibtisch. Die stille Stunde gibt mir erwünschte Muße, über Geschäftliches nachzusinnen. Bis dahin kehrt wohl auch Venne zurück.«
Venne war in der Begleitung einer befreundeten Familie zu dem Fest gegangen. Als man sich von ihr verabschiedet hatte, ging sie mit Heinrich Achtermann allein auf der nachtstillen Straße dahin.
»Könnt Ihr mir nicht sagen, Jungfer Venne, was Ihr gegen mich habt?« unterbrach Heinrich das anfängliche Schweigen. Dieses Mal war die Frage in einem Tone gestellt, dem alle leichte Neckerei fernlag.
Venne hatte den ganzen Abend über auch unter den Wogen immer höher gehender, jugendlicher Lust und Freude ihre herbe Sprödigkeit bewahrt, trotz allen heißen Werbens von seiten Heinrich Achtermanns. Es war ihre Natur, die Gefühle des Herzens in sich zu verschließen. Nur ein flüchtiges Lächeln bei den Scherzen aus seinem oder fremdem Munde huschte auch über ihre Züge. Hätte sie gewußt, wie entzückend dieses Lächeln gerade ihr zu Gesicht stand und wäre sie eitel gewesen wie manche ihrer Gefährtinnen, so hätte sie diesen freundlichen Schimmer sich dauernd zu eigen gemacht.
Venne war nicht kühl im Inneren, wie man ihr nachsagte und Heinrich Achtermann es den ganzen Abend empfunden hatte; sie verbarg nur unter dem Mantel jungfräulicher, spröder Ablehnung das warme Gefühl, um es vor fremden Blicken nicht zu entweihen. Auch in ihr pulste das Blut der Jugend, und sie hätte kein Weib sein müssen, wenn ihr nicht die offen zur Schau gestellte Huldigung des stattlichen,[S. 114] schönen Ratsherrensohnes geschmeichelt hätte. Und noch mehr regte sich in ihrem Herzen für den hübschen Gesellen, als sie sich jetzt noch selbst in ihrem Herzen zugestehen mochte. Sie standen vor ihrer Haustür. Die Frage Heinrichs zwang zu einer Antwort, und so wappnete sie sich mit doppelt kühler Zurückhaltung gegen eine unvorsichtige Äußerung.
»Ihr fragt kühn und begehrt viel zu wissen, Junker Achtermann«, suchte sie ihn zurückzuweisen. »Ließ ich mir irgendeine Unhöflichkeit zuschulden kommen, so wäre mir's leid.«
»Nein, daß muß Euch der Neid lassen, Jungfer Venne, darin laßt Ihr es nicht an Euch fehlen. Aber mir wäre es lieber, Ihr vergäßet Euch ein wenig und legtet einmal für einen Augenblick diese stolze Höflichkeit ab, wenigstens mir gegenüber.«
»Und weshalb soll ich gerade Euch gegenüber mich bezwingen und von meiner Art lassen?« — Kaum war die Frage dem Munde entflohen, als sie ihre Worte auch gern zurückgenommen hätte, denn sie mußten den Gefragten dazu bringen, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
»Weshalb fragt Ihr? Weil Ihr in meinem Herzen wohnt als die Göttin, der ich diene, die ich anbete. Ahnt Ihr nicht, wie es in mir aussieht, wie mein erster und mein letzter Gedanke Euch gilt?«
Venne unterbrach ihn. Um nicht schwach zu werden, nahm sie zum Spott ihre Zuflucht: »Die wievielte bin ich, der Ihr Eure Neigung gesteht?«
»Venne,« erwiderte er mit nachdrücklichem Ernst, den die Leidenschaft durchzitterte, »höhnt mich nicht noch, wollt Ihr mich nicht zur Verzweiflung treiben. Wahr ist es, ich tändelte[S. 115] hier und da und tauschte zärtliche Worte ohne tieferes Gefühl. Ihr seht, ich mache mich nicht besser, als ich bin. Aber laßt mir auch Gerechtigkeit widerfahren; ich bin zuletzt nicht schlechter als meine Freunde und Altersgenossen. Was ich bisher trieb, war jugendlicher Gefühlsüberschwang, leichte Tändelei. Bei Euch aber ist es anderes. Glaubt es mir, glaube mir, Venne Richerdes, Du hast es in der Hand, mich selig zu machen für immer oder mich zu verderben. Trage die Verantwortung dafür, wenn Du kannst, stelle mich auf die Probe, prüfe, aber weise mich nicht für immer zurück.«
In Venne quoll es heiß empor unter der Glut seiner Worte; ein Gefühl von Glückseligkeit durchschauerte sie. Es zog sie zu ihm. War das die große, große Liebe, von der die Dichter sangen? Weich wurde ihr Blick und senkte sich in seine Augen. Heinrich hatte ihre beiden Hände ergriffen. Leidenschaftlich erregt beugte er sich vor. Venne schloß die Augen, wie ein seliger Schwindel überflog es sie. Da ließ sich ein Geräusch im Hause hören. Sie entzog ihm ihre Hände und bat ihn: »Geht, daß man uns nicht sieht.«
Leise öffnete sie die Tür, mit einem traurigen Blick wandte sich Heinrich Achtermann ab. Da traf ein Flüsterton sein Ohr: »Geht, ich warte, daß Ihr die Probe besteht!« und mit einem leisen Kichern huschte sie ins Haus.
Heinrich Achtermann zog beglückt von dannen. Um die Probe war ihm nicht bang. Übers Jahr, so hoffte er, war Venne sein geliebtes Weib.
[S. 116]
Im Schefferschen Hause am St.-Ägidien-Platz herrschte weiter drückende Sorge über dem kleinen Kreise, denn noch vermochte auch der Arzt nicht zu sagen, wie die schwere Verwundung Erdwins verlaufen würde. Die Lunge war durch den Schuß gestreift, und die dicke Winterluft bereitete dem schwer Atmenden große Pein. Langsam nur gewann er unter der liebevollen Pflege von Mutter und Schwester die verlorenen Kräfte wieder. Tiefe Blässe lag auf dem eingefallenen, einst so blühenden Gesicht.
Der alte Arzt war mit dem Erfolge seiner Kur nicht zufrieden und behauptete, es müsse noch etwas anderes, Seelisches sein, das die Heilung verzögere. Aber er erhielt auf seine Andeutung keine Antwort, denn den alten, ehrenfesten Handwerker mutete es, mochte er auch auf die Erfüllung seines Lieblingsplanes betreffs der Heirat mit der Nachbarstochter verzichten, wie ein ihm persönlich angetaner Schimpf an, daß im Herzen seines Sohnes ein hergelaufenes Mädchen, die Tochter einer fahrenden Frau, sich eingenistet habe.
Die Mutter wurde unter einem inneren Zwiespalt hin und her gezerrt. Im Herzen stand sie auf der Seite ihres Mannes; auch sie konnte sich von dem übererbten Vorurteil nicht frei machen, obwohl Monikas bescheidenes Wesen und der Liebreiz ihrer Erscheinung ihren Eindruck auf sie nicht verfehlten. Auf der anderen Seite jammerte sie der Zustand des Sohnes, der sich in Sehnsucht nach Monika verzehrte.[S. 117] Lange verbiß er den Schmerz, aber zuletzt brach er sich doch in herben Worten Bahn.
Von der Schwester hatte er vernommen, daß die Geliebte schon am ersten Tage dagewesen sei. Was die Schwester ihm nicht sagte, die Abweisung durch die Eltern, verriet ihm die Verlegenheit der Mutter, so oft er das Gespräch auf sie brachte, sowie des Vaters verschlossenes Gesicht. Wo Monika mit der Mutter Immecke lebte und wie sie hausten, konnte ihm wieder die Schwester berichten, die sie ohne Vorwissen der Eltern in der Badeleber Straße besucht hatte. Sie brachte die Grüße der Frauen mit und ihre herzlichen Wünsche, aber sie konnte den Anblick der Geliebten nicht ersetzen. Immer tiefer fraß sich die Sehnsucht in sein Herz, und größer wurde der Groll gegen die, welche ihm sein Glück vorenthielten. Zuletzt brach's sich über die Lippen Bahn der Mutter gegenüber.
»Eure Pflege ist zu nichts nutze. Laßt mich lieber schnell sterben, als daß ich mich langsam zu Tode quäle. Ich liebe Monika und lasse nicht von ihr. Glaubt doch nicht, daß Ihr mit Eurem Pfahlbürgerstolz trennen könntet, was in jahrelanger, ehrlicher Freundschaft und Liebe zusammengewachsen ist. Wollt Ihr sie weiter von mir getrennt halten, so laßt mich lieber aus dem Hause schaffen zu mitleidigen Menschen, auch auf die Gefahr hin, daß ich dabei mir den Tod hole. So ertrage ich's nimmer lange.«
Da griff der Mutter die Angst ans Herz, und sie versprach, mit dem Vater zu reden.
Der brave Meister Scheffer war höchst ungehalten über die Zumutung seiner Lebensgefährtin, er solle die hergelaufene Dirne in seinem Hause aufnehmen. Immer wieder wies er darauf hin, daß es Landstreichervolk sei, dem[S. 118] sie die Tür öffnen wolle. Aber sie blieb fest, aus Angst um das Leben des Sohnes, und sie erreichte endlich, daß er, wenn auch ingrimmig und grollend, seine Zustimmung gab. »Aber mich laßt aus dem Spiele«, entschied er unerbittlich. »Ich will mit der Narretei nichts zu tun haben und gehe aus dem Hause, wenn das Mädchen kommt.«
Monika kam. Meister Scheffer sah unbeobachtet durch ein Guckfenster, das auf der hofwärts gelegenen Werkstatt den Überblick über die Vorgänge auf der Hausdiele gestattete. Das Mädchen war nicht übel, sein Auftreten bescheiden, und ohne den Groll im Herzen und die Voreingenommenheit hätte er zuletzt wohl die eigenen Wünsche zurückgestellt; aber der Gedanke, was die in gleich strengen Anschauungen aufgewachsenen Nachbarn und Gildebrüder dazu sagen würden, verscheuchte die weiche Regung, und er verließ durch die Hoftür das Haus.
Das Wiedersehen zwischen Monika und Erdwin gestaltete sich erschütternd, obwohl die Schwester sie auf das Aussehen des Kranken vorbereitet und sie dringend gebeten hatte, jeden Gefühlsausbruch zu meiden. Als sie in das Zimmer trat und das bleiche Gesicht auf dem Lager sah, das sich von den bunten Kissen doppelt gespenstig abhob, sank sie mit einem Wehelaut am Lager des Geliebten nieder.
»Mein Erdwin, mein Einziger«, war alles, was sie unter verhaltenem Schluchzen hervorbringen konnte. Ein glückliches Lächeln huschte über das Gesicht des Kranken, und er reichte ihr die abgezehrte Hand, die sie mit Küssen bedeckte. Auch der Schwester rannen die Zähren über die Wange, und selbst die Mutter wischte sich mit einem Zipfel der Schürze die feucht gewordenen Augen. Sie sprachen[S. 119] nur wenig miteinander, aber die Blicke sagten den anderen, wie tief die Liebe im eigenen Herzen wurzele.
Die Mutter trieb zuletzt zum Aufbruch, aus Sorge, die Aufregung möchte dem Kranken schaden. Monika mußte versprechen, bald wiederzukommen.
»Gern,« sagte sie mit einem rührenden Lächeln, »wenn Deine Eltern es gestatten.«
Die Mutter war schon halb gewonnen und wiederholte auch ihrerseits die Einladung. Als der Vater heimkam, erzählte sie ihm von dem Wiedersehen und riet ihm dringend zur Nachgiebigkeit, aber noch blieb er halsstarrig und verstockt; es mußten noch andere Bundesgenossen kommen, um ihn gefügig zu machen.
Es waren einmal Heinrich Achtermann und Johannes Hardt, die des Fahrtgesellen nicht vergaßen.
Johannes fand Beschäftigung im Schreibzimmer des Oheims, der Pleban an der St.-Jakobskirche und Notarius publicus war. Er hoffte, demnächst in die Kanzlei des Rates einzutreten. Die erfolgreichen Studien wie der wichtige Dienst, den er der Stadt geleistet hatte, waren eine Empfehlung, die ihm den Weg zu dem vom Vater gewünschten Ziele bahnten. Er vergaß über den eigenen Plänen und Hoffnungen den treuen Reisegefährten und Jugendfreund nicht. Wenn sich die Gelegenheit bot, sprach er bei Scheffers vor und verbrachte ein Stündchen am Bette des Verletzten. So war er über den Zwist wohl unterrichtet, und er, der Monika selbst und ihre uneigennützige, selbstlose Liebe werten konnte, half, wo er konnte, den Gegensatz auszugleichen.
Neben der Angst um die Wiederherstellung, dem Gram um die Verirrung, wie Meister Scheffer die Liebe des Sohnes zur Tochter der Immecke Rosenhagen immer noch nannte,[S. 120] war es auch die Sorge um seine Zukunft, wenn er gesundet sei. Daß Erdwin für das Handwerk nicht in Frage kam, stand zu befürchten. Aber was sollte werden? Sollte er wieder hinaus in das wilde Leben, zu dem ihm nunmehr auch die körperlichen Vorbedingungen fehlten?
Johannes suchte die Eltern über diesen Punkt zu beruhigen. Wozu seine Bescheidenheit in eigener Sache nie ausgereicht hätte, das tat er für den Freund gern und freimütig. Er war schon beim Rate vorstellig geworden, man möge für den Verletzten, wenn er wiederhergestellt sei, eine Verwendung im Dienste der Stadt vorsehen.
Heinrich Achtermann hatte schon am Tage nach dem Überfall bei den Scheffers vorgesprochen und mit herzlicher Teilnahme von der Schwere der Verletzung gehört. Sein Mitleid galt nicht nur dem unerschrockenen Helfer in der Not, sondern es rang hier ein Menschenkind mit dem Tode, das ihm als lieber Jugendgespiele und Genosse tausend lustiger Streiche besonders ans Herz gewachsen war. Der gutmütige und weichherzige Heinrich sah keinen Abstand zwischen dem Sohn des Schuhmachers und sich, dem Abkömmling eines alten Patriziergeschlechtes. Er war daher bedacht, dem Kranken alle Hilfe zu verschaffen, die der Reichtum der Eltern gestattete, und immer wieder wanderten Körbe mit stärkenden Mitteln in das Haus am Ägidienplatz. Als sich die ersten Anzeichen der Genesung einstellten, lag er dem Vater in den Ohren, dieser möge darauf bedacht sein, für die Zukunft Erdwin Scheffers zu sorgen.
Es hätte des lebhaften Mahnens gar nicht bedurft, denn auch der Ratsherr war dem Burschen wohlgewogen, der seinem Einzigen so mannhaft zur Seite gestanden hatte. So konnte es nicht fehlen, daß auch der hochmögende Rat[S. 121] diesem Ansturm von verschiedenen Seiten ein geneigtes Ohr lieh.
Der regierende Bürgermeister, Karsten Balder, der überzeugt war, daß man die Rettung des kostbaren Schriftstücks nicht zuletzt dem Mut und der Umsicht Erdwin Scheffers verdanke, sprach selbst im Hause des Meisters vor und teilte dem matt Aufhorchenden die Belobigung und günstige Gesinnung des Rates mit. Aber trotz allem kam man nicht weiter. Wohl hatte sich der Kranke inzwischen so weit erholt, daß er, auf den Stock gestützt, vorsichtig im Hause umherwandeln konnte. Indes das Rot der Gesundheit wollte noch immer nicht in die blassen Wangen zurückkehren, und der alte Lebensmut fehlte nicht minder.
Monika litt noch mehr unter der gedrückten Stimmung. Trotz aller liebevollen Zärtlichkeit der Schwester Erdwins, obwohl auch die Mutter allmählich den Widerstand schwinden ließ und sie freundlich begrüßte, wenn sie, was nur selten geschah, kam, trug sie dennoch schwer an dem Gefühl, daß sie im Hause des Geliebten nur geduldet sei.
Die eigene Mutter litt mit ihr unter diesem schiefen Verhältnis, und sie, die tatkräftige und entschlossene Frau, die durch einen langen und ehrbaren Lebenswandel inmitten des rauhen und lockeren Kriegslebens reichlich gesühnt hatte, was ihr etwa ihr eigenes Gewissen an jugendlichem Leichtsinn vorwerfen konnte, trug doppelt schwer an der Lage, die sie zur Rolle des untätig wartenden Zuschauers verurteilte. Sie sah, daß das Gesichtchen Monikas täglich schmaler und blasser wurde. Sie hörte nachts, wenn sie schlaflos auf ihrem Pfühle lag, die Seufzer des geliebten Kindes. Das hielt sie nicht länger aus.
Immecke Rosenhagen hatte das Fähnlein des erschlagenen[S. 122] Hauptmanns über den Rhein und weiter bis Goslar begleitet. Sie war des unruhvollen Kriegslebens mit seinen Bildern wilden Blutvergießens und roher Sitten müde. Sie wollte ihre Ruhe haben auf ihre alten Tage, vor allem aber sollte ihre Monika eine Heimat haben. Daß dies Goslar sein müsse, kam ihr zunächst nicht in den Sinn. Aber ausruhen wollte sie hier von der Mühsal des Marsches. Wohin sie alsdann ihren Stab setzen würde, war ihr selbst noch verschlossen. In die Heimat, nach Salzwedel, zog sie nichts Besonderes. Die Eltern waren längst tot, nähere Verwandte lebten ihr dort nicht. Und selbst wenn das der Fall gewesen wäre, hätte sie dieses nicht zur Rückkehr dorthin verlocken können. Denn was ihr die Tage in Goslar verleidete, würde sie dort in der Beschränktheit der kleinen Stadt, wo man ihre etwas abenteuerliche Jugendgeschichte kannte, doppelt treffen.
Immecke war entschlossen, Goslar zu verlassen, denn sie wollte nicht länger untätig zuschauen, daß ihr Herzblatt sich abhärmte und dahinschwand. Doch als sie Monika gegenüber eine Andeutung dieser Art fallen ließ, traf sie auf einen so entschlossenen Widerstand, wie sie ihn von der schüchternen Tochter nie erwartet hätte.
»Ich weiche keinen Schritt von hier, ehe Erdwin nicht gänzlich hergestellt ist, und trifft ihn das Schlimmste, so soll sein Grab von meinen Tränen genetzt werden.«
»Nun, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe«, antwortete die Mutter ebenso entschlossen. »Ich gehe selbst zu dem verdrehten und in seinem Bürgerstolz überspannten Scheffer und halte ihm seine Sünden vor.« Monika erschrak und bat die Mutter, davon abzusehen, aber alle Einrede war vergeblich.
[S. 123]
Die Rosenhagens wohnten bei einer Witwe in der Badeleber Straße; von dort machte sich Immecke an einem der nächsten Tage auf den Weg nach St. Ägidien. Sie wollte zunächst im guten mit dem Scheffer reden, war aber entschlossen, die Sache zu irgendeinem Ende zu bringen, und dann sollte, scheiterte ihr Versuch, sie kein längerer Einspruch Monikas vom Aufbruch von Goslar fernhalten.
Es öffnete ihr die Schwester Erdwins, die sie von einem Besuch in der Badeleber Straße her kannte. Die Mutter wurde gerufen und mit ihr bekannt gemacht. Dann gingen sie zu Erdwin hinein. Es war das erstemal, daß Immecke ihn seit dem Tage von Riechenberg wiedersah. Auch sie erschrak, als sie ihn erblickte, obschon das Schlimmste längst überstanden war.
»Armer Schelm, wie haben sie Dir mitgespielt, aber nun heißt es schnellstens gesund werden, ich will das Meinige dazu beitragen und mit dem Vater sprechen.«
Erdwin stimmte lebhaft zu, die Mutter widerriet ängstlich, doch Immecke war entschlossen: »Ruft ihn also.« Aber die Mutter warnte, Erdwin der Aufregung auszusetzen.
»Gut, so suchen wir den Löwen in seiner Höhle auf«, sagte sie resolut und ließ sich von der Frau den Weg zur Werkstatt zeigen, wo Meister Scheffer wütend auf das Leder losklopfte, als solle es für alle Widerwärtigkeiten büßen, die ihm widerfuhren.
Sie klopfte, und ehe noch der Meister »Herein« gerufen hatte, stand sie schon im Zimmer. »Guten Tag, Meister Scheffer.« Er tat sehr erstaunt, aber sie hatte mit ihrem scharfen Auge wohl das Gesicht gesehen, das sich vorhin bei ihrem Kommen an das Guckfenster preßte, und da die[S. 124] Frau einen Augenblick das Zimmer verlassen hatte, durfte sie annehmen, daß er den Besuch kenne.
»Wir kennen uns durch unsere Kinder,« ging sie auf die Sache los, »und ihretwegen komme ich.«
Meister Scheffer fühlte sich höchst unbehaglich unter dem scharfen, prüfenden Blick der Frau, die da so mir nichts, dir nichts bei ihm eindrang. Er hüstelte verlegen und suchte an ihr vorbeizublicken, als suche er nach einem Bundesgenossen. Aber Immecke Rosenhagen kannte ihre Leute und ließ ihn nicht aus den Augen.
»Meister Scheffer, ich bin zu Euch gekommen, um von Euch zu hören, was Ihr gegen mich und mein Kind habt. Daß ich sie Euch nicht aufdrängen will, brauche ich nicht zu sagen. Indes, ich will nicht länger zusehen, wie zwei Menschenkinder, die mir beide lieb sind, an Eurem Starrsinn zugrunde gehen. So oder so will ich Klarheit schaffen.«
»Ihr kommt einem arg grob«, meinte er ausweichend. »Was ich für Gründe habe? Nun, es wären ihrer mehrere. Wir kennen uns zu wenig, und Ihr seid nicht von hier.«
»Ist das alles, so ist das kein Grund, Eure Zustimmung zu versagen. Oder ist es bei Euch verboten, durch frisches Blut von draußen Eure Stockfischigkeit zu bessern? Mir scheint das sogar sehr vonnöten, wie Ihr selbst beweist«, fuhr sie in ihrer derben Offenheit fort.
»Nun ja, das mag sein, aber es wäre da noch so manches ...«
»Und unter dem ›Manchen‹ ist eines für Euch die Hauptsache, gesteht es nur ruhig zu. Wer nicht seßhaft, gilt in Euren Augen als fahrendes Volk, und ich im besonderen bin Euch wohl gar verdächtig wegen der Herkunft meines[S. 125] Kindes. Seid unbesorgt, sie ist im Ehebett geboren so gut wie Eure eigenen. Und hegt Ihr Zweifel, so lest hier den Trauschein des ehrenwerten Feldkaplans Carolus Wintinger.«
»Ja, ich sehe schon, da ist alles in Ordnung«, ächzte Meister Scheffer. »Aber da wäre doch noch, ich meine, es gilt doch auch die eigene Reputation; da sind zum Exempel die Nachbarn, was sollten sie, was werden sie ...« Schneidend lachend fiel ihm Immecke ins Wort, indes die Stirn sich vor Zorn rötete.
»Da wäre doch noch, da ist zum Exempel,« höhnte sie, »da ist das Marketenderweib, das sich erdreistet, vor Euch zu treten und den vermessenen Gedanken zu haben, als wäre sie, als könnte sie ... Pfui Teufel der Wohlanständigkeit, die ihr Genüge darin findet, braven Leuten die Ehre zu kürzen. Aber nun beruhigt Euch, jetzt will ich nicht. Macht's mit Euch und Eurem Gott ab, wenn Euer Sohn darüber zugrunde geht. Doch über eines will ich Euch noch beruhigen. Ihr hättet Eurer Ehre nichts vergeben mit meiner Monika. Mir haben mehr vornehme Herren die Hand gedrückt und dankbar geküßt, als Euch vielleicht zu Gesicht gekommen sind.
Was wißt Ihr hier in Eurem satten Behagen von dem Leben und Nöten draußen, den Nöten Eurer eigenen Kinder, die hinauslaufen, weil Ihr ihnen die Enge hier zu unerträglich macht.
Euer eigener Sohn rannte so davon vor Euch, Meister Pechdraht, weil Ihr bange waret, sein Horizont möchte den eigenen überschreiten, könnte über die Sicht Eurer Türme hinausreichen. So lief er davon wie so mancher gute, deutsche, ehrliche Knabe, der in die Fremde ging, um auf[S. 126] welschem Schlachtfelde für welsche Fürsten sein Herzblut zu verspritzen.
Ich habe sie gelehrt, daß es ein Vaterland gibt, ein Deutschland, dem unsere Kraft gehören müsse, ich habe ihnen diese Sehnsucht in das Herz gepflanzt. Ich habe sie in die Arme genommen, wenn das Heimweh sie packte und schüttelte, ich habe ihre Wunden verbunden, die welsche Waffen ihnen geschlagen; ich habe ihnen die Augen zugedrückt und sie in welscher Erde betten helfen wie die Mutter ihr Kind, ich, die Deutsche den Deutschen. Das ist die Marketenderin Immecke Rosenhagen vom Regiment Holzendorf. Und nun lebt wohl, unsere Wege scheiden sich.«
Sie war draußen, ehe sich der gute Meister Scheffer von seiner Bestürzung und Beschämung erholt hatte. Die Haustür flog zu, daß die Glocke ängstlich wimmerte. Grimmig lächelnd schritt Immecke dahin, der Badeleber Straße zu. Nun war es zu Ende, und nun hieß es, einen Strich unter die letzte Vergangenheit machen, für sich und für Monika.
Als die Tochter sie ins Zimmer treten sah, wußte sie schon, wie der Besuch verlaufen war. Sie brauchte gar nicht zu fragen, die Mutter begann sogleich zu erzählen. Und sie schloß mit der barschen Aufforderung: »So, nun ist's Schluß. Ich habe das Meinige getan. Nun hat das Herz zu schweigen, und die Vernunft tritt an seine Stelle.«
Monika war so verschüchtert, daß sie vorab keine Silbe zu antworten wagte. Aber in der Nacht brach der Kummer sich Bahn, erst in einem stillen Schluchzen, daß die Schultern erbebten, und dann, als die Mutter sie ansprach, in lautem Weinen, so daß Immecke ihr doch ein gutes, tröstendes Wort sagen mußte. Auch am anderen Tage stand indes ihr Entschluß noch fest, Goslar zu verlassen. Denn: ein rascher,[S. 127] fester Schnitt ist besser als ein langsames Sich-dahin-quälen, dachte sie. Einen Augenblick kam ihr auch wohl der Gedanke, das alte Handwerk wiederaufzunehmen; aber davon ging sie bald wieder ab, wenn sie Monikas sich erinnerte. Da wurde sie in ihrem Vorhaben schwankend gemacht durch Heinrich Achtermann, der bei Scheffers von Immeckes Besuch und ihrem Mißerfolg gehört hatte. Er ging zu den Frauen und machte ihnen einen Vorschlag, der sie in Goslar festhalten sollte.
»Ich habe gehört, daß der >Goldene Adler< an der Gudemannstraße zum Verkauf stehe. Es ist eine gutgehende, achtbare Herberge, die ihren Mann ernährt. Wie ich Euch kenne, wäret Ihr wohl imstande, ihr vorzustehen. Ihr könnt Euch ja einen Schaffner halten. Wie Ihr es mit der Anzahlung halten wollt, weiß ich nicht, aber vielleicht ist da auch manches zu machen durch Bürgschaft, die Euch von meinem Vater nicht fehlen würde.«
»Da seid ohne Sorge,« entgegnete Immecke, »ich bin nicht mittellos. Ich habe einen guten Spargroschen, ehrlich verdientes Geld, das anzunehmen sich kein Goslarer Bürger zu bedenken braucht. Auf jeden Fall danke ich Euch für Euren guten Willen. Ich will mir's überlegen und Euch Nachricht geben.«
Die Einbürgerung ortsfremder Personen, für welche die neue Zeit aus parteipolitischen Gründen heraus alle Schwierigkeiten zu beseitigen bestrebt ist, konnte früher nur schwer erreicht werden, und Immecke Rosenhagen hätte mit ihnen nicht weniger, ja, vielleicht sogar noch mehr zu kämpfen[S. 128] gehabt, als sie sich entschloß, den Vorschlag Johannes Hardts anzunehmen.
Wer das Bürgerrecht einer Stadt wie Goslar erhielt, gewann damit einen Kranz von Rechten auch wirtschaftlicher Natur, die eine Auslese der Zuwandernden als sehr berechtigt erscheinen lassen mußte, abgesehen davon, daß man in jener unruhigen Zeit, die schon in der Masse der eigenen Bürger Keime gärender Ungeduld und Mißstimmung auf vielen Gebieten barg, sich hütete, noch fremde Schößlinge, deren Wesen nicht genug zu erkennen war, in den eigenen Garten zu pflanzen. Der Nachweis dieser »Würdigkeit« ist ein Erfordernis, das sich bis in unsere Tage in der Stadt Goslar erhalten hat und beispielsweise heute noch von neu anzustellenden Beamten verlangt wird.
Diese »Würdigkeit« hatte also auch Immecke Rosenhagen zu erbringen, und sie konnte das in einer Weise, die sich für sie zu einer glänzenden Genugtuung gestalten sollte. Als sie zum Rathaus beordert wurde, mußte sie sich dort zunächst einem Verhör in der Kanzlei unterziehen, das durchaus nicht nach ihrem Geschmack war. Der Schreiber behandelte sie mit einer ausgesprochenen Nichtachtung, und als sie dann selbst auf sich aufmerksam machte, versuchte man sie in ein förmliches Kreuzverhör zu nehmen. Aber da kannten sie Immecke Rosenhagen!
»Euch Schreibersleute scheint die Neugier arg zu plagen, aber befriedigt sie an einem anderen Objekt als bei mir. Ich habe Besseres zu tun, als müßige Leute zu unterhalten. Ich will zum Bürgermeister Karsten Balder, und wenn Ihr den Weg nicht wißt, suche ich ihn mir selber.«
Das war eine im Rathause geradezu unerhörte Art des Auftretens, noch dazu von einem Frauenzimmer. Aber sie[S. 129] hatte durchschlagende Wirkung; man wies sie zum Regierenden. Dort brachte sie unwillig sogleich ihre Ansicht über diese Art von Behandlung vor, so daß auch Karsten Balder sie erstaunt anblickte.
»Ich soll also meine ›Würdigkeit‹ nachweisen,« hub sie dann an, »ich denke, das soll heißen, ob ich nicht gestohlen oder betrogen oder sonst eine Missetat auf dem Gewissen habe. Dieses hier wird Euch hoffentlich darüber beruhigen.«
Damit überreichte sie ihm zwei Schreiben, eines von dem Feldobristen von Walsrode im Regiment Holzendorf und das andere von dem Generallieutenant und Befehlshaber der gesamten deutschen Knechte in burgundischen Diensten, Herrn Friedrich von Uslar.
Beide bestätigten, daß Immecke Rosenhagen, Marketenderin im Regiment Holzendorf, nicht nur ein braves, ehrliches und tapferes Frauenzimmer sei, sondern sich auch besondere Verdienste um das Wohl und Wehe der deutschen Knechte erworben und ihnen allzeit hilfreich zur Seite gestanden habe. Sie verdiene höchste Achtung, und ihr Lebenswandel sei ein untadeliger.
Karsten Balder durchlas die Schreiben, dann trat er auf Immecke zu und reichte ihr die Hand:
»Immecke Rosenhagen, was die Herren hier von Euch schreiben, ehrt Euch mehr, als viele Eures Geschlechtes von sich sagen können. Ihr seid herzlich willkommen in Goslar. Ich wollte, wir hätten mehrere Eurer Art in unseren Mauern. Mit diesem Handschlag begrüße ich Euch als Bürgerin von Goslar. Nehmt es zugleich als einen Ausgleich für die kleine Unbill von vorhin, für die Ihr ja aber selbst gleich Buße auferlegt habt«, schloß er lächelnd.
Freimütig blickte ihm Immecke in die Augen. »Ich danke[S. 130] Euch, Herr Bürgermeister Karsten Balder, und ich hoffe, Ihr werdet Euer Wohlwollen nicht zu bereuen haben.«
So wurde die Marketenderin Immecke Rosenhagen Bürgerin der Freien Reichsstadt Goslar und Besitzerin des ›Goldenen Adlers‹ in der Gudemannstraße. Und es erweist sich noch, daß sie dem Bürgermeister Karsten Balder nicht zuviel versprach.
[S. 131]
Über die Berge des Harzes hielt der Winter noch seine eisenharte Faust ausgestreckt, obwohl der Februar zu Ende war. Wohl brausten hin und wieder die Stürme des herannahenden Frühlings durch den düsteren Tann und nahmen den ragenden Waldbäumen die ungeduldig getragene Schneelast ab, aber der nächste Tag verdarb, was sein Vorgänger gutzumachen versuchte, und die gleichmäßige, weiße Kappe deckte wieder Wipfel und Strauch. Im Dickicht lagerte das abgemagerte Wild, dem der Weg zu den kärglichen Äsungsplätzen durch die hartgefrorene Eiskruste versperrt war. Und manch edler Geweihte lag mitsamt den Gefährtinnen im Wundbett, weil der nagende Hunger sie auf die Nahrungssuche getrieben und die Läufe beim Durchschreiten der Schneekruste von dieser aufgerissen waren.
Das Raubzeug fand an ihnen willkommene Beute. Und dennoch war auch bei diesen Schmalhans Küchenmeister. Nicht einmal ein Mäuslein lief dem leise durch den Wald schliefenden Fuchs in den Weg. Das Eichkätzchen saß ihm unerreichbar im warmen Kobel, und der Häslein gab es auch in guten Zeiten nur wenige im wilden, rauhen Gebirge.
Meister Reinekes größerer Bruder, der Wolf, stieg in die Ebene herab und fiel an, was ihm in den Weg kam. Bis in die Landwehr drangen sie vor, und, was seit Menschengedenken nicht vorgekommen, einmal verirrte sich sogar[S. 132] einer von diesen frechen Gesellen durch ein Mauerpförtchen, das über Mittag ein Viertelstündchen offen gestanden hatte, in die Stadt. Dort fielen die Hunde ihn wütend an, und er büßte sein Leben unter ihren Bissen ein trotz wilder Gegenwehr. Er war ein lebendiges Zeichen dafür, wie groß auch die Not unter dem Getier des Waldes sein mußte.
Mit Sorgen sah der Jäger den Folgen dieses unbarmherzigen Winters entgegen. Mit Sorgen blickte aber auch der Hausherr auf den ständig sich mindernden Vorrat an Spaltholz, das der nimmersatte Kamin mit gefräßiger Eile verlangte, wollte man nicht zähneklappernd im eigenen Hause sich der Kälte überliefern. Schlimm für die Armen, die ansonst auch im Winter ihren Bedarf an Leseholz sich im Walde sammeln konnten. Schlimm für alle, welche ihr Beruf aus der Stadt heraustrieb, wie die Erz- und Hüttenleute, welche im Granetal und anderen waldreichen Flußtälern die Erzroste bedienten. Es gab keine Möglichkeit, in den tiefverschneiten Forsten das nötige Holz zu fällen und zur Talsohle zu schaffen. Sie alle froren unfreiwillig schon seit Monaten, und der Hunger bleckte grimmig durch die kleinen Fensterscheiben ihrer Hütten.
Am Rammelsberge wurde der Grubenbetrieb notdürftig aufrechterhalten, denn seitdem das Pulver aufgekommen war, kam man immer mehr von dem uralten Brauch ab, das Erzgestein, welches abgebaut werden sollte, durch Feuer zu rösten und mürbe zu machen für den Angriff mit Spitzhaue und Brechstange. Aber das gewonnene Erz konnte nicht verhüttet werden und lag als lohnzehrendes, totes Material in Halden vor dem Berge.
Nur ein Teil der Menschen, die unter dem harten Joche des Winters litten, gewann ihm Freuden ab und wünschte,[S. 133] daß er noch länger sein Regiment ausübe: die Kleinen. Wenn sie der strengen Zucht des Magisters oder Schulmeisters entschlüpft waren, wenn sie der Aufsicht und den Mahnungen der Mutter auf einen Augenblick entwischen konnten, ertönte ihr Geschrei und Jubel auf der Straße. Wo immer ein Hang sich senkte, wo eine gefrorene Pfütze blinkte, da sausten sie auf den flachkufigen Bretterschlitten, auf umgekehrten Schemeln herab oder glitten auf des Schusters Rappen über die blanke Fläche in endlosem Kreislauf, einer den anderen anfeuernd und überschreiend. Mochte ein strenger und wohlweiser Rat, dessen Verbote sonst immer Beachtung fanden, noch so oft Erlasse gegen das Schlittern und Schlittenfahren in den Straßen geben, die Stadtweibel ihnen nachspüren, die Rangen lachten ihrer aus sicherer Entfernung und verschwanden nur um die Ecke, um an anderer Stelle das gesetzwidrige Spiel wiederaufzunehmen.
In den Häusern der Bürger war man des hartnäckigen Gesellen gleichfalls überdrüssig, nicht nur, weil der Holzvorrat zu Ende ging und die Erwerbsquellen vor den Toren für manche versiegt waren, auch die Jugend sehnte sein Ende herbei. Der Winter brachte zwar für das gesellige Leben in der reichen Stadt manche Gelegenheit, einander zu sehen und zu sprechen, neben dem Verkehr in den Familien, aber nachdem die Hauptfeier, das Festmahl des neugewählten Bürgermeisters, der mit dem andern im Amte verbleibenden für das nächste Jahr regieren sollte, begangen war, hatte der Winter für die Jugend, die flügge gewordene, seine Reize verloren, und sie harrte ungeduldig ihres Festes, des ›Langen Tanzes‹.
Er ging in seinen Anfängen bis in den Anfang des vierzehnten[S. 134] Jahrhunderts zurück und wurde um die Fastnacht gefeiert.
In gewöhnlichen Jahren war er der Vorbote des Lenzes, auch in Goslar. Heuer freilich sah es trübe aus, da der alte Griesgram Winter immer noch sein hartes Zepter schwang.
So gab er dieses Jahr auch nur ein klägliches Abbild der sonst dabei herrschenden Lust und Freude, denn die Kälte war just an dem Tage, auf den er fiel, grimmig. Die Jünglinge mochten ihr noch standhalten in warmgefütterten Wämsen, die Mägdelein aber scheuten die Teilnahme; denn welches Jungfräulein besitzt so viel Aufopferungsfreudigkeit, ein blaugefrorenes Näslein der Spottlust der männlichen Jugend auszusetzen. Gegen die Kälte konnte man sich auch schützen durch ein wärmendes Kolett, das, um die Schultern gelegt, den zarten Hals und die Brust schützte. Aber sollte man so das Geschmeide verdecken, das bestimmt war, die Schönheit der Trägerin zu heben. Und die duftigen Gewänder, die man sonst unter dem warmen Hauch der Frühlingssonne schon anzulegen wagen durfte, sie schieden für dieses Mal gänzlich aus.
Nur das geringere Volk, das nicht so empfindlich gegen die Unbilden der Witterung war, ließ sich sein Recht nicht nehmen. An der Spitze gingen die jungen Bergleute. Mit Zithern, Geigen und anderen Instrumenten zogen sie musizierend durch die Stadt, aber gar oft setzte einer der Musikanten aus, um die klamm gewordenen Hände zu wärmen. Auch die Lieder klangen dünn durch die harte Winterluft. Natürlich fehlte das alte Spottlied nicht, das auf die von Kaiser Karl IV. vollzogene Verpfändung Goslars an Graf Günther von Schwarzburg Bezug hatte:
[S. 135]
Da die Töchter und Söhne der vornehmen Bürger sich vom ›Langen Tanz‹ dieses Mal fernhielten, konnte auch der Streitfall zwischen Venne Richerdes und Heinrich Achtermann nicht entschieden werden; aber man hoffte, das Versäumte zum Maienfest nachzuholen.
Auch die Ostgänger aus Flandern waren dieses Mal durch den langen Winter in Goslar festgehalten worden, sobald jedoch der erste Lenzeshauch Wege und Stege von der winterlichen Sperre befreite, zogen sie davon. Während aber in der Ebene schon die Boten des Frühlings Einzug gehalten hatten, zeigten die Berge im Hintergrunde noch Reste des winterlichen Schmuckes. Der Tann ragte düster starr gen Himmel, der Frühlingswind wehte ungehemmt durch das kahle Geäst der Eichen im Gosetal.
Doch mählich regte sich's auch hier im Harzwalde. Überall rieselten die Bächlein des Schmelzwassers geschäftig zu Tal. Wo die Sonne lockte, wagte wohl ein Hälmlein sein duftiges[S. 136] Grün zu zeigen, hob ein Buschwindröschen das zierliche Glöckchen, um es zum Frühlingsgeläut zu stimmen. Die Meise hüpfte geschäftig durch das Gezweige des einsamen Tanns. Das Eichkätzchen verließ sein Winterquartier, fand, daß es recht mager geworden sei durch das lange Fasten. Es rasselte muckernd vom Stamm herab, um zu sehen, ob nicht ein Tannenzapfen übriggeblieben, um den nagenden Hunger zu stillen. Und wieder über ein kleines, da steckten die Tannen und Fichten grüne Spitzen auf und rote Kerzen zu Tausenden: Nun war der Lenz auch hier zur Macht und Herrschaft gekommen.
Maiengrün, Maienduft, welch unnennbarer Zauber umschließt das Wort. In den Tälern zu Rudeln vereint, im düsteren Tannenforst einzeln sich zum Lichte durchbrechend, grüßen die Birken von den Hängen mit ihrem ersten duftenden, hellgrünen Laub. Lenzesboten, sie sind's auch heute noch im winterharten Harz. Erst wenn die grünen Buschen und Bäume die Straßen und Häuser schmückten, ist dem Harzer das Bewußtsein ins Herz gepflanzt, daß der Frühling wirklich eingezogen ist.
In Goslar schickte man sich an, das Fest der Maienkönigin zu begehen. Draußen vor dem Tore, aber im Schutze der Landwehr, erhoben sich lustige Zelte, mit Maien geschmückt und mit Teppichen behängt; von ihrer Spitze flatterten lustig die schwarzgelben Wimpel.
Am Nachmittage zog die Jugend aus, die Mägdelein im duftigen Sommergewande. Die Jünglinge in prächtigen, enganliegenden Seidenwams, das Federbarett kühnlich auf dem Haupte, boten zwar der strahlenden Sonne ein willkommenes Objekt, aber kühn und zuversichtlich schritten sie an der Seite ihrer Dame einher. Lustig ließen die Stadtmusikanten[S. 137] ihre Weisen erklingen. Auf dem Plan vor dem Rufzentore sollte sich's entscheiden, wem heuer die Krone der Anmut und Schönheit zuerkannt werden würde.
Die Alten, die Väter namentlich, zogen sich auf dem Festplatze alsogleich in die Zelte zurück, in das eigene, das des Nachbarn oder in die, welche zur öffentlichen Bewirtung der Gäste harrten. Die Jugend aber bewies, nach Geschlechtern getrennt und im bunten Durcheinander der Jünglinge und Mägdelein, daß der lange Winter die Geschmeidigkeit der Glieder und die Anmut der Bewegung nicht hatte ertöten können.
Die Reigen lösten einander ab, und auch der neue französische Tanz wurde von einem kleinen auserlesenen Kreise vorgeführt. Ein durchreisender Tanzmeister aus Paris war in Goslar angehalten worden und hatte sein Bestes getan, um die Pariser Grazie auch im rauhen Deutschland nicht ins Gegenteil verkehren zu lassen. Durfte man seinem Urteil glauben, so tanzte die Goslarer Jugend dieses zierliche Menuett, das, aus dem schönen Poitou stammend, in Paris eine veredelte Gestalt erhalten hatte, trotz einem Pariser und einer Pariserin.
Heinrich Achtermann war der Partner Vennes. Voller Entzücken hingen seine Augen an ihr, die die verkörperte Lieblichkeit und Grazie schien. Bei den Reprisen fand sich auch wohl Gelegenheit, ihr ein Wort zuzuflüstern. Noch hielt sie ihn in Schranken mit einem unmerklichen, aber unwilligen Schütteln des Kopfes oder leicht gerunzelter Stirn; aber je höher die Wogen der Freude und Lust gingen, desto wärmer wurde auch ihr ums Herz, und ein schneller, froher Blick streifte ihrerseits den Gesellen.
Als der Tanz zu Ende war, brach lauter Jubel los, und die umstehenden Bürger beteiligten sich ebenfalls wacker an dem Beifall.
[S. 138]
»Ein hübsches Paar, unsere Kinder,« flüsterte der Ratsherr Achtermann dem Bergherrn Richerdes zu. »Wie geschaffen füreinander. Und zum Sichfinden scheint es bei den beiden auch nicht mehr weit zu sein. Sollen wir abwiegeln oder helfen, Nachbar?«
»Es schlüge den Tatsachen ins Gesicht, wollte ich Euch widersprechen, Ratsherr, und dazu bin ich als Vater nicht bescheiden genug. Gewiß, ein stattliches Paar, und was das andere anbetrifft, so wird unsere Zustimmung den beiden sicher nicht ungelegen kommen. Aber da ist noch manches zu reden.«
»Gewiß,« fiel ihm Achtermann in die Rede, »doch ich hoffe, daß sich's ausgleichen läßt.«
»Nachbar,« sagte darauf Richerdes nicht ohne Ernst, »die Aufnahme meiner Tochter in Eurem Hause ehrt mich. Aber auf eins laßt mich mit allem Nachdruck hinweisen. Ihr seid reich, ich demgegenüber kaum wohlhabend. Ich will nicht, daß meiner einzigen Tochter später aus diesem Mißverhältnis Ärger erwächst. Könnt Ihr mir das versprechen, so mag die Sache ihren Lauf haben.«
»Ihr sprecht wie ein Mann, Richerdes, das ehrt Euch. Aber Ihr schickt Eure Tochter ja nicht mit leeren Händen. Wäre Venne arm, so würde ich aus demselben Grunde der Heirat widerraten; denn ist es schon bedenklich, wenn ein reiches Mädchen einen armen Schlucker freit, so taugt es niemalen und nimmer, wenn die Braut als Jungfer Habenichts einem reichen Mann die Hand reicht. Darüber seid also beruhigt. Könntet Ihr mich nur auch in diesem Augenblick befriedigen betreffs Eurer Gruben.«
»Ich habe mir auch die Sache inzwischen durch den Kopf gehen lassen«, sagte Richerdes, »und finde, daß Ihr vielleicht[S. 139] nicht unrecht habt. Doch da ist noch manches Beding zu erfüllen.«
»Das ist vortrefflich, Nachbar, das freut mich,« antwortete Achtermann, »das Weitere überlaßt nur mir. Sind wir über die Hauptsache im reinen, werden wir über Kleinigkeiten nicht stolpern. Nun aber kommt, hier ist unsere Arbeit getan. Wir wollen dem einen wie dem anderen einen edlen Trunk weihen. Seid mein Gast, Schwäher.«
Sie traten in das Zelt Achtermanns ein, und bald saßen sie hinter dem Becher mit funkelndem Wein und pflegten freundschaftliche Zwiesprache.
Auf dem Platze gingen die Reigen zu Ende. Noch war die Königin des Festes zu küren. Es gab kein langes Beraten unter den Richtern, wem sie den Preis zuerkennen sollten.
»Venne Richerdes ist die Schönste, Venne Richerdes soll Maienkönigin sein!«
Ein Jubel ohnegleichen erhob sich bei diesem Urteilsspruch. Freudig umdrängten sie die Freundinnen. Nur wenige standen mit einer Regung des Neides beiseite. Zu ihnen gehörte auch Alheid Karsten, die Tochter des Bürgermeisters. Nicht neidete sie Venne, daß sie die Schönste sein sollte; auch sie hätte ihr den Preis zuerkannt. Aber alles vereinte sich, um jene begehrenswert zu machen in den Augen der Männer, und dieses Lob heute trug noch mehr dazu bei, den von ihr heimlich Geliebten, Heinrich Achtermann, an sie zu ketten.
In lieblicher Verwirrung hielt Venne dem Ansturm der Jünglinge und Freundinnen stand. Heinrich Achtermann trat als letzter zu ihr heran.
»Nun, Königin, seid Ihr zufrieden? Die Herrscherin seid Ihr im Reiche der Schönheit, die Gebieterin im Bereiche[S. 140] der Grazie und Anmut. Nun werdet Ihr's glauben müssen, und nun begehre ich mein Recht.«
Venne tat überrascht. »Euer Recht? Wofür?«
»Muß ich Euch mahnen an den Abend im neuen Turm am Rosentore? Da wurde es abgemacht und von Euch zugestanden; würde das Menuett von Euch getanzt, gleich einer Pariserin, so sollte ich mir die Buße von Euren Lippen holen.«
»Aber ich bin der Ansicht, daß der Richter irrte und falsch urteilte«, widersprach sie errötend.
»Nicht auf Euch kommt es an, Venne, Euer Urteil ist befangen, Ihr seid Partei; ich halte mich an den öffentlichen Spruch und begehre mein Recht!« Er trat einen Schritt näher, als ob es ihm ankomme, schon jetzt sich die Buße einzulösen. Erschrocken wehrte Venne ab. »Aber Ihr wollt doch nicht hier vor allen Leuten ...«
»Nein, Venne, holde Venne«, flüsterte er ihr mit heißem Blick zu. »Wenn ich Deinen süßen Mund küsse, soll kein neidischer Lauscher zugegen sein. Heute aber, heute abend noch wird's geschehen!«
Erschauernd hörte Venne ihm zu. In seliger Ohnmacht ließ sie seine Worte über sich ergehen. Ja, sie wußte es, heute abend würde sie die Seine werden!
Immer höher gingen die Wogen der Freude. In den Zelten herrschte Bacchus unumschränkt; seine Jünger hatten ihm geopfert, daß die Köpfe zu zerspringen drohten. Auch die Jugend war in einen wilden Rausch des Weines und der Freude gesunken. Die Besonnenen mahnten zum Aufbruch, und als die Schatten des Abends herabsanken, zog der lange Zug in die Stadt zurück in toller, ungebändigter Lust.
[S. 141]
Venne ging versonnen und schweigsam neben Heinrich, die Brust geschwellt von süßen Schauern. Es war schon dunkel, als die Trennung von Freund und Freundin auf dem Marktplatz vor sich ging. Nun schritten Venne und Heinrich still nebeneinander dahin. Kein Laut störte die laue, wunderbare Nacht. Als sie aber das Dunkel der Bulkengasse aufnahm, da riß Heinrich die Holde an sich und raubte ihr hundertfältig, was ihm doch nur einmal zustand. Selig seufzend ergab sich Venne dem Liebessturm.
»Venne, meine einzige Königin, meine holde geliebte Venne!«
Da durchbrach auch die Liebe bei ihr die lange gezogene und mühsam gehaltene Schranke.
»Geliebter, mich dürstet nach Deinen Küssen!«
In einem süßen Taumel vergingen die Minuten. Endlich löste sich Venne aus seinen Armen.
»Wir müssen scheiden«, flüsterte sie, aber Heinrich widersprach ungestüm. »Habe ich so lange gedarbt, um Dich nach einem Augenblick schon wieder zu verlieren!« Da warf sie sich ihm in die Arme: »Heinrich, mein Einziger, ich liebe Dich, liebe Dich mehr, als Du ahnst. Aber schwöre mir in dieser seligen Stunde, daß Du mich nie verlassen willst; es bräche mir das Herz!« Ein heißer Kuß war die Antwort. »Du siehst die Sterne da oben am Himmelszelt; eher werden sie aus ihrer ewigen Bahn gerissen, als die Liebe zu Dir aus meiner Brust.«
Aber dann kam doch der Abschied. In einem langen Kuß trank ihre Sehnsucht sich satt; Venne schlüpfte ins Haus. Zum ersten Male seit langem eilte sie an der Kammer der Mutter vorbei, ohne ihr noch gute Nacht zu wünschen; ihr Herz war zum Zerspringen voll von dem, was sie erlebt.[S. 142] Geräuschlos gewann sie ihr Stübchen. Doch eine wachte noch wie immer im Hause und kam, um ihr beim Auskleiden zu helfen. Katharine war es, die alte Magd, die sie als Kind schon gewartet hatte. Trotz des Widerspruchs Vennes machte sie sich daran, die Bänder zu lösen und die goldenen Schnallen der Schuhe zu öffnen. Versonnen lächelnd blickte Venne in die Weite, die Hand auf das ungestüm pochende Herz gedrückt.
»Du bist so seltsam heute«, unterbrach die alte Vertraute die Stille. »Darf Deine alte Katharine nicht wissen, was Dich bewegt?«
»Ach, Katharine, Du verstehst mich doch nicht, was soll ich Dir also bekennen?«
Da entgegnete die Alte unwillig: »Ich soll Dich nicht verstehen, da ich doch Deine Regungen und Gefühle von Deinem ersten Tage an in Dir habe entstehen und sich regen sehen? Meinst Du, ich bin blind? Also, hat er endlich gesprochen, der Herr Heinrich?«
Erschrocken blickte Venne sie an. »Aber woher weißt Du denn ...?« »Also habe ich doch recht«, fuhr Katharine unbewegt fort. »Seine Wünsche kenne ich von anderen, und was Du für ihn empfindest, war mir auch längst bewußt. Aber er soll sich hüten,« fuhr sie fast drohend fort, »sich Deiner unwert zu zeigen oder Dich zu kränken, dann komme ich über ihn.« Lächelnd, voller Zuversicht wehrte Venne ab: »Wie kommst Du zu solchem Argwohn, Katharine?«
»Ich hatte einen bösen Traum. Aber es steht bei ihm, daß der Traum sich nicht erfülle.« Damit verließ sie die Glückliche.
[S. 145]
Vor den offenen Arkaden des Collegio di Spagna lösten sich die Sänften und Karossen der Bologneser in ununterbrochener Folge ab und entleerten sich ihres lebendigen Inhalts. Schöne Frauen schlüpften heraus in kostbarsten, duftigen Gewändern, das liebliche Antlitz den gaffenden Zuschauern unter einem leichten Schleier verbergend. Würdenträger schritten die Stufen hinan in ihrer reichen Amtstracht. Würdige Gelehrte, Geistliche im schlichten dunklen Gewande, kühn blickende Jünglinge in der modischen Tracht der Zeit, sie alle hatten dasselbe Ziel: die Festgemächer in dem spanischen Kollegium der Universität, in denen heute, wie alljährlich, der neue Dekan seinen Amtsantritt festlich beging.
Im Empfangssaale, dessen kristallene Kronleuchter das Gold der Decke wie das Marmorgetäfel der Wände widerspiegelten, wartete der Hausherr mit seiner Familie der Gäste und begrüßte sie, je nach Rang und Stand, mit besonderer Höflichkeit oder freundlicher Herablassung, aber immer mit der unnachahmlichen Zuvorkommenheit und Würde, die dem Spanier vor anderen eignet.
Ein lebhaftes Stimmengewirr in vielen Sprachen durchzog bald den Raum, gedämpft indes durch die Rücksicht, die man sich und den anderen schuldete, um nicht als unhöflich aufzufallen.
Das Festmahl, das in einem herrlich geschmückten, großen Saale vor sich ging, sah alles vertreten, was die alte Stadt[S. 146] an Anmut und Würde, an Reichtum und Gelehrsamkeit in ihren Mauern barg. An der Tafel wechselten die auserlesensten Gerichte, in den Kelchen funkelte edler Wein.
Wo die Jugend saß, ging die Unterhaltung am lebhaftesten vor sich. Perlend flossen die Neckereien vom Munde der schönen Damen, mit witziger Anmut übten die Herren die Gegenwehr aus. Ernster floß der Rede Strom, wo Gelehrte über Fragen der Zeit das Wort führten. Hier schwärmte ein Jünger im Apoll seiner Dame von der Schönheit Petrarkischer Sonette vor, dort bewies ein Kriegsmann in glänzendem Gewande, daß sein Beruf der allein des strebenden Menschen würdige sei.
Gisela von Wendelin mit ihren Eltern zählte zu den Gästen. Ihr Kavalier, der Sohn des Podesta, unterhielt sie lebhaft, aber sie schenkte ihm nur zerstreut Gehör. Ihre Gedanken eilten über die Alpen in die norddeutsche Stadt, wo der heimlich Geliebte, nie Vergessene nun schon seit langem weilen mußte. Noch hatte sie kein Lebenszeichen von ihm wieder erhalten. Und außerdem lastete es auf ihr wie ein Druck, wie die Vorahnung kommenden Unheils, ohne daß sie sich Aufschluß über ihre Gefühle zu geben vermochte. Ihre Blicke kreuzten sich mit dem des Vaters, der ihr in einiger Entfernung gegenübersaß. Gütig lächelnd nickte er ihr zu, da wuchs auch ihr wieder die Zuversicht.
Die Freude des Abends stieg mit der Dauer des Festes; sie schimmerte wieder in den glänzenden Augen der Damen, sie erklang aus den frohen angeregten Gesprächen der Männer. Da ging noch ein letzter, einsamer Gast in das Haus. Unhörbaren Schrittes und ungesehen schritt er an der Reihe der Diener vorüber, ungesehen betrat er den Saal.
[S. 147]
Sein glühender Blick überflog die Gäste. Dann näherte er sich der Festtafel. Hinter der schönsten der Damen hielt er an und beugte sich zu ihr nieder. Sie erblich unter seinem Hauch, und der zarte Leib erschauerte in Entsetzen. Und weiter ging der Gast. Dieses Mal war ein würdiger Ritter sein Ziel. Der zuckte zusammen und griff nach dem Herzen, aber er behielt sein Geheimnis für sich. Und weiter schritt der Unheimliche und beugte sich hier und beugte sich da. Und wo immer sein Hauch das Antlitz eines Gastes streifte, da erblichen die Wangen und erlosch die Freude. Und dann ging der Fremde davon, wie er gekommen, ungesehen und ungehört von den Dienern und nicht erkannt von der Menge der Gaffer. Das Fest aber wurde abgebrochen, weil, unbegreiflich und unerklärlich, ein Unwohlsein die Gäste befiel, die der Fremde gezeichnet. Am nächsten Tage schon in der Frühe, da wisperte es in der Stadt und raunte und ging in laute Wehklagen über: »Der Schwarze Tod ist da, die Pest ist in der Stadt!«
Wir nüchternen und klugen Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts wissen, wo diese Geißel des Menschengeschlechts ihre Heimat hat, wenn wir ihrer auch noch nicht Herr geworden sind. Zwischen dem Tianschan-Gebirge und dem Altai, im fernen Asien, im Osten auf das Sandmeer der Wüste Gobi blickend, im Westen auf die Kirgisensteppe herabschauend, erhebt sich der Tarbagatai, das Murmeltiergebirge, nach dem Tarbagan, dem Murmeltier, benannt. Dieses Tierchen, das zu Millionen dort haust, ist der Träger des Pestkeimes. Und wenn es selbst dieser Seuche erlegen, wirkt noch sein kleiner Leichnam als Überträger an allem, was in seine Nähe kommt, Tier und Mensch. Die Menschen fliehen aus ihren Siedlungen und tragen den Krankheitsstoff[S. 148] zu ihren Nachbarn. Und alles muß der Schrecklichen dienen, was Bewegung hat, Wind und Wasser, um ihre Herrschaft auszubreiten.
Unsere Vorfahren standen dem furchtbaren Würger in ohmächtigem Grausen und Entsetzen gegenüber; nichts anderes wußten sie ihr entgegenzusetzen als dumpfe Verzweiflung, wildes Wehklagen, brünstige Frömmigkeit oder tierische Lust. Wehe dem Ort, den diese Geißel überfallen, wehe der Stadt, in deren enge Gassen und dumpfe Häuser sie Einkehr hielt.
Sie kam nicht ohne Vorzeichen, so wußte es das Volk: Geflügelte Rosse am nächtlichen Himmel, mit seltsamen Reitern auf ihren Rücken, zogen unter Horrido mit der Meute auf den Wolken dahin. Öffnete man einen Rosenapfel, so entwich daraus wohl eine winzige Spinne. Dann war die Pest nahe. Sie wurde von Teufeln und bösen Geistern in die Brunnen gepflanzt; auch schlimme Menschen, Hirten, Hexen, Zigeuner und Juden vergifteten das Wasser.
Man suchte sie abzuwehren durch verdoppelte Frömmigkeit, Fürbitten der Heiligen und Wallfahrten. Aber eines guten Tages war der unheimliche Gast da. Wer es konnte, floh von der Stätte, wo sie einbrach, doch er war seines Lebens darum nicht viel sicherer; denn die anderen draußen erschlugen ihn, wenn sie erfuhren, daß er aus einem verseuchten Orte kam, um mit dem Träger die Krankheit am Vordringen zu hindern.
Wehe, dreimal wehe aber den Kranken selbst und den Häusern, in die der Schwarze Tod Einzug gehalten! Sie wurden gezeichnet, versperrt, daß niemand hinaus oder herein könne. Der Kranke mit seinen Angehörigen war von aller Welt abgeschlossen, und sie konnten verhungern, wenn[S. 149] sich nicht eine barmherzige Seele fand, die ihnen heimlich Nahrung zutrug.
In Bologna wütete die Seuche wie nie zuvor. Anfangs kündeten noch die Glocken, daß wieder ein Bewohner der Stadt ihr zum Opfer gefallen sei; aber dann schwiegen auch sie, denn ihr klagendes Gewimmer hätte sonst den Tag und die Nacht durchgellt. Die Stadt war tot. Vermummte Träger durchzogen mit Bahren und Karren die Straßen und lasen die Toten auf, die aus den Fenstern gestürzt wurden. Es lag auch wohl einmal einer unter ihnen, aus dem noch nicht alles Leben entflohen war: sie achteten des nicht, wer auf den Bahren und Karren lag, wanderte auch in die großen, mit Kalk gefüllten Gruben vor den Toren.
Die Pest, die wie ein hungriges Raubtier sich auf die unglückliche Stadt gestürzt hatte, zog nach Monden wie ein satter Gläubiger davon, der dem armen Schelm den Rest der Schuld stundet, bis es ihn gelüstet, wiederzukehren, um sich auch das Letzte als verfallenes Pfand zu holen. Verödet lagen die Häuser, verlassen die Straßen. Familien waren ausgetilgt, Geschlechter erloschen. Noch wich der Nachbar dem Nachbarn aus, wenn er ihn von fern sah. Aber leise, leise regte sich doch die Hoffnung, daß der Würger gegangen, und langsam keimte die Freude, daß der eigene Leib nicht von der Geißel geschlagen sei.
Giselas Vater war einer der ersten gewesen, welche dem grausigen Gaste auf seinen Wink folgten. Wenn das Wort nicht trügt, daß die Ängstlichen der Krankheit am ersten verfallen, so bewahrheitete es sich auch an der Mutter. Scheu hielt sie sich von dem einst so sehr geliebten Gatten fern, und laut ertönte ihr Jammern, als die ersten Anzeichen der Seuche sich auch bei ihr zeigten.
[S. 150]
»Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben!« so gellte ihr klagender Ruf durch das Haus. Aber vergeblich erklang ihr Flehen und Wimmern, auch sie trugen die schwarzen Männer nach einigen Tagen davon.
Nun war Gisela ganz allein in dem großen, leeren Hause. Sie hatte den Vater gepflegt, und sein letzter, dankbarer und trauriger Blick galt der treuen Tochter. Sie wich auch nicht vom Lager der Mutter, bis diese die Augen schloß. Unheimlich war es in dem öden Hause. Die Diener geflohen, die Mägde gestorben oder davongelaufen. Sie wäre verhungert, hätte ihr nicht eine fromme Frau aus dem Kloster der Ursulinen, erwiesener Guttaten eingedenk, heimlich Nahrung gebracht. Als die Sperre von den Häusern genommen wurde, als die Tore sich öffneten, da fand sie sich als eine einsame Waise unter Fremden; die Befreundeten und Verwandten tot, die Bekannten, soweit sie lebten, an fernen Orten. Hilflos, einsam wohnte sie im Hause der Eltern und hätte des Trostes mitleidiger Menschen doch so sehr bedurft.
Was hielt sie noch in dieser Stadt, die ihr fremd geworden, wo die gespenstig leeren Häuser und Straßen ständig an das Unglück gemahnten, das sie betroffen? — Da stieg die Sehnsucht in ihr auf nach dem fernen Deutschland, nach der liebevollen Base und die Erinnerung an den Mann im selben Lande, dem ihr Herz noch in gleicher Liebe entgegenschlug wie einst. Und sie faßte den Plan, der Freundin zu schreiben, sie um Obdach zu bitten, und so kam dieser Plan zur Ausführung.
[S. 151]
Nachdem das Gebirge die Oker aus der engen Haft entlassen hat, in der sie sich, vom Bruchberge herabhüpfend, zwischen steilen Bergen und jäh abstürzenden Felswänden dahinwand, lacht bei dem rauchigen Hüttenort Oker die Freiheit. Fröhlich eilt sie in die lockende Weite, und über dem Staunen ob der neuen, fremden Welt, entgleitet ihr alles, was sie tändelnd und spielend an sich hielt, glattrunde Kiesel und feinkörniger Kies. Denn die Wasserfrauen haben ihr ins Ohr geraunt, da draußen, unter den Menschen, müsse man sich ehrbar und gesittet benehmen, wolle man Achtung genießen.
So wird aus dem wilden Gebirgskinde ein ruhig dahinziehendes Wasser. Aber hat es die Wildheit abgetan, so ist ihm dafür die Eitelkeit in die Glieder gefahren. Kokett sich drehend und windend, als wolle es mit eigenen Augen die rückwegige Schönheit bewundern, durchmißt es das Stück von Börßum bis nordwärts Braunschweig. So geht der Weg dahin zwischen flachbordigen Talwangen, bis es weiter nordwärts in die Heide kommt und nun sich vollends den Erwachsenen zurechnet. Unter dem ernsten Heidevolke ist auch die Oker ein stilles, ernstes Gewässer geworden.
Doch bevor sie das beschauliche Dasein eines besinnlich und bedächtig seines Weges schreitenden Alten erreichte, hatte sie schon zu jener Zeit nützliche Arbeit unter den Augen der Menschen zu leisten. Vor der Festung Wolfenbüttel wurde sie in viele Arme zerteilt, die das Schloß der braunschweigischen[S. 152] Herzöge, wie die Festung selbst mit einem schützenden Wassergraben umzogen oder in der Stadt die Mühlen trieben.
Gleiche Dienste fielen ihr auch in der einige Wegstunden nordwärts gelegenen Stadt Braunschweig zu. Suchte sich der Herzog gegen Angriffe von seinesgleichen zu schützen, so trieb die Braunschweiger bei der Sicherung ihrer Stadt, je länger, desto ausgesprochener, der Wille und Wunsch, dem eigenen Landesherrn Trutz bieten zu können. Wenn der Welfe auf die Höhe des Lechelnholzes ritt, eine halbe Stunde nordwärts seines eigenen Schlosses, konnte er den Turm von St. Andreas in die Lüfte ragen und die Stümpfe des Domes Sankt Blasius, wie das Heer der anderen Kirchen sich erheben sehen. Dann wallte wohl in ihm der Groll auf über die ungehorsame Tochter, die sich ihm verschloß und seine Gesandten abschlägig beschied auf sein an den Rat gerichtetes Ansinnen oder sie gar mit höhnischer Antwort heimschickte.
Und dabei mußte er seinen Zorn in sich hineinwürgen, denn es gab kein Mittel, um die Widerspenstige zu zähmen oder zu überwinden, im Gegenteil, die Erfüllung dieses Wunsches rückte in immer größere Fernen, je mehr die Macht der Stadt stieg. Übel lohnte sie es den Nachfolgern Heinrichs des Löwen, der ihr die erste Befestigung gegeben und den prächtigen Dom errichtet hatte, so mochte der Nachfolger selbst urteilen.
Aus der kleinen Siedlung, die der Herzog Bruno zur Zeit der Karolinger gegründet haben sollte, war ein mächtiges und volkreiches Menschenzentrum geworden. Die große Heerstraße, die nördlich des Harzes und hart am Südrande der menschenleeren, unwirtlichen Lüneburger Heide[S. 153] das Deutsche Reich von Westen nach Osten durchzog, wie die Wege nordwärts zu den Handelsplätzen der Nord- und Ostsee schrieben ihr die Rolle vor, die sie zu spielen berufen war. Der Anschluß an die Hansa, deren Quartierstadt im niedersächsischen Kreise sie bald wurde, hob ihr Ansehen und ihre Schönheit.
Mit Goslar, zu dem es viele Handelsbeziehungen unterhielt, verbanden es freundnachbarliche Bande, die um so enger wurden, je mehr der Ärger des Herzogs auf sie selbst und sein Neid auf die reiche Stadt am Harz, ihr Bergwerk und ihre Forsten offenbar wurde und gleiche Gefahr für beide kündete.
Der Reichtum seiner Bürger war fast sprichwörtlich geworden, und sie steuerten davon gern und willig nach den Schatzungen ihres Rates, um die Selbständigkeit der Stadt zu sichern. Wohl ausgestattete Arsenale, eine stattliche Zahl von Söldnern unter kriegserprobten Offizieren, denen im Falle der Not die wehrhafte Bürgerschaft sich noch zugesellte, hatte sie befähigt, den Herzögen auch im offenen Felde mehr als einmal standzuhalten.
Groß war die Zahl seiner Einwohner, zu groß fast für die Enge der Mauern und die Erwerbsmöglichkeit. Daher zogen viele seiner Söhne hinaus in die Fremde, um als tapfere Landsknechte Beute und Reichtümer zu erwerben. Ganze Fähnlein marschierten aus den Toren, unter heimischen Hauptleuten. Viele gingen in den Wirren und Kämpfen auf den Kriegsschauplätzen in aller Herren Länder zugrunde. Manche kehrten zurück nach einem Leben der Wanderung und Mühsal, um in der Heimat, fern dem Kampfeslärm, ihre Wunden zu heilen und der Ruhe zu pflegen; wenige nur unter ihnen sahen ihre Träume erfüllt.
[S. 154]
Von den Offizieren stieg mancher zu hohem Ansehen. Der Name ›Braunschweigischer Hauptmann‹ hatte draußen einen guten Klang. Mehr als einer von ihnen führte ein Regiment oder war gar zum General aufgerückt. Verschlang sie nicht der Krieg, so kehrten sie wohl zuletzt auch in die Heimatstadt zurück, um in behaglicher Ruhe von erkämpften Siegen und gewonnenem Ruhm zu träumen. Zu ihnen gehörte auch der Obrist von Walldorf, dessen Damen in Bologna den neugebackenen Doktor juris Johannes Hardt von dem Hause Wendelin Abschied nehmen sahen.
Die Walldorfs wohnten in einem behaglichen Patrizierhause an der Echternstraße. Die Wallfahrt nach Rom hatte gute Dienste getan, und Glück und Zufriedenheit herrschten in dem gastlichen Hause. Johannes hatte einmal bei ihnen vorgesprochen. Er war schon seit Jahresfrist in den Dienst seiner Stadt getreten, und der Rat schickte ihn, in Erinnerung seiner bewiesenen Zuverlässigkeit, mit einem wichtigen Schreiben an die Braunschweiger dorthin.
Wenn Johannes gehofft hatte, bei dieser Gelegenheit etwas von Gisela zu hören, so sah er sich in dieser Erwartung getäuscht, denn es war noch kein Lebenszeichen von den Wendelins über die Alpen gekommen, seit die Damen zurückkehrten.
Trauer bemächtigte sich seiner, wenn er sah, wie die Erfüllung seiner Hoffnungen in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt blieb, während alle diejenigen daheim, denen er nahestand, dem Ziele ihrer Wünsche nahegekommen oder es erreicht hatten. Venne Richerdes war dem Heinrich Achtermann verlobt, und es schien nur noch eine Frage von kurzer Zeit, daß die Hand des Priesters sie zusammengab. Erdwin Scheffer hatte seine Monika heimgeführt und war[S. 155] wohlbestellter Weibel des Rates. Wenn die Zeit es erlaubte und die Gäste im ›Goldenen Adler‹ sie nicht zu sehr in Anspruch nahmen, schlüpfte Immecke Rosenhagen in die Wohnung des jungen Paares, um sich des Glücks ihrer Kinder zu freuen und das kleine Großtöchterchen auf ihren Armen zu wiegen, das das leibhafte Ebenbild ihrer Monika zu werden versprach. Allen hatte das Glück seine Tore geöffnet, nur ihm blieben sie verschlossen. Traurig und niedergeschlagen kehrte Johannes nach Goslar zurück.
Wenige Wochen darauf traf in Braunschweig der Brief Giselas mit der erschütternden Kunde des Todes ihrer Eltern ein. Die Antwort, daß sie bei den Walldorfs herzlich willkommen sei, ging sogleich nach Bologna ab, aber es verlief doch der Winter, ehe sie selbst ankam.
Richenza hielt es für selbstverständlich, an Johannes Hardt sogleich Nachricht von der bevorstehenden Ankunft der Geliebten gelangen zu lassen. Aber hieß es für ihn sich in Geduld fassen, bis der hoffentlich nicht ferne Tag gekommen, wo er sie selbst von Angesicht zu Angesicht schauen würde. Als dann der Ruf der Freundin kam, fand er ihn voller Ungeduld. Dieses Mal wartete er keinen besonderen Auftrag des Hochmögenden Rates ab, sondern er brach nach Braunschweig auf, sobald es sich einrichten ließ. Bevor er abreiste, sprach er mit den Eltern über seine Pläne und Wünsche.
Des Vaters Absichten gingen andere Wege. Er hätte es lieber gesehen, daß der Sohn eine Einheimische freite, aus alter Familie, deren Einfluß und Ansehen dem Sohn gewiß auch für seine weitere Laufbahn förderlich gewesen wäre. Aber sein Zureden scheiterte an der Entschlossenheit des Sohnes, der erklärte, daß er Gisela zum Weibe wolle oder[S. 156] gar keine. Mit einem Seufzer gab jener zuletzt nach. Ob er einen besonderen Wunsch dabei zu Grabe trug, blieb Johannes verborgen.
Noch war er freilich auch der Zusage Giselas selbst nicht sicher. Wenn er aber des Abschieds in Bologna gedachte, schwanden alle Zweifel. Zu offen hatte ihr Herz ihm damals entgegengeschlagen, und er durfte hoffen, daß kein anderer inzwischen von ihm Besitz ergriffen hatte, sonst hätte sie wohl kaum den Weg nach dem fernen Deutschland eingeschlagen.
Die Brust geschwellt von seliger Erwartung und im Herzen tiefes Mitleid mit der vom Schicksal so Schwergeprüften, brach er nach der alten Stadt an der Oker auf.
Johannes war erschüttert, als er der Geliebten zuerst entgegentrat: Was hatte die Zeit aus dem lebensfrohen, lieblichen Geschöpf gemacht, das er vor einigen Jahren in Bologna verließ? Ein blasses Gesichtchen, aus dem die dunkeln Augen von tiefen Schatten umlagert, Mitleid heischend und hilfesuchend ihn anblickten, tauchte vor ihm auf. Als sie den Langersehnten, immer Geliebten vor sich sah, den Zeugen ihrer glücklichen Jugend im trauten Familienkreise, kamen ihr die Tränen aufs neue. Ein stilles Schluchzen erschütterte ihren zarten Körper. Johannes trat zu ihr und ergriff stumm ihre Hände. Aber als sie allein waren, da fanden sie Worte. Vor ihm entrollte sich das furchtbare Bild der Seuche in Bologna, und er vernahm aus ihrem Munde, wie grausig das Ende ihrer Eltern gewesen war. Da hielt er nicht länger an sich. Sanft zog er sie an sein Herz und träufelte ihr süßen Trost in die schmerzerfüllte Brust.
»Habe Vertrauen zu mir, Geliebte. Unter meinem Schutz[S. 157] wirst Du vergessen lernen, und die Vergangenheit liegt bald wie ein böser Traum hinter Dir. Mein Mütterchen wird Dich an ihr Herz schließen als zweite Tochter, und in der Schwester gebe ich Dir eine Freundin, die mir beistehen wird, den letzten Gram in Deiner Brust zu tilgen.« Da lächelte sie ihn unter Tränen an. Doppelt liebreizend war sie in ihrer rührenden Hilflosigkeit. Aber eine leise Röte der Zuversicht und Freude stieg in die blassen Wangen.
»Oh, wie danke ich dem Himmel, daß er Dich mir schenkte. Ich weiß nicht, wie ich die furchtbare Bürde allein weiter hätte tragen sollen. Habe Dank mein einzig Geliebter, habe Dank!«
Innig drückte sie sich an ihn, und Johannes besiegelte seine Schwüre mit einem heißen Kuß.
Diesmal war der Abschied für ihn nicht so schwer. Er ließ die Geliebte in treuer Hut zurück. Es galt nur noch, das Nest zu bereiten für ihr Glück. Bald, so hoffte er und vertraute sie, hatte auch für sie die Zeit der Trennung ein Ende für immer.
[S. 158]
Neben den Beziehungen freundschaftlicher und politischer Art, die zwischen den Städten Braunschweig und Goslar bestanden, liefen Fäden hin und her vom Schlosse des Welfenherzogs zu Wolfenbüttel nach der alten Reichsstadt am Fuße des Rammelsberges, von denen der Rat nichts wußte oder die doch so geheim gesponnen wurden, daß er sie nicht zerschneiden konnte. Nach Wolfenbüttel und noch nach einer anderen Stätte hin reichten sie, die wiederum nur dem Herzog und seinem Vertrauten und einigen wenigen bekannt waren. Die aber hüteten sich weislich, mit ihrer Kenntnis hervorzutreten; denn es wäre ihnen nicht nur eine angenehm fließende Geldquelle dadurch verschüttet worden, sondern sie hätten sich auch der Gefahr ausgesetzt, daß sich Meister Rotmantel ihrer annahm, der in jener Zeit, wie seine Berufsgenossen andernorts, in Goslar sein gutgehendes Geschäft ausübte, darin bestehend, daß er die Neugier eines wohlweisen Rates über ihre Tätigkeit in Gegenwart von den Bevollmächtigten des Rats zu befriedigen suchte, wobei er nur durch freundliches, aber dringendes Zureden zur Antwort mahnte.
Es gab da allerhand Mittel und Mittelchen, um auch die Schweigsamsten zum Reden zu bringen, von den Daumenschrauben bis zum Strecken des Körpers, wobei die Glieder allerdings aus ihren Gelenken gerissen wurden. Und half das noch nichts, so griff man noch zu gröberen Mitteln, die wir auszuführen Bedenken tragen, um nicht die nächtlichen[S. 159] Träume leicht erregbarer Leserinnen mit allerhand fragwürdigen Gestalten zu erfüllen.
Im übrigen ging alles nach einer peinlich festgesetzten Ordnung, auch das Bezahlen. Der Henker wußte genau, was er nach getaner Arbeit vom Säckelmeister eines Hochmögendes Rates zu erwarten hatte oder was er, nachdem das Erforderliche der Frau Eheliebsten abgeliefert war, in der Herberge oder im Ratskeller aus dem angeketteten Becher sich zugute tun durfte.
Zu solchen Personen, welche ihre Tätigkeit vor der Neugier des Rates ängstlich verbargen, gehörte zum Beispiel die Gittermannsche aus der Dröwekenstraße, wie ihr Vetter, der Schäfer Hennecke Rennenstich, der »Up den Ymminghove« Wohnung und Beschäftigung fand.
Von dem Nordabhang des Lindthalskopfes, der seine steile Stirnseite dem tiefen Graben des Innerstetales zukehrt, hüpft eilenden Laufes der Steimkerbach herab. Die Sonne bekommt dieser muntere Geselle erst zu sehen, wenn er den Gebirgswald verläßt; denn bis dahin überschatten ernste Tannen und laubdunkle Buchen und Eschen sein schmales Bett. Verträumt blinzelt er auf und eilt dann, im vollen Lichte des Tagesgestirns und doch ungesehen, unter Lattich und hängenden Weidenbüschen durch die Wiesen dahin, bis unfern des Dorfes Lutter am Barenberge er sich der Neile vermählt.
Frei geboren und frei geblieben bis zu der Stelle, wo er seinen Lauf beendet, darf das Wässerchen von sich rühmen;[S. 160] denn des Menschen Hand hat ihm kein Joch auferlegt. Dasselbe gilt auch von dem Dolgerbach, der in kurzem Lauf mit dem Kiefbach zusammen den Steimkerbach aufsucht. Aber der Dolgerbach war nicht immer frei. Vor Jahrhunderten, als noch das Dorf Dolgen stand, mußte er eine Mühle treiben, die unweit des Dorfes gelegen war.
Damals war das Tal des Steimkerbaches noch düsterer und finsterer als heute. Urwaldartig deckte der Wald die Hänge und die Talsohle, und den Eingang am Waldessaum versperrte dichtes Gestrüpp. Nur der Hirsch, der zur Tränke zog, und der Eber, der in seinem Sumpf suhlte, störten die Stille, welche das Tal füllte. Menschen verirrten sich nicht dorthin, und selbst der herzogliche Jäger, der im Dorf Dolgen hauste, mied die Stätte, denn es war dort nach seinen eigenen Wahrnehmungen nicht geheuer. Wer Mut besaß, die Geister zu bestehen, die dort ihren Spuk treiben sollten, der fand an diesem Tal eine Stätte, in die ihm keines Fremden Neugier folgte. Und es gab solche Männer, die einen Unterschlupf fanden, wenn ihnen der Boden draußen in der Ebene zu heiß wurde, wilde Gestalten, denen das Wasser ein Feind und der Bartscherer eine unbekannte Größe waren.
Man mußte wohl eine Stunde weit das Tal hinaufdringen und durfte ein zerschundenes Gesicht nicht scheuen, wollte man an das seltsame Heim dieser Menschen gelangen. Aber dann war man auch überrascht über das, was die Wildnis bot. Unter einem überhängenden Felsen, etwas abgekehrt vom Bache, erhob sich eine feste Hütte, aus Stämmen roh aufgeführt, die Fugen mit Moos verstopft.
Kleine Öffnungen, die verschlossen werden konnten, ließen[S. 161] etwas Helligkeit in das Innere, aber man war unabhängig davon: Fackeln und Kerzen ersetzten das Tageslicht, und wenn man nicht allzu große Ansprüche stellte, konnte man es sogar wohnlich drinnen finden. Die Wände waren mit Teppichen verhängt; mit Teppichen verschloß man auch die Fensteröffnungen im Winter, noch hinter den vorgelegten Läden, um die kalte Luft abzuwehren. An den Seiten liefen Bänke entlang, vor denen festgefügte Tische standen. Ebenso rohgezimmerte Holzschemel vervollständigten die Inneneinrichtung, abgesehen von einem offenen Herde, in dessen Nähe eisernes Kochgeschirr, Bratpfannen und irdene Näpfe verrieten, daß man ihn zu benutzen verstehe.
Der Rauch suchte sich einen Ausweg nach oben, wo und wie es ihm gefiel. Freiheit zu tun und zu lassen, was dem einzelnen beliebte, war überhaupt oberster Grundsatz in dieser Behausung. Wer schlafen wollte, erhob sich vom Tisch und suchte sein Lager auf Heu und Decken, wo es ihm gefiel und wo ein Platz sich bot. Nur ein kleiner Verschlag blieb davon ausgenommen, wo die Hausfrau ihr Lager aufschlug. Diesen Raum wagte ohne besondere Erlaubnis keiner der Gesellen zu betreten, denn die Eigentümerin war eine Respektsperson, selbst für diese wilden Männer.
Ein seltsames Frauenzimmer, das mit ihnen hier in der Wildnis wirtschaftete. Mit Schönheit war die Frau nicht überladen. Aus verrunzeltem Gesicht blickten schwarze, scharfspähende Augen den Besucher an. Die beiden gelben langen Eckzähne, die ihr von dem einstmaligen Reichtum geblieben, trugen auch nicht gerade zur Erhöhung ihrer äußeren Reize bei.
Hätte sie unter Menschen gelebt in einer Stadt, so wäre sie durch den Leumund der lieben Nächsten gewiß schon der[S. 162] Hexerei geziehen und dem hochnotpeinlichen Gericht wie dem Henker vorgeführt worden. Danach trug sie aber kein Verlangen, denn sie war Meister Rotmantel schon einmal überantwortet gewesen. Damals hatte man ihr allerlei Untugenden vorgehalten, wie zum Exempel, daß sie es mit der Ehrbarkeit nicht allzu genau nehme; sie war gestäupt und gebrannt worden, und man entließ sie mit der ernstlichen Vermahnung, immer eine gewisse Entfernung zwischen sich und der Stadt zu beobachten.
Diesen Rat befolgte Luke Meyse ehrlich, denn ihr lag wenig daran, sich bei Meister Rotmantel und seinen Knechten noch einmal in Behandlung zu geben.
Luke Meyse war wirklich einmal schön gewesen, sehr schön sogar, aber die Schönheit wurde ihr zum Verderben. Sie stieg ihr so sehr zu Kopfe, daß sie, ehrlicher, einfacher Leute Kind, meinte, sie sei zu etwas Höherem geboren, als des Nachbars Sohn Tyle zu freien. Es kam auch ein Höherer und nahm sich ihrer Schönheit an, ein richtiger Edelmann. Aber als er sie genossen hatte, warf er sie beiseite. Nun war sie auch Tyle nicht mehr schön genug, und sie ging mit ihrer Schande auf und davon. Es fanden sich auch nachher noch Männer, denen die Reste ihrer Schönheit zusagten, doch sie sank dabei immer mehr, bis der Henker ihr das Mal aufbrannte.
Nun lebte sie schon seit vielen Jahren in dieser Wildnis, und ihre Gesellschaft waren Gesellen, die vor einer Berührung mit den Behörden oder mit Meister Rotmantel nicht minder bescheiden zurückwichen. Ihre Zahl schwankte je nach der Jahreszeit und ihren »Geschäften«. Nur selten erlitt sie auch eine plötzliche Einbuße, weil einem ihrer Genossen bei seinen »Geschäften« ein Stück Blei zwischen die[S. 163] Rippen gefahren war oder er seine Widerstandsfähigkeit gegen einen Hieb mit Schwert oder Hellebarde überschätzt hatte. Dann blieb sein Platz unbesetzt, oder ein anderer rückte an seine Stelle. Lange Gedächtnisreden wurden nicht gehalten. Ein Fluch über das Mißgeschick, und die Sache war abgetan. Kehrte einer oder der andere mit einer Wunde zurück oder litt er sonst an einer Gebreste, so brachte ihn Luke wieder zuwege.
Langeweile litt Luke Meyse nicht; denn einer oder der andere der Gesellschaft war immer anwesend, mindestens der einarmige Brand Cramer, dem sie bei einem Zusammentreffen mit Bauern dieses wertvolle Körperglied zerschmettert hatten. Er war Schaffner des Hauses und Stallmeister in einer Person. Denn auch Pferde fanden in einem an den Felsen gelehnten Schuppen Unterkunft.
Und dann gab es da noch ein junges Ding, Ylsebe genannt. Wie sie sonst noch hieß, wußte niemand. Man hatte sie an der Straße aufgelesen, wo sie neben der erschlagenen Mutter jämmerlich schrie. Sie war der Liebling Luke Meyses und der Verzug der ganzen Bande. Wild und lustig, mit krausem Haar und schwarzfunkelnden Augen, bildete sie das belebende Element der Hütte. Übergriffe gegen sie wußte Luke kurz und bündig abzuweisen. Wurde es Ylsebe zu langweilig im Steimkerbachtale, dann eilte sie wohl auf einen Sprung und einige Stunden nach der Dolgermühle zu ihrer Freundin, der roten Aleke Swarte, des Müllers Tochter, die ihr an Wesen gleichkam.
In der Dolgermühle traf sie sicher auch noch andere lustige Gesellschaft, denn dort fand sich auch gemeinlich allerlei Volk zusammen, ähnlich dem im Tale des Steimkerbaches. Die Mühle war verwahrlost, die Bauern gingen[S. 164] mit ihrem Korn lieber zur entfernten Pöbbeckenmühle, wo sie schneller und redlicher bedient wurden. Der Müller zürnte ihnen deshalb nicht allzu sehr, denn an der Ausübung seines Handwerks lag ihm wenig: Wozu sollte er die Mahlgänge bedienen, nachts den Schlaf versäumen, wenn er auf andere Weise bequemer und lustiger zu Gelde kam? Denn lustig ging es her bei ihm bei Essen und Zechen und Würfeln. Die Besucher ließen sich nicht lumpen für die schönen Sachen, die ihnen des Müllers Weib briet oder der Müller selbst aus dem versteckten Keller hinter der Scheune vorsetzte. Aber das waren nur die Nebeneinnahmen.
Den Hauptteil warfen die »Geschäfte« ab, die mit den Besuchern von ihm als vollgültigem Partner abgeschlossen wurden. Bei ihm wurde nämlich alles geplant, was heranreifte oder was sich zufällig bot. Wenn irgendwo in der Umgebung ein Überfall vor sich ging, ein Haus in Flammen aufloderte, ein reicher Bauer in seinem Bett erschlagen aufgefunden wurde, wenn die Städter mit ihren Herden in Seesen und Goslar geschatzt, ihre Wagenzüge angehalten und überfallen wurden, so war der Plan dazu sicher in der Dolgermühle ausgeheckt worden.
Hin und wieder tauchte ein Mann auf, der ein besonderes Ansehen besaß. Daß er unter den Gesellen eine bevorrechtete Stellung einnahm, ging schon aus der Anrede hervor. Er wurde als »Herr Hermann«, auch »Herr Raßler« angesprochen. Raßler war ein Mann von gedrungener Gestalt, dem die wilde Entschlossenheit aus den Augen leuchtete. Das gebräunte Gesicht wäre hübsch zu nennen gewesen ohne eine tiefe Narbe, welche die Stirn fast wagerecht durchzog. Er besaß alle Eigenschaften eines Führers: scharfes Urteil, schnelle Beobachtungsgabe und einen großen Mut.
[S. 165]
Als Sohn eines Arztes in Hildesheim hatte er das juristische Studium ausüben sollen, wurde aber durch viele böse Streiche anfangs schon aus dieser Bahn herausgeschleudert und relegiert; doch er war kein Verbrecher von gewöhnlichem Schlag wie seine Leute. Er sah in sich ein Rachewerkzeug gegen die menschliche, verderbte Ordnung. Auf den Erwerb von Beute und Reichtum legte er nur insoweit Wert, als sie ihn befähigten, seinen Weg zu gehen.
Deshalb, weil er nie einen besonderen Anteil beanspruchte und seine Hilfsbereitschaft jederzeit sich äußerte, erkannten sie in ihm die Führernatur, die ihnen Gewähr bot, daß die ausgeheckten Pläne meistens ohne große Opfer durchgeführt werden konnten.
Hermann Raßler war kein Wegelagerer gewöhnlichen Schlages. Das erwies sich aus der Kühnheit seiner Pläne, wie der Art ihrer Durchführung. Er selbst trat nur bei den großen und wichtigen Sachen in Tätigkeit, die Kleinigkeiten überließ er seinen zahlreichen Helfershelfern. Wo sein eigentlicher Wohnsitz war, wußten nur wenige Vertraute. Er kam und verschwand, und niemand fragte, wo er bleibe. Daß er zur rechten Stunde zur Stelle sein werde, war ihnen Gewähr genug.
Die kleinen Untaten fielen nicht eigentlich auf sein Konto; er duldete sie, weil er seine Leute bei Laune halten mußte. Meistens richteten sie sich gegen Menschen, die sich durch Habsucht oder eine ähnliche Untugend verhaßt gemacht hatten. Sie bedauerte er nicht; denn er gefiel sich je länger desto mehr in der Rolle des Schicksalswalters, der berufen war, über die Ungerechtigkeit der Welt zu Gericht zu sitzen.
Raßler war ein weithin gefürchteter Bandenführer, und der Ruf seiner kühnen Streiche veranlaßte mehr als einen[S. 166] der Großen, sich seiner Dienste zu bedienen, um einem Gegner im geheimen Abbruch zu tun an seinem Eigentum. Kleine Städte und reiche Dörfer sollten ihm, so hieß es, um sich seiner Huld zu versichern, Tribut zahlen.
Zu seinen »Kunden« zählte auch der Herzog von Braunschweig. Er bediente sich seiner gegen die Stadt Braunschweig, namentlich aber gegen das reiche Goslar, um die Bürger mürbe zu machen zur Annahme seines fürstlichen Schutzes. Raßler übernahm diese Aufgabe besonders gern und willig, denn mit dem Rate in Goslar hatte er ein Hühnchen zu rupfen. Die Goslarer hatten ihm nicht nur, wie bei dem Treffen im Hohlwege bei Riechenberg, wertvolle Leute erschlagen oder aufgeknüpft, sondern er war ihnen besonders deshalb gram, weil bei einer dieser Gelegenheiten auch sein einziger, wirklicher Freund, der gleich ihm aus der Bahn geriet, in ihre Hände fiel und schimpflich gerichtet wurde.
Im Schlosse zu Wolfenbüttel war Raßler keine unbekannte Persönlichkeit, wenn er dort auch unter anderem Namen aus- und einging. Durch des Herzogs Spione in Goslar, die zum Teil recht angesehene Bürger waren, wie auch aus eigenen Quellen wurde Raßler über die Vorgänge in der Stadt immer im voraus gut unterrichtet. In seiner Kühnheit hatte er sich auch mehrmals selbst in die Höhle des Löwen gewagt, um an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen. Allerlei geschickte Verkleidungen ermöglichten es ihm, ungefährdet und unerkannt in die Stadt zu gelangen und aus ihr wieder zu entweichen. Verrat von der Seite seiner Spießgesellen in Goslar brauchte er nicht zu fürchten, denn im Falle der Entdeckung war ihr eigener Kopf auch verwirkt.
[S. 167]
Um Magda Richerdes, die Ehefrau des Bergherren, stand es nicht gut. Auf eine geringfügige Besserung, kurz nach Vennes Verlobung, folgte bald eine Verschlimmerung ihres Zustandes. Der Arzt war ratlos, die Familie nicht weniger. Venne ging mit verweintem Gesicht einher; auch der Zuspruch ihres Verlobten vermochte sie nicht über die Angst und Sorge um das Leben der Mutter wegzubringen.
Die Kunst der Ärzte jener Zeit stand nicht hoch. Soweit sie sich über den Rahmen bloßer Scharlatanerie erhob, reichte sie doch nicht im geringsten aus, um durch eine von Sachkenntnis getragene Diagnose und die danach anzusetzenden Mittel eine Krankheit zu bekämpfen, deren Wesen nicht durch äußere Merkmale sich von selbst verriet.
Die Reinigung des Blutes durch Purganzen aller Art galt als Mittel zur Verhütung von Krankheiten, wie zur Erhaltung der Gesundheit. Schlimm wurde es erst, wenn der Aberglaube im Verein mit der Dummheit auf der Seite der Kranken diese einem der dunklen Kurpfuscher in die Hände gab, die mit albernen Beschwörungsformeln und Mitteln aus pflanzlichen und anderen Stoffen heilen wollten, deren Wirkung auf den Körper des Menschen durchaus nicht feststand.
Überall im Lande saßen die Männer und Frauen, die auf die Unerfahrenheit und die Angst um die Erhaltung des Lebens ihrer Nächsten spekulierten und ein Wissen ärztlicher[S. 168] Art vortäuschten, das günstigstenfalls nichts nützte, oft aber die vielleicht noch heilbare Krankheit in lebenslängliches Siechtum verwandelte oder gar den Tod herbeiführte. Der Scharfrichter, die Schäfer, alte Weiber üblen Rufes, denen man Umgang mit dem Bösen, auch übernatürliches Wissen nachsagte, das waren die am meisten begehrten Berater der Kranken jener Zeit.
Auch in Goslar gab es solche »Wissende«, und zu ihnen zählte die Gittermannsche in der Fröweckenstraße, wie auch der Schäfer Hennecke Rennenstich auf dem Ymminghove. Ihre Kunst und ihr Wissen gründeten sich auf überkommene Sprüche und Tränke aller Art, zu denen sie die Kräuter selbst suchten oder sich zu verschaffen wußten. Ihre Hauptberaterin und Lieferantin war Luke Meyse vom Steimkerbach, die einstmals von Goslar einen wenig befriedigenden Abschied nehmen mußte.
Die Zeit hatte die Beziehungen zwischen ihr und der Gittermannschen nie ganz zerstört, und die geheimen Boten, welche Goslar von Zeit zu Zeit im Auftrage Hermann Raßlers aufsuchten, sorgten dafür, daß die Fäden zwischen diesen beiden würdigen Frauenzimmern und Freundinnen nicht zerrissen. Sie überbrachten auch jeweils Mittel, die von der Gittermannschen bei ihren Gewaltkuren benutzt wurden.
Venne wie den Vater bedrückte es über die Maßen, daß der Mutter nicht geholfen werden konnte, und als der Arzt seine Ohnmacht erklärte, waren sie bereit, wenigstens Venne, auch andere Mittel zu nehmen, wenn es hülfe. Zunächst wurde Immecke Rosenhagen zu Rate gezogen, von deren heilkundiger Hand sie von den Hardts gehört hatten. Immecke kam, besah sich die Kranke, gab auch einige schmerzlindernde Mittel an, gestand aber im übrigen, daß sie des[S. 169] Leidens nicht Herr werden könne. Da verfiel die alte Katharina, die nächst Venne ihrer Herrin über alles zugetan war, auf den Plan, die Gittermannsche zu befragen, die ihr von guten Bekannten empfohlen wurde.
Katharina mußte die Art der Krankheit genau beschreiben, doch erklärte jene, es sei äußerst wichtig, daß sie die Kranke selbst sehe und spreche. Da wurde die treue Alte vor dem eigenen Mut bange, denn sie handelte ja ohne Ermächtigung ihrer Frauen. Doch die Liebe zu diesen und der brennende Wunsch, der Kranken Heilung zu verschaffen, überwog zuletzt die Bedenken. Was sie aber selbst noch an Mißtrauen gegen die geheimnisvolle Frau hegte, verscheuchte sie durch die drohenden Worte: »Das sage ich Euch, Gittermannsche, tut Ihr meiner Frau ein Leid an, so habt Ihr es mit mir zu tun, und mit mir ist nicht zu spaßen.«
Jene antwortete nur mit einem überlegenen Lächeln, als ob ihre Kunst für sie außer Zweifel stehe.
Venne schalt die alte Magd tüchtig, als sie von dem Besuche hörte, und die Kranke weigerte sich, mit der Frau in Berührung gebracht zu werden, die doch eine Hexe sei. Aber das Leiden wurde schlimmer, und Katharina kam hartnäckig immer wieder auf die Sache zurück. Schließlich gaben die beiden nach, und man einigte sich, daß zunächst Venne mit der Getreuen — im Dunkel des Abends natürlich — die Gittermannsche aufsuchen solle.
Die alte Vettel war von einer überraschenden Liebenswürdigkeit, denn ihr lag viel daran, in dem angesehenen Hause Zutritt zu erhalten. Auf Venne wirkte indes gerade diese Art widerlich und abstoßend, aber sie bezwang ihren Abscheu, um der Mutter zu helfen. Mit großer Zungenfertigkeit pries die Gittermannsche ihre Kunst und zählte[S. 170] tausend Mittel und Sprüche auf, die unfehlbar, schnell oder langsam helfen müßten.
Venne wirbelte der Kopf von all dem Gehörten, aber sie gewann doch die Hoffnung, daß das Weib vielleicht die Heilung in der Hand habe. Es wurde also verabredet, daß sie auf besondere Botschaft hin kommen solle. Nun galt es noch, der Mutter endgültige Zustimmung zu erlangen. Der Vater wurde nicht ins Vertrauen gezogen; man hoffte es so einrichten zu können, daß er nichts von dem Besuche erfuhr. Später, wenn, wie Venne hoffte, eine Besserung eingetreten war, sollte auch er davon hören.
Als die Gittermannsche an dem verabredeten Abend vorkam, hätte Venne ihre Zusage am liebsten zurückgenommen, denn sie sah hier in der sauberen Wohnung fast noch unheimlicher und schmutziger aus als in ihrer Behausung. Die Mutter tat ihr doppelt leid, die sich von diesem Geschöpf behorchen und befühlen lassen mußte. Aber die ließ alles so teilnahmslos über sich ergehen, daß sie die Einzelheiten gar nicht wahrzunehmen schien.
Als die Megäre mit der Untersuchung fertig war, sann sie nach, wobei sie den schmutzigbraunen Finger an die Nase legte. Venne sah ihr angstvoll zu, als ob ihr eigenes Leben von dem Ausspruch abhänge. Dann kramte jene ihre Weisheit aus.
»Der Fall liegt schwer; doch ich hoffe, das Übel mit der Wurzel zu fassen. Habt Ihr, Frau, etwa böse Neider oder eine Feindin, die Euch das Übel angetan hat? Denn ohne Zweifel seid Ihr versehen worden.«
Frau Richerdes antwortete, sie sei sich nicht bewußt, sich jemandes Feindschaft zugezogen zu haben, auch wisse sie keinen Menschen, dem sie so Böses zutrauen könnte. Da[S. 171] legte sich aber Katharina ins Wort. »Ihr vergaßet das Zigeunermensch, das wir damals fortjagten, weil die Frau, als sie, Euch wahrzusagen, sich in die Stube gedrängt hatte, es verstand, sich ein seidenes Tuch anzueignen, das in ihrer Nähe lag. Ihr waret gutmütig genug, sie straflos laufen zu lassen. Aber ich erinnere mich noch genau des bösen Blickes, den sie auf Euch warf, und geheime Worte murmelte sie auch im Weggehen.«
»Dacht' ich mir's doch,« sagte die Gittermannsche. »Die Zigeunerinnen verstehen sich besonders auf die Kunst des bösen Blickes, und einen Zauberspruch wird sie Euch auch noch auf den Hals geschickt haben, ohne daß Ihr es merktet. Da werden wir es gleich mit kräftigen Mitteln versuchen müssen, um der Sache Herr zu werden. Und es soll mit dem Teufel zugehen, wenn es uns nicht gelingt.«
Bei dem Worte ›Teufel‹ fuhren die Frauen zusammen, und die ängstliche Katharina erklärte energisch: »Wir sind gute Christen und wollen mit dem Gottseibeiuns nichts zu tun haben.«
»Ach, geht mir mit Euren Einwänden,« entgegnete die Gittermannsche. »Meint Ihr, ich habe mit dem Teufel zu tun oder will Euch ihm verschreiben? Aber was von ihm kommt, muß zu ihm zurück. Das werdet Ihr doch auch wohl gelten lassen, oder wollt Ihr's für Euch behalten? Ich werde Euch eine Brühe kochen, mit der Ihr Eure Schwelle besprengt. Daneben reibt Ihr der Kranken die Herzgrube mit der Salbe, die Ihr gleichfalls bekommen sollt. Die Salbe ist wunderlich zusammengesetzt, und ihr Geheimnis behalte ich für mich. Die Brühe aber mögt Ihr selbst kochen; also wisset, wie man's macht.
Kauft in Gottes Namen eine Muskatnuß, ohne um den[S. 172] Preis zu feilschen, schneidet sie durch und zerstoßt sie mit Buchenasche, die im Sommer gewonnen ist. Kocht das Ganze in einem Eimer fließenden Wassers und gießet es an einem Donnerstag in Gottes Namen auf Eure Schwelle, indem Ihr also sprecht:
›Dat et nu vorgae unde dem duvel nicht bestae. Im Namen des vaders unde des sones unde des hilghen gheistes.‹ Handelt genau nach meiner Vorschrift und wartet die Wirkung ab.«
Eine Belohnung wollte die Gittermannsche nicht nehmen, nein, es war ihr nur um die christliche Barmherzigkeit zu tun, und sie freue sich, einer so ansehnlichen Frau zu helfen. Katharina aber sorgte dafür, daß ihre Schürze in der Küche mit allen möglichen nützlichen und schönen Sachen gefüllt wurde.
So gewann die Gittermannsche Zutritt und Einfluß im Hause Richerdes. Hätte die gute Katharina geahnt, welchem Unheil sie damit die Tür öffnete, sie hätte jene nicht gerufen, selbst nicht um den Preis der Wiederherstellung ihrer Frau.
[S. 173]
Auf dem Vater Vennes lasteten noch mehr Sorgen als die Krankheit der Frau. Was er damals dem Ratsherrn Achtermann zugesagt hatte, war in Verhandlungen mit dem Rate der Stadt herangereift. Richerdes wollte sein Grubenrecht um zweitausend Mark lötigen Silbers abtreten. Es handelte sich noch darum, die genaue Abgrenzung seiner Gerechtsame im Berge markscheiderisch festzulegen. Solange ging der Betrieb auf seine Kosten weiter.
Er konnte sich nicht verhehlen, daß der Ertrag immer geringer und zweifelhafter wurde, und es fiel ihm schwerer und schwerer, die Löhne und Gelder für Grubenholz aufzubringen. Der Silvane Bandelow, der ihm so viel von Freundschaft und nachbarlicher Gesinnung vorgeredet hatte, drohte mit der Einstellung der Holzlieferungen. Die Verhandlungen mit dem Rat kamen ihm dabei als Ausrede sehr gelegen. »Er habe ja abgeredet, zu verkaufen; ja, wenn Richerdes das Werk weiterbehalten wolle, aber so ...« Es mußte also Geld beschafft werden. Die Bekannten zeigten sich nicht geneigt, zu helfen; auch Achtermann gab unter allerhand Ausreden nichts her. Da blieb kein anderer Weg offen, als sich an die gewerbsmäßigen Herleiher zu wenden, wenn es auch vielleicht unchristliche Zinsen kostete.
Der Zuzug der Juden nach Goslar wurde von dem Rat immer von Fall zu Fall und mit zweckdienlicher Zurückhaltung geregelt. Er hatte sich dabei bislang immer durchaus als ein guter Geschäftsmann gezeigt, der eine Leistung[S. 174] nicht tut ohne Gegenleistung. Das bedeutet für die vielgejagten und verfolgten Kinder Israels nichts anderes, als daß sie zahlen und nochmals zahlen mußten, um die Erlaubnis zur Ansiedlung zu erlangen. Und da der Kaiser auch für seinen Schutz noch eine besondere Steuer ihnen auferlegte, so ergab sich für diese Schutzjuden des Rates und des Kaisers die Pflicht, zu zahlen und zu zahlen, um nur ein Obdach zu haben. Was Wunder also, daß sie daraus für sich die Erlaubnis ableiteten, zu nehmen, wo sich's ihnen bot, das heißt, ihren christlichen Mitmenschen ihre Hilfe in Form von Darlehen um Zinsen zu gewähren, bei denen jenen leicht der Atem ausgehen konnte.
Das Ghetto der goslarschen Juden war die Hokenstraße. Dort hausten sie zusammen, so viele oder so wenige ihrer in der großen Reichsstadt wohnten, gemieden von den Einwohnern, nur sich selbst lebend und ihren Geschäften. Verirrte sich ein Christ in diese enge, dunkle Straße, so geschah es sicher nur, um die Hilfe der Hebräer in Geldsachen in Anspruch zu nehmen.
Es war dem ehrenfesten, angesehenen Bürger und Bergherrn Richerdes ein hartes Angehen, den Weg zu dem Juden Asser anzutreten. Dieser wohnte mit seinem Weibe Lusse in einem dunklen Hause nach dem Fleischscharren zu.
Er trat dem ernsten Mann, der da in der Dämmerung ins Haus trat, mit all der unterwürfigen Geschmeidigkeit entgegen, die den Leuten seines Stammes eignet im Verkehr mit anderen, vor deren Stellung und Person sie sich noch eine Förderung oder Schädigung ihrer Interessen versehen.
Auf dem Untergrunde seiner lebhaften, dunklen Augen glomm ein Schimmer wilder Freude, daß wieder einer der Andersgläubigen den Weg zu ihm, dem Verachteten, Geschmähten,[S. 175] fand in seiner Not und daß er auch in dessen Schicksal werde eingreifen können, um, wenn die Stunde gekommen war, den Anteil seiner Rache an dem verfluchten Christenvolk zu üben, zu der die ein Leben lang getragene Schmach und der durch Jahrhunderte vererbte Wunsch, den unauslöschlichen Haß zu löschen, trieben. Über die mißliche Lage seines Gegenübers, den er mit vollendeter Höflichkeit auf den Ehrenplatz nötigte, war er längst unterrichtet.
Asser — die Juden hatten zu jener Zeit noch nicht das Recht, sich andere Namen zuzulegen — hörte den Bergherrn ruhig an. Nur das nicht bezwungene Spiel seiner Augen verriet, daß er bei der Sache war. Richerdes schloß fast barsch: »Also, Jude, willst Du mir Geld leihen oder nicht? — Daß es Dein Schade nicht sein wird, weißt Du selbst am besten.«
Auf einmal war Asser ganz zurückhaltender, kühler Geschäftsmann, wenn er auch in seinen Worten der geschmeidige, unterwürfige Jude blieb.
»Herr, es ist mir eine große Ehre, die Ihr mir Unwürdigem wollt antun; aber ich fürchte, ich werde Euch müssen enttäuschen. Jahve hat meiner Hände Arbeit gesegnet, das ist wahr. Aber was Euch erzählt haben andere Menschen von meinem Reichtum, ist Fabel. Gott der Gerechte soll mich strafen an meinem Samen, wenn ich habe in Besitz, was Ihr begehrt. Ihr wißt, daß der Hohe Rat, daß der Herr Kaiser in Wien haben auferlegt den armen Juden, große, schwere Lasten zu tragen, als wie will heißen, daß wir müssen zahlen große Summen, nur daß wir dürfen wohnen an solchem Ort wie Goslar. Wie soll ich da kommen zu Geld, um es zu geben Ew. Edelgeboren!
Auch ist mir bekannt, wie ich habe gehört, daß Eure Sach'[S. 176] nicht stehet zum besten, daß Euer Bergwerk nicht mehr lohnt die Kosten. Wie heißt da Geschäft, wenn nichts ist da, als womit man kann sich assekurieren gegen Verlust?«
Richerdes schwoll die Ader über dieses Wort, die seine Zahlungsfähigkeit in Frage stellte.
»Glaubst Du, verfluchter Jude, ich wäre zu Dir gekommen, um Dich zu betrügen?«
»Gott soll mich bewahren, daß ich sollte haben solch schwarzen Gedanken,« antwortete der andere geschmeidig, »aber man wird doch dürfen sprechen vom Für und Wider, wenn es sich handelt um ein Geschäft. So muß handeln ein ehrlicher Jud, der ich bin gewesen all mein Leben lang, und so wird sprechen jeder Kaufmann, der etwas versteht vom Geschäft. Mag sein, daß man mir hat geschildert viel zu schwarz Eure Lage, aber ich muß rechnen, was spricht dafür und was spricht dagegen.
Doch ich will Euch helfen, beim Gotte Abrahams, was steht in meinen Kräften. Wieviel wollt Ihr haben? Vielleicht, daß ich bringe zusammen das Geld von Freunden unter unseren Leuten. Doch müßt Ihr Euch begnügen mit weniger. Was wünschtet Ihr doch zu haben, günstiger Herr, daß ich's noch mal höre?«
»Hundert Mark Silber«, entgegnete Richerdes kurz, doch etwas besänftigt.
»Hundert Mark«, klagte der Jude. »Wo sollte ich hernehmen hundert Mark! Sagen wir fünfzig, fünfzig Mark. Das ist eine ansehnliche, glatte Summe, mit der Ihr werdet wirtschaften, bis daß es Euch geht besser oder Ihr habt Euer Geld vom Hochweisen Rat.«
»Was weißt Du, Jude, von meinen Verhandlungen mit dem Rat?« fragte der Bergherr unangenehm überrascht.[S. 177] »Nun nichts für ungut, Ew. Gnaden«, wandte Asser demütig ein. »Aber man hört ja dies und jenes; es braucht ja nicht immer zu sein wahr, aber man weiß doch gern, was geht vor sich.«
»Also, dann her mit dem Geld«, begehrte Richerdes barsch.
»Gott der Gerechte,« jammerte da der Jude, »wie soll ich kommen zu so grausam viel Geld, und wenn ich wollte kehren um mein Haus vom Dach bis zum Keller. Ich muß es mühselig mir selbst borgen zusammen. Kommt also morgen oder übermorgen, es abzuholen. Und, daß es nicht werde vergessen, der Ordnung halber, bringt auch gleich mit das Geschriebene, daß ich mag ruhig schlafen.«
»Es ist gut, Asser, ich werde morgen hier sein. Halte das Geld bereit, der Pfandschein soll Dir nicht fehlen.«
Auch das Geld des Schutzjuden Asser vermochte den Lauf der Dinge nicht aufzuhalten. Das Erzlager in der Richerdesschen Grube lief immer spitzer zu, und es war der Tag abzusehen, wo sie gänzlich zum Erliegen kommen würde.
Mit dem geliehenen Gelde konnte der Bergherr noch einige verzweifelte Versuche machen, durch Seitenschläge eine andere Erzader zu erschließen; doch auch diese Anstrengungen verliefen erfolglos. Nun drängte Richerdes selbst darauf, daß der Rat den Ankauf vollziehe, aber die Ratsherren waren auch über die Sachlage unterrichtet und trugen Bedenken, ein so unvorteilhaftes Geschäft für die Stadt abzuschließen. Vergeblich wies Richerdes darauf hin, daß der Verkauf ohne Vorbehalt hätte abgeschlossen werden[S. 178] sollen; vergebens auch bemühte er sich, darzutun, daß in vielen anderen Fällen schon neben einem sich totlaufenden Lager eine neue Ader gefunden sei, daß mindestens Aussicht bestehe, auf einer tieferen Sohle zu finden, was auf der jetzigen abgebaut sei; die Herren blieben bei ihrer Ansicht bestehen, daß der Vertrag noch nicht abgeschlossen sei und also die daraus für Richerdes erwachsenden Vorteile nicht gewährt zu werden brauchten.
Was der Ratsherr Heinrich Achtermann ihm früher als drohendes Gespenst vorgehalten hatte, um ihn zu einem Verkauf gefügig zu machen, das trat jetzt trotz seiner Nachgiebigkeit ein: Richerdes, der angesehene Bürger und Montane, war ruiniert, zahlungsunfähig.
Das lauteste Geschrei erhob der Schutzjude Asser, der sich um sein Geld sorgte. Jetzt, wo er glaubte, keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen auf den einst angesehenen Bürger und Christen, zeigte sich der ganze aufgespeicherte Haß seines Volkes. Er raufte sich das Haar, nannte sich den unglücklichsten aller Söhne Abrahams und schimpfte seinen Schuldner einen abgefeimten Spitzbuben und Betrüger. Diese Tonart wurde ihm allerdings bald verleidet durch eine Buße von mehreren Mark Silber, die der Rat über ihn verhängte wegen Kränkung eines Christen und bis dahin unbescholtenen Bürgers.
Er erhielt auch sein Geld, und zwar zahlte ihn der Ratsherr Heinrich Achtermann aus. Das geschah allerdings nicht aus christlicher Barmherzigkeit; er tat es auch nicht der nahen verwandtschaftlichen Beziehungen wegen, die durch das Verlöbnis nach der Anschauung jener Zeit als damit bestehend angesehen wurden. Er zahlte, weil er nicht wollte, daß der Vater der mit seinem Sohne verlobten Tochter in den[S. 179] Schuldturm wandere. Über die weitere Entwicklung der Dinge war er sich für seine Person völlig im klaren. Im übrigen sicherte er sich gegen Verlust durch ein Pfand auf das Anwesen des Bergherren.
Richerdes war durch das Unglück völlig niedergebrochen. In diesen Tagen, da das Unheil wie eine schwere Wolke über dem Hause in der Bergstraße lastete, zeigte sich Venne als eine wahre Heldin. Sie suchte den Vater aufzurichten, und sie pflegte die Mutter, deren Zustand sich infolge der Aufregungen immer mehr verschlimmerte.
Venne hatte niemand, um ihm ihr übervolles Herz auszuschütten, als die alte Vertraute ihrer Kindheit, die brave Katharina. Noch einmal wurde die Gittermannsche zu Rate gezogen, noch einmal versuchte es diese mit einer neuen Salbe, einem neuen kräftigen Spruch; aber das Ende war nicht aufzuhalten. Als die Blätter im lustigen Todestanze zur Erde wirbelten, schloß auch diese müde Erdenpilgerin die Augen für immer. Und es war zu erkennen, daß der Vater, an dem die Schmach der unschuldig erlittenen Verarmung und Erniedrigung zehrten, sie nicht lange überleben würde.
Auch die tapfere Venne drohte dem ungleichen Kampfe mit dem widrigen Schicksal, in dem sie allein auf dem Plan stand, zu unterliegen. Die einzige Wohltat, die ihr in dieser Zeit widerfuhr, war die treue Freundschaft, welche ihr von den Hardts entgegengebracht wurde.
Auch Immecke Rosenhagen bewies in diesen Tagen der Not, daß sie zur Stelle sei, wenn man sie brauchen konnte. Sie hatte längst erkannt, daß der Mutter nicht zu helfen war. Sie half mit einem stärkenden Trank, mit einer schmerzstillenden Salbe. Was die Gittermannsche anpries,[S. 180] war in ihren Augen und nach ihren Worten Schwindel. Sie redete den Frauen auch ab, sich mit der Person einzulassen, da man daraus Unannehmlichkeiten haben könne. Wenn Venne gegen ihren Rat handelte, so geschah es aus dem heißen Wunsche heraus, das teure, schwindende Leben so lange festzuhalten, wie sie konnte.
Und wo blieb Heinrich Achtermann, der Verlobte Vennes?
Seine Liebe war nicht geschwunden. Der Schmerz, der über dem süßen Antlitz Vennes lagerte, je trostloser der Zustand der Mutter wurde, machte sie ihm noch begehrenswerter. Doch die Pflege der Mutter nahm sie so in Anspruch, daß sie nur selten Gelegenheit fand, ihn zu sprechen. In heißem Mitleid schloß er sie dann in die Arme.
»Mein armes Herz, was kann ich nur tun, um Dir die Last tragen zu helfen, die Dich erdrücken muß? Laß mir doch den mir gebührenden Anteil an Deinem Leid. Du weißt, geteilter Schmerz ist halber Schmerz.«
Venne lächelte ihm dankbar unter Tränen zu. »Du kannst mir nicht helfen, jetzt noch nicht. Wer weiß, ob es nicht noch schlimmer kommt. Versprich mir nur das eine, daß Du mich nie verlassen wirst.«
»Deine Worte verdienen eigentlich Strafe,« zürnte Heinrich. »Hältst Du mich für einen solchen Schurken, daß ich Dich im Unglück aufgeben könnte?«
Beseligt nickte Venne ihm zu: Nein, sie war beruhigt, Heinrich Achtermann war einer solchen Sünde wider göttliches und menschliches Recht nicht fähig!
Der junge Achtermann, dem die Ratsherrnwürde in der Reichsstadt Goslar so sicher zufallen mußte wie das Erbe seines Vaters, war von der Aufrichtigkeit seiner Worte selbst völlig durchdrungen. Er liebte Venne mit all der Innigkeit[S. 181] und Glut, mit der er zuerst die Holde an sein Herz gezogen hatte. Wer ihm gesagt hätte, er werde die Braut verlassen, den würde er als persönlichen Feind behandelt haben. Aber er konnte nicht hindern, daß der Vermögensverfall des Vaters seiner Venne auch ihn in seine Kreise zog. Es fanden sich gute Freunde, die ihm unter dem Mantel teilnehmender Worte das Gift ihres Hohnes einträufelten. Manche vermeintliche oder wirkliche Kränkung, die ihnen von Venne in der harmlosen Sieghaftigkeit ihrer jugendlichen Anmut unbewußt zugefügt war, manche Zurücksetzung, die ihretwegen neidische Freundinnen erfahren hatten, fanden jetzt Gelegenheit zu unschöner Vergeltung.
Heinrich Achtermann widerstand tapfer; er wies alle Andeutungen, daß er Venne aufgeben müsse, entrüstet zurück. Aber der Stachel blieb doch sitzen, und die Überlegung in den stillen Stunden der Nacht konnte jenen nicht unbedingt unrecht geben: Hatten sie nicht recht, war es nicht eine sehr zweifelhafte Sache, die Tochter eines verarmten Mannes zu freien, welcher der schimpflichen Schuldhaft nur durch die Hilfe des Vaters entgangen war? Und würde es je gelingen, die Lästermäuler zum Schweigen zu bringen? — alles Gedanken, deren Gewicht er nicht verkannte. Ein gewichtiger Helfer aber erwuchs denen, die aus Bosheit oder Rachsucht das Band zwischen ihm und Venne Richerdes zu zerreißen suchten, im Vater.
Der Ratsherr Heinrich Achtermann hatte selbst den Freiwerber für seinen Sohn gemacht, so hätte ihm Richerdes entgegenhalten können. Er zeigte sich der Vereinigung geneigt, denn die hübsche Venne tat es auch ihm mit ihrem Liebreiz an. Zwar war der Bergherr kein reicher Mann, aber das brauchte bei der eigenen Vermögenslage kein[S. 182] Hindernis zu sein. An Ansehen standen ihm die Richerdes nicht nach; auch ihre Familie hatte der Stadt mehr als einen Ratsherrn und Bürgermeister gegeben.
Das alles änderte sich indes, als der angehende Schwäher ein armer Mann wurde mit all den unglückseligen Begleitumständen, die wir kennen. Wandte er auch mit eigenem Gelde das Schlimmste von jenem ab, so kam der Montane als Verwandter für ihn nicht mehr in Betracht. Sein Patrizierstolz hätte es nie verwunden, daß man hinter der Schwiegertochter, wenn auch im geheimen, herzischelte als der Tochter eines fallit gewordenen Bürgers.
Achtermann hoffte, daß der Sohn selbst so viel Einsicht haben werde, das Band zu lösen; er, der Vater, wäre dann wohl auch noch zu besonderen Opfern bereit gewesen, um die Angelegenheit möglichst geräuschlos zu regeln. Als er aber zum ersten Male mit Heinrich darüber sprach, brauste dieser auf und erklärte, er werde nun und nimmer die Braut im Stich lassen. Der Vater ließ ihn ruhig reden, in der Überzeugung, daß der Überschwang seiner Gefühle sich unter dem Einfluß der Zeit schon ausgleichen werde.
Es war dem Sohne, als ob die kühlen Worte des Vaters, der die Sache wie ein Geschäft behandelte, Venne selbst in ihrer Abwesenheit träfen, und er suchte noch am selben Abend Gelegenheit, die Geliebte seiner unwandelbaren Treue zu versichern. Er fand sie nicht, denn der Zustand des Vaters — die Mutter hatte man wenige Wochen vorher zu Grabe getragen — erschien ihr gerade an diesem Abend besonders besorgniserregend. Heinrich ging davon, etwas verstimmt, daß seine gute Absicht nicht zur Ausführung kam.
Auch Venne selbst war die Sorge gekommen, ob die[S. 183] Vereinigung mit dem Geliebten werde zustande kommen; denn auch ihr blieben natürlich die Demütigungen nicht erspart und versteckte Anspielungen, es sei ihre Pflicht, den Ratsherrnsohn freizugeben. Es tauchte ihr auch wohl selbst der Gedanke auf, das Opfer nicht anzunehmen, und herber Trotz gegen alle Welt, auch gegen den Geliebten, ließ sie mit dem Gedanken spielen, Verzicht zu leisten. Aber dann quoll die Angst um so heißer in ihr auf und die Sehnsucht nach dem Geliebten.
In diesem Widerspruch der Empfindungen traf sie eine Botschaft des alten Achtermann ins Herz, der ihr zuraunen ließ, sie möge den Sohn freigeben, er werde sich die Sorge um ihre Zukunft angelegen sein lassen. Das wirkte wie ein Schlag ins Gesicht auf die stolze Venne. In ungebändigtem Trotz ließ sie dem Ratsherrn sagen, sie werde sich dem Sohn nicht an den Hals werfen; das Anerbieten aber, für sie sorgen zu wollen, weise sie als eine besondere Kränkung zurück. Der Alte ließ sich dadurch nicht beirren, »Mädchenüberschwang«, dachte er. »Das wird sich schon zurechtgeben.«
Heinrich, der Sohn, wußte von dem Vorgehen des Vaters nichts. Er versuchte mehrmals die Geliebte zu sprechen, erfuhr aber durch Katharina jedesmal eine mehr oder weniger mürrische Abweisung. Da setzte er es einmal doch durch, daß er vorgelassen wurde. Venne empfing ihn mit verweinten Augen. Auf seine Frage, was ihr sei, hielt sie zunächst zurück. Doch dann durchbrach das aufgehäufte Weh und der Zorn über die Demütigung die Schranken, und sie klagte mit bitteren Worten den Vater an. Heinrich war erschrocken und empört, und er bat Venne, ihm zu vertrauen.
[S. 184]
»Ich schwöre Dir bei allem, was mir heilig ist, daß ich von dieser Niedertracht nichts weiß und nichts ahnte. Glaube mir doch, Geliebte, ich stehe zu Dir, und wenn sich alles gegen Dich vereint.«
Mit heißen Küssen besiegelte er seine Schwüre, und in Venne stieg ein Gefühl des Glückes auf, blieb ihr doch wenigstens dies Allerschwerste erspart!
Zu Hause stellte Heinrich den Vater zur Rede. Der Ratsherr leugnete gar nicht, daß er wirklich die Botschaft geschickt habe.
»Wenn die Kinder die Vernunft verlieren, müssen die Eltern für sie denken und handeln.«
Heinrich begehrte auf und erklärte, daß er nie und nimmer von Venne lassen werde, der Vater blieb ganz kühl und ruhig.
»Vorläufig ist es bei uns noch Sitte und Gesetz, daß die Eltern bestimmen, was aus ihren Kindern werden soll, und ich lasse mir dieses Recht nicht schmälern.«
»Und doch wirst Du mich nicht zwingen. Zuletzt steht mir der Weg in die Welt offen, und ich werde mit Venne davongehen«, antwortete Heinrich um so erregter. Da lachte der Vater spöttisch auf: »Das gäbe eine nette Wandergesellschaft: Du ein Junker Habenichts und sie eine Jungfer Bettlerin. Da werdet Ihr Euch allabendlich Euer Nest am Straßenrain bereiten müssen. Aber wir wollen das Thema heute abbrechen, es führt im Augenblick doch zu nichts.« — Er wußte, daß die Zeit für ihn arbeiten werde.
[S. 185]
Das Leben des Bergherrn Richerdes war seit dem Hinscheiden seiner Frau nur noch ein langsames Sich-zu-Tode-Quälen. Der schon in gesunden Tagen hagere, große Mann war abgemagert zum Skelett. In gelblichen Falten lagerte die Haut auf dem Gesicht, aus dem die spitze Nase drohend hervorragte. Neuerdings litt er an Verfolgungsideen, in denen der Jude Asser, Achtermann und Karsten Balder die Schreckgestalten waren. Er weigerte sich, Nahrung zu nehmen, weil er seine Schulden nicht vermehren wolle; dann wieder hielt ihn der Argwohn davon ab, seine Feinde könnten Gift hineingetan haben. Die arme, tapfere Venne durchlebte eine Zeit schlimmsten Martyriums. Endlich, ein halbes Jahr fast nach dem Heimgange der Frau, glitt auch ihm der Pilgerstab aus den müden Händen. In seinen letzten, lichten Augenblicken mahnte er noch Venne, sie solle sein Recht dem Rat gegenüber nie vergessen. »Bedenke, mein Kind, daß Du es meinem Andenken schuldig bist, dieses Recht zu verfechten. Versprich es mir in die Hand, es nie aufzugeben, damit ich ruhig sterben kann.«
Nun war Venne ganz allein in ihrer Trostlosigkeit und dem Bewußtsein, daß sie aus dem Kreise aller derer ausscheide, bei denen sie bis zu dem Unglück ihres Vaters ein gern gesehener und umworbener Gast gewesen.
Das alles hätte sie noch ertragen, wäre nicht die Angst und die quälende, beschämende Sorge gewesen, daß auch Heinrich, der Verlobte, ihr entgleite. Noch halten ihn seine[S. 186] Schwüre, noch kommt er, sie zu sehen, noch ist er voller Liebe und Mitleid. Sie trinkt seine Küsse wie eine Verdürstende, wenn er sie umschließt, und hängt an seinem Munde, um von ihm immer wieder zu hören, daß er sie noch liebe. Begütigend, tröstend, voll zarter Teilnahme streicht er über ihr Haar und versichert sie seiner Treue. Und immer wieder drängt es sich aus ihrem Munde: »Verlaß mich nicht, bleibe mir treu!«
Und er schwört ihr mit neuem, heiligem Schwur, daß nichts sie trennen soll, nicht der Vater, nicht die hämische, neidige Welt. Dann seufzt sie glücklich, wie aus tiefster Seele befreit, auf, und sie schwört ihm und sich selbst zu, Vertrauen zu haben. Aber kamen dann die dunklen Stunden der Nacht, lag sie schlaflos auf ihrem Lager, dann stürzten sich die Zweifel wie gierige Wölfe auf sie und zermarterten ihr armes Herz.
Seit dem Tode des Vaters hauste sie allein mit Katharina in dem großen, leeren Hause. Die Mägde waren entlassen, die Knechte gegangen. Sie fürchtete sich und hatte die alte Magd gebeten, bei ihr zu schlafen. Katharina hörte, wie die von ihr über alles geliebte Herrin sich ruhelos auf ihrem Lager wälzte, sie vernahm ihre Seufzer und ihr stilles Schluchzen. Sie wäre für Venne in den Tod gegangen, hätte sie ihr damit das Glück erkaufen können. Verzweifelt drängte sie in Venne, ihr zu sagen, was sie bedrücke, Venne schwieg.
»Ist Heinrich Achtermann auch von Dir abgefallen?« fragte sie mit verbissenem Grimm.
»Nein, nein, er ist mir treu und wird mich nicht verlassen, wenn man ihn nicht dazu zwingt.«
»Wie soll man ihn zwingen, wenn er selbst nicht will?[S. 187] Oder meinst Du, man könne ihm im geheimen Zwang antun?«
Venne antwortete nicht darauf, aber Katharina schloß daraus, daß diese Befürchtung zutreffe.
»So wird man unsererseits darauf sehen müssen, daß er nicht von Dir lassen kann«, murmelte sie für sich. Und es ward ihr zur fixen Idee, daß sie alles daransetzen müßte, um Heinrich bei ihrer Venne zu halten. Dieser durfte sie von ihren Plänen nichts sagen, Venne würde es ihr verbieten; aber sie wußte, was sie zu tun hatte. Klang ihr nicht ein Wort der Gittermannschen in den Ohren: »Ich habe auch Mittel anderer Art zu Gebote; gilt es zum Beispiel den ungetreuen Liebsten zurückzubringen oder einen, den man begehrt, an sich zu fesseln, so ist die Gittermannsche da mit ihrem Spruche.«
Damals belächelte Katharina diese Anpreisung ihrer Kunst, sie, wie Venne: Wie sollte sich für diese je die Notwendigkeit bieten, von der Gittermannschen dunkler Kunst Gebrauch zu machen, da doch Venne auf dem Gipfel der Glückseligkeit zu stehen und ein Sturz von dieser Höhe unmöglich schien.
Jetzt aber war es so weit, und sie suchte die verrufene Alte aufs neue auf. Zunächst sperrte sie sich und redete von Undank und Gefahr, in die man sie bringe, denn die alte Katharina hatte ihr, als ihre Mittel sich bei Frau Richerdes doch nicht bewährten, mit drastischen Worten ihre Meinung gesagt. Als sie indes vor den Augen der habgierigen Hexe ein Stück Geld glänzen ließ, änderte sich Wort und Miene der Gekränkten. Man verabredete die Einzelheiten.
Natürlich müsse sie den Namen desjenigen wissen, dem[S. 188] das Mittel gelte. Ungern nannte Katharina den Namen Heinrich Achtermanns, aber die Gittermannsche bestand darauf.
»Dachte ich's mir doch«, höhnte die Alte. »Solange das Täubchen im Glück saß und sein Gefieder goldig schimmerte, war das Herrlein begeistert; nun, da der Glanz erblichen ist, tritt er den Rückzug an.«
»Ihr tut ihm vielleicht unrecht«, warf Katharina ein. »Nach dem, was meine Venne meint, ist es vielmehr der Vater, der sie trennen will.«
»Natürlich, der dickgeschwollene Protz fürchtet, daß sein Geldsack eine Falte bekommt, wenn er dem armen Mädchen beisteht. Doch zum Glück sind wir noch da, wir, die Gittermannsche, und wir wollen es ihm schon zeigen. Also, die Sache ist so: was ich Euch geben werde, muß Eure Venne dem Liebsten heimlich beibringen.«
»O nein, o nein,« wehrte Katharina ab, »das ist schon gefehlt. Die Venne bringe ich nie dazu, daß sie Heinrich Achtermann etwas eingibt, um ihn zu fesseln. Das verbietet ihr der Stolz und auch ihr Trotz.«
»Ei, ist die Schöne noch so wenig kirre?« höhnte das Weib. »Ja, da wird wenig zu machen sein, wie ich's im Augenblick übersehe. Ich kenne es bis jetzt nicht anders, als daß das Liebchen sich selbst der Sache annimmt. Und ich begegnete auch bisher nie einem Widerstreben. Im Gegenteil, keine hätte einem anderen anvertraut, was ihr selbst dienen sollte.«
»Sie ist auch nicht ›keine andere‹, sondern meine stolze Venne,« entgegnete Katharina, »und was auf andere zutrifft, paßt auf sie noch lange nicht. Also besinnt Euch, ob es nicht einen anderen Weg gibt, sonst muß ich auf Euren[S. 189] Dienst verzichten.« Damit ließ sie das Geld in ihrer Tasche verschwinden.
Habgierig folgten die Augen der unholden Frau ihrer Bewegung. »Nun, vielleicht geht's doch, laßt mir nur einen Augenblick Zeit zum Nachdenken. — Doch, so wird es sich machen lassen. Venne ist, so sagt Ihr, dem Verlobten in heißer Liebe zugetan; ihre Gedanken bewegen sich um ihn. Da kommt es darauf an, daß sie zu der Stunde, wo dem Bräutigam mein Trank gegeben wird, all ihr Sinnen auf ihn richtet. Vermögt Ihr das, indem Ihr selbst das Gespräch auf Heinrich Achtermann bringt, so ist uns geholfen. Und dann bedarf es natürlich noch, was die Hauptsache ist, einer zuverlässigen dritten Person, die jenem den Trank verabreicht. Habt Ihr oder kennt Ihr jemand im Hause Achtermann, dem wir das anvertrauen können?«
»Daran habe ich schon gedacht, als ich zu Euch kam. Eine alte Bekannte von mir lebt als Magd im Hause der Achtermanns. Wie ich die kenne, so hat sie den Heinrich großgewartet. Ihr darf ich mich anvertrauen, und sie wird sich bereit finden, ihm den Trank zu reichen, vorausgesetzt, daß er nichts die Gesundheit Schädigendes enthält. Dann würde übrigens auch ich dazu die Hand nicht bieten«, antwortete Katharina.
»Meint Ihr, ich wolle mich selbst um den Hals bringen? Vielleicht setzt es ein wenig Bauchgrimmen; aber auch das ist bei dem kräftigen Mann nicht zu befürchten. Übrigens sollt Ihr, damit Ihr wißt, daß nichts Giftiges hineinkommt, das Rezept erfahren, und Ihr mögt, wenn Ihr wollt, den Trank selbst brauen. Also hört nun.«
»Nicht doch,« rief Katharina erschrocken, »des vermäße[S. 190] ich mich nicht. Meine alten Augen möchten mich trügen oder die Hände zittern bei dem Zumessen der Sachen. Macht ihn nur fertig, ich will das Weitere schon besorgen.«
»Ach,« sagte die Gittermannsche, »stellt Euch nicht zimperlich an. Wollt Ihr es nicht, so tue ich es. Sorgt dann aber, daß er auch von dem Rechten genossen wird. Immerhin mögt Ihr wissen, was darinnen sein wird.
Ihr holt in der ersten Nacht des abnehmenden Mondes einen Eimer fließenden Wassers, das über Steine floß, und kocht es über drei Steinen, aus demselben fließenden Wasser genommen. Von dem kochenden Wasser mischt Ihr, wenn es wieder kalt geworden ist, in etwas Bier, tut dazu einiges von der Blume Fatur, nehmt auch neun Fliegen, Erde von dem Kirchhofe und ein Stückchen von der Haut einer Natter, — ich kann sie Euch verschaffen. Diesen Trank laßt Ihr dem Bräutigam reichen.
Da Eure Venne nicht selbst handelnd auftreten soll, so will ich den Spruch so wählen, daß alles ohne ihr Zutun sich abspielen kann. In der Nacht darauf, nachdem der Trank gekocht ist, soll ihn Heinrich Achtermann vorgesetzt bekommen. Ihr aber geht in derselben Stunde unter einen Ahornbaum und sprecht zugleich, während Ihr in einem von Euch dort angemachten Feuer stochert, wobei Ihr an Heinrich Achtermann denkt:
Mit einem leisen Grauen hörte Katharina der Frau zu, die mit dumpfer Stimme den Spruch hersagte. »Ist es auch[S. 191] wirklich nichts Böses, was ich da tun soll? Und schadet es den beiden nicht?« fragte sie ängstlich.
Da fuhr sie jene zornig an: »Nun hört aber endlich auf mit Eurem Gefasel von ›Schaden tun‹. Ich werde Euch den Trank geben, ob Ihr ihn dann ausschüttet oder weitergebt, soll mir gleich sein, wenn ich nur mein Geld bekomme.«
[S. 192]
Venne Richerdes wußte nichts von dem, was die gute Katharina ersonnen, um Heinrich Achtermann unauflöslich an sie zu ketten. Sie saß in ihren Gram versenkt in dem düsteren Hause und nahm keinen Anteil an dem Leben außerhalb desselben. Vom Vater hatte sie den verderblichen Hang geerbt, im Unglück sich in sich zurückzuziehen, sich mit einer Regung wollüstiger Gier in die Rolle des Märtyrers zu versenken, ohne ihn wirklich spielen zu wollen. Sie vergaß, daß sie selbst es war, die eine Mauer um sich aufbaute durch ihr herbes Sichabschließen gegen die Nächsten.
Die Mitmenschen, die gutherzigen, sind wohl geneigt, uns mit ihrem Trost beizustehen. Nur wenige von ihnen aber geben sich die Mühe, hinter dem Wall verbitterten Stolzes das wunde Herz aufzusuchen, es in die Hand zu nehmen und ihm in gütiger Geduld Heilung zu bringen. Sie urteilen nach dem Schein: Sie will nichts von uns wissen, also mag sie für sich bleiben!
Zum Glück für Venne Richerdes lebten ihr aber wahre Freunde in der Stadt, die sich durch ihre Herbheit nicht abschrecken ließen, sondern zu ihr durchdrangen und sie, je nach ihrer Gemütsart, durch ruhigen, sanften Zuspruch oder durch herzhaftes Zugreifen aus ihrem Trübsinn herauszureißen versuchten. Da war zum Beispiel die gute Immecke Rosenhagen. Wem die einmal ihr Herz geöffnet hatte, der behielt seinen Platz darinnen, und die Scheelsucht und[S. 193] Schmähsucht der Welt steigerte höchstens noch ihre Zuneigung zu dem Mädchen, das es ihr mit seiner Schönheit, vor allem aber mit seinem freimütigen, gar nicht stolzen Wesen ihr gegenüber angetan hatte. Jetzt mußte sie ihre Zeit teilen zwischen dem ›Goldenen Adler‹, wie den unbändigen Enkelkindern und der einsamen Frau in der Bergstraße.
Ihr gutes Herz erkannte Venne den Löwenanteil zu. Jeden Tag hockte sie in dem Hause, das jetzt so still dalag, und suchte Venne aufzuheitern mit drastischem Zuspruch und weichem, lindem Trost. Merkwürdig, selbst ihre barschen Worte, wenn sie einmal ungeduldig mahnte, jene solle nun endlich das Kopfhängen lassen, erreichten mehr als vielleicht die mitleidig klingende Äußerung eines anderen, der aber nach Vennes Argwohn die innere Wahrheit fehlte.
Bei der alten Dienerin erkundigte sie sich nach vielen Einzelheiten, um den Schlüssel zu der abgrundtiefen Verzweiflung zu finden, in die Venne versunken war. Katharina verhehlte ihr nicht, daß ihr Verhältnis zu dem Verlobten wohl der Hauptanlaß sei, und es entschlüpfte ihr auch wider Willen eine Andeutung über ihr Vorhaben, zu dem die Gittermannsche die Hand bot. Immecke war erschrocken und riet dringend ab: »Von der Frau kommt nichts Gutes. Und was sie Euch vorredet von ihrer schwarzen Kunst, ist eitel Geschwätz. Ihr nützt nichts, richtet aber vielleicht großes Unheil an.«
Da wurde Katharina wieder schwankend, denn sie hielt von dem Urteil der weitgereisten und weltklugen Immecke Rosenhagen viel. Als dann indes die unheimliche Frau mit ihrem Trank kam, ließ sie sich doch überreden, ihn ihrer guten Freundin im Hause Achtermann zu geben.
[S. 194]
Aber Immecke war nicht die einzige, die sich der armen Venne annahm. Auch das Haus Hardt bewies ihr in diesen Tagen, wessen wahre Freundschaft fähig ist.
Seit Jahresfrist weilte auch Gisela von Wendelin in der Stadt am Harz. Sie hatte liebevollste Aufnahme gefunden im Schoße der Familie Hardt. Auch der Vater, der Arzt, erschloß ihr bald sein ganzes Herz, nachdem er kurze Zeit die Fremde, die aus weiter Ferne her, gegen das Herkommen, Einlaß in die goslarsche Gemeinschaft heischte, etwas zurückhaltend beobachtet hatte. ›Heischte‹ hieß ihr übrigens unrecht tun; denn sie kam, obwohl die Liebe ihres Johannes sie umhegte, wie ein schüchternes, verscheuchtes Vöglein, das sein Nest verloren hat. Gerade diese hilflose Schüchternheit, die sich der Anmut nicht bewußt war, in die sie gekleidet, gewann ihr die Herzen im Fluge.
Als Gisela in Goslar eintraf, war im Hause Richerdes noch das Glück zu Gaste. Zwar siechte die Mutter, aber selbst ihr Leiden wurde verklärt durch die frohe Erwartung, die sich auf dem Antlitz Vennes widerspiegelte. Auch der Vater war trotz manchen täglichen Ungemachs gehobener Stimmung, bestand doch die Aussicht, daß mit dem Verkauf an die Stadt die Quelle aller Widerwärtigkeiten gänzlich verstopft werden würde. Dann brach das Unglück über sie herein. Die Bekannten zogen sich zurück. Freunde, auf die man gerechnet hatte, erwiesen sich als treulos. Da enthüllte sich die Lauterkeit Giselas am reinsten und schönsten. War sie schon vorher mit Venne befreundet, so wurde sie ihr jetzt eine starke Stütze. Sie kannte selbst die Schule des Leides; sie hatte es an sich selbst erlebt, was es heißt, in der bittersten Not einsam und verlassen zu sein. Unendliches Mitleid[S. 195] mit der Mitschwester erfüllte ihr Herz und ließ sie alles versuchen, jene aufzurichten.
Ihr gegenüber sprach Venne auch von Heinrich Achtermann und ihren Sorgen. Gisela hatte nur Worte zuversichtlicher Hoffnung. »Wenn er Dich lieb hat, wie Du es sagst, und wenn er so ist, wie Du ihn schilderst, verstehe ich Deine Bedenken nicht. Er wird Festigkeit genug in sich fühlen, um auch den Widerstand des Vaters zu besiegen. Nimm aber auch Du ihm nicht die Hoffnung, daß Du selbst nicht in dem Kampfe unterliegen wirst. Mir will es scheinen, als ob Deine Zurückhaltung ihn kränken, in ihm die Meinung hervorrufen muß, daß Deine eigene Liebe zu erkalten drohe. Wecke diese Stimmung nicht in ihm, es könnte zuletzt der Trotz in ihm erwachen und dem Vater ein wertvoller Bundesgenosse werden.«
Venne versprach, ihrem Rate zu folgen, und als Heinrich wieder bei ihr anklopfte, gab sie sich unter dem Eindruck der Zuversicht, welche Gisela in ihr geweckt hatte. Heinrich, der unter dem Widerstand des Vaters und der herben Zurückhaltung der Geliebten in einen Widerspruch der Gefühle gekommen war, der ihn aufs tiefste bedrückte, atmete auf. Sie verlebten eine Stunde ungetrübten, reinen Glücks. Und Heinrich schied von ihr mit dem zuversichtlichen: »Du sollst sehen, meine einzige Venne, auch uns lacht wieder die Sonne.« Da verdarb die gute Katharina vollends, was sie ehrlich bemüht war, gutzumachen.
[S. 196]
Zu Worms, wo Siegfried um die Burgundentochter gedient und gefreit, wo Kriemhilde dem meuchlings Erschlagenen dreizehn Jahre nachgetrauert hatte, ehe sie in ihrem brennenden Schmerze, zur Sättigung ihrer Rache, sich dem Hunnen Etzel vermählte, zu Worms, der großen Kaiser- und Reichsstadt, war alles Leben und Bewegung. Wie so oft seit den Tagen, in denen sich die Rüstungen der reisigen Burgunder in den Fluten des Rheins spiegelten, war die Stadt ein gewaltiges Heerlager. Aus allen Gauen des gewaltigen Reiches kamen die Ritter und Herren, die Grafen und Fürsten, die Äbte, Bischöfe und Erzbischöfe mit ihrem Gefolge, ihren Gewappneten und dem Troß ihrer Knechte. In der volkreichen Stadt fanden längst nicht alle Unterkunft. Man schlug außerhalb ihrer Mauern Zelte auf, um die Gäste unterzubringen. In den Herbergen und Gasthöfen herrschte ein Leben, wie es selbst Worms kaum gesehen.
Reichstag! — Reichstage waren in Worms keine Seltenheit seit Jahrhunderten. Aber noch nie hatte einer die Welt derart in Spannung gehalten wie der des Jahres 1521. Eine neue Welt stieg empor. Die alte stand bereit, ihre Nebenbuhlerin zu bekämpfen und, war es möglich, zu zertrümmern. Und die Machtmittel der alten waren trotz Verfalls noch so gewaltig, schrecklich, daß Menschenmut und Menschenkraft nicht auszureichen schienen, sie zu bezwingen. Woher nun nahm der unscheinbare Dominikanermönch zu[S. 197] Wittenberg, von dessen Dasein vor wenig Jahren noch weder Kaiser noch Päpste eine Ahnung gehabt hatten, den abenteuerlichen Mut, gegen die größten Gewalten der Welt, seitdem die Menschen sich Fürsten gesetzt und der Autorität einen Thron errichtet hatten, anzugehen?
Luther betrat eine Bahn, die nur für ihn selbst neu war. Er wurde in sie hineingestoßen nach schweren, inneren Kämpfen. Nicht Effekthascherei, nicht die Sucht nach einem deklamatorischen Theatererfolge führten ihn nach Worms, sondern die kindliche Gewißheit, sich mit seinem Gott eins zu fühlen, von seinem Geist und Willen Zeugnis ablegen zu müssen für das lautere Gotteswort, ließ ihn mit schier fröhlicher Zuversicht den Weg in die Höhle des Löwen antreten.
»Mönchlein, Mönchlein, Du gehst einen schweren Gang!« — Jeder, der die Unbekümmertheit kannte, mit der die Gewalthaber der römischen Kirche über Bedenken irdischer Art sich wegzusetzen gewohnt waren, wenn es galt, das Erbe Petri zu schützen; wie vor ihrem Willen auch ein kaiserliches Wort sich bog und gebrochen wurde, mochte die Worte des wackeren Frundsberg verstehen, als er den armseligen Mönch in den Kreis seiner Feinde treten sah.
Hätte er freilich die Millionen zu seinem Schutze um sich gehabt, denen seine Lehre aus dem Herzen gesprochen war, ihm hätte trotz des Machtaufgebots, das ihn in Worms waffenstarrend erwartete, nicht bange zu sein brauchen. Nicht nur der gewaltige Kreis der Jünger, bei denen sein Wort in wenigen Jahren wie eine Fackel gezündet, standen bereit, sondern die Millionen in allen Ländern des Abendlandes, die unter dem unerträglichen Joch ihrer Zeit seufzten. Es hatte sich bei dem armen Bürgersmann wie bei dem[S. 198] Bauern seit Jahrhunderten ein Haß aufgespeichert, gegen den selbst die sozialen Gegensätze unserer Tage wie ein Kinderspiel anmuten mögen. Es war der Haß des städtischen wie des ländlichen Proletariats gegen die Besitzenden, Bevorrechteten, die Reichen in jeder Gestalt, vornehmlich aber die Geistlichen. Das ›Pfaffenstürmen‹ fand schon lange vor Luther hier und da begeisterte Anhänger. Schaurig hallten die Verse der Bauern wider, welche durch die Aufruhrpredigt des ›Pfeiffers von Niklashausen‹ in Bewegung gesetzt waren:
Die Kirche wankte indes darum noch nicht in ihren Grundfesten, es waren Vorgänge von lokaler Bedeutung. Wehe aber, wenn sich der Mann fand, der alle diese Kräfte auf ein Ziel hin in Bewegung zu setzen verstand! Und wehe ihr, wenn er zu diesem Haufen verzweifelnder Existenzen auch noch das Heer derer gesellte, die nicht um irdischer Vorteile willen, sondern, um ihr Herz von dem inneren Widerstreit der Gefühle zu befreien, auf den Rufer harrten, der sie anführe zum Kampf gegen die verrottete Kirche.
Die Schäden hatte auch Ernesti, der kluge und weitgereiste Kaufmann, erkannt und zugestanden; um den endgültigen Sieg der Kirche war ihm nicht bange. Und doch erwies sich sein Urteil als kurzsichtig. Das Klagelied von der Pfaffen Übermut und Üppigkeit, von ihrer Unbildung und Verrohung, von der Priester wie der Mönche und Nonnen Unflätigkeiten, dieses Lied, das auch die Päpste zu[S. 199] nennen sich nicht scheute, erklang allüberall und wurde gern gehört und mitgesungen.
Vielleicht hatten den armen Bergmannssohn zu Eisleben diese Töne schon umklungen, und sie waren in ihm nachgehallt, als er in brünstigem Gebet sich in seiner Zelle zu Erfurt wand und um Erleuchtung flehte. Die Erkenntnis von der Verderbtheit der Diener der Kirche kam ihm, als er in Rom den Sündenpfuhl sah, in dem jene sich wälzten, und die Erleuchtung über das, was seine Aufgabe sei, in Wittenberg angesichts des schamlosen Treibens jenes Ablaßkrämers von Papstes Auftrag, und durch sein ehrliches, frommes Streben, die Wahrheit zu ergründen. Er fand sie in seinem Verkehr mit Gott und in dem Worte Gottes, wie es von den Vätern aufgezeichnet stand. Und im schlichten Vertrauen auf die Güte seiner Sache folgte er der kaiserlichen Ladung.
Im Januar schon war der Reichstag einberufen, im Frühjahr brach Luther gen Worms auf. Überall unterwegs fand er die Spuren der Tätigkeit gegen sich, die der Kaiser eigenhändig gegen ihn gezeigt hatte.
Noch dicht vor Worms warnte ihn sein Freund und Landesvater, der Kurfürst, er solle umkehren, das Schicksal Hus' würde auch das seinige sein. Aber: »Ich will hinein, und wenn so viel Teufel auf mich zielten, als Ziegel auf den Dächern sind.«
Einer der größten Tage der Geschichte brach mit dem 18. April des Jahres 1521 an, als Luther gegen Abend zum anderen Male, nachdem er schon tags vorher vor die Reichsversammlung geführt war, in den bischöflichen Palast geleitet wurde. Im Saale brannten die Fackeln, als er hineintrat. Vor ihm saß die ganze Herrlichkeit des Reiches und[S. 200] der Kirche. Der Kaiser mit seinem Bruder Ferdinand, sechs von den sieben Kurfürsten, achtundzwanzig Herzöge, dreißig Prälaten, viele Fürsten, Grafen und städtische Abgeordnete.
Am Tage vorher hatte sich an dem Mönche eine gewisse Befangenheit und Unsicherheit kundgetan; heute, so glaubte man, werde er widerrufen.
Die Spannung war ungeheuer bei allen. Mochte auch der junge Kaiser verächtlich zum Bruder sagen: »Der soll mich nicht zum Ketzer machen«, er konnte sich, je länger Luther sprach, dem Eindruck nicht entziehen, daß ein außergewöhnlicher Mensch da vor ihm stehe, ein Mensch jedenfalls, der irdische Furcht nicht kannte.
»Der Mönch redet unerschrocken und kühn«, entschlüpfte es ihm während der Verhandlung wider Willen.
Ja, wahrlich, der Mann hatte nicht Menschenfurcht in sich. Der Offizial des Erzbischofs von Trier, Johannes Eck, benahm sich durchaus gemessen und vornehm, als er Luther die formulierte Frage vorlegte. Man hoffte, wenigstens einen teilweisen Widerruf zu erreichen. Aber der Mönch dachte nicht an Widerruf. Mehr und mehr gewann seine Stimme an Zuversicht, je länger der Disput dauerte. Man sah, hier half kein Disputieren mehr, kein Zureden noch Freihalten eines Rückzugweges für den Ketzer, hier mußte die Entscheidung klipp und klar gefordert und gegeben werden. Und so verlangte denn Eck eine bestimmte, deutliche Antwort. Und Luther gab sie: »Weil denn Ew. Kaiserliche Majestät und Ew. Gnaden eine schlichte Antwort verlangen, so will ich eine Antwort ohne Hörner und Zähne geben ...«
Atemlose Spannung lag auf den Zügen der Versammlung, die meisten standen, um sich kein Wort, keine Miene[S. 201] des Mannes da vor ihnen entgehen zu lassen. Verklärte Freude die einen, verbissene Wut die Gegner auf dem Gesicht, so lauschten sie, bis das Schlußwort kam, jenes gewaltige, das sich wie ein brünstiges Gebet und Bekenntnis von seinen Lippen rang: »Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen!«
Totenbleich war das Antlitz des kühnen Streiters, als er sich vor der Versammlung verneigte und den Saal verließ, aber es war nicht die Blässe der Furcht. Überirdisch leuchtete sein Auge: So blickte nur einer drein, der nicht Menschenfurcht in seinem Herzen trägt, sondern der weiß, daß Gott in ihm und um ihn ist.
Gewaltig war der Eindruck seiner Worte auf die Hörer. In vieler Augen glühte die Begeisterung über den unerschrockenen Gotteskämpfer. In der äußersten Ecke, wo die Vertreter der Stadt und einige andere Zuschauer standen, lief ein gedämpftes Flüstern durch die Reihen. »Unglaublich, dieser Mut«, »herrlich, herrlich«, so klang es aus ihrem Munde.
Unter den Zuschauern stand auch ein gedrungener Mann, an den sich eine Frau lehnte, von deren Gesicht man wenig sehen konnte. Der Gestalt nach war es ein junges Mädchen, das sich wohl auf den Vater stützte. Unentwegt hatte der Mann dem Mönch ins Auge geblickt, solange er redete; aufmerksam lauschte die Frau. Die Erregung teilte sich auch ihnen mehr und mehr mit. Bei den letzten Worten durchlief ein Schauer die Gestalt der Frau. Besorgt legte der Begleiter ihren Arm in den seinigen. »Laß uns gehen,« schlug er vor, da schon ein Teil der Zuschauer sich still entfernte, »es greift Dich an, wie ich sehe.«
»Ja, laßt uns gehen«, fiel sie eilig ein und drängte zum Ausgange.
[S. 202]
Draußen umfächelte sie die Kühle des Aprilabends; beide atmeten in tiefen Zügen die frische Luft ein.
Es waren Venne Richerdes aus Goslar und ihr Oheim Ernesti aus Soest, die hier in Worms auf die Straße traten, um nach ihrer Herberge zu gehen. »Das ist ein wahrhaft furchtbarer Mann«, unterbrach Ernesti das Schweigen.
»Sagt das nicht, Ohm«, fiel ihm Venne ins Wort. »Wäre es nicht ein Ketzer und Ketzerei, was er betreibt, so möchte ich rufen: Welch ein herrlicher, großer Mann! Sahet Ihr nicht die glühende Begeisterung, die sich auf seinem Gesicht ausprägte? Merktet Ihr nicht, daß ihm jedes Wort aus dem tiefsten Herzen kam? — So spricht kein Lügner und abtrünniger Mönch, der sich seiner Gelübde um irdischer Vorteile willen entzieht.«
»Um so schlimmer für ihn und für uns«, antwortete Ernesti fast feierlich. »Weil er mit den Waffen deutscher Schlichtheit und Einfachheit ficht, wirkt er um so ansteckender und verheerender. Einem bloßen Worthelden würde bald der Atem ausgehen und die Gefolgschaft aufgesagt werden. Wieviel Ärgernis ist durch diesen Mönch schon über die Kirche gekommen! Das wird er vor dem höchsten Richter zu verantworten haben, wenn er der irdischen Gerechtigkeit entgeht. — Aber die Kirche wird doch zuletzt siegen, weil sie von Gott ist«, schloß er mit fast demselben Wort, das er einst dem jungen Goslarer gesagt hatte.
»Aber wenn er recht hat, müssen doch seine Gegner sich irren,« fuhr sie zweifelnd fort, »und Ihr sagt doch selbst, daß seine Schlichtheit Euch gepackt habe. Mir sollte es leid tun, wenn dieser edle Mönch in dem Kampf zerbrochen würde.«
»Bist Du auch schon auf dem Wege zu ihm?« fragte er[S. 203] grollend. »Hüte Dich, solche Gedanken laut werden zu lassen; sie möchten Dir teuer zu stehen kommen. Denn Du weißt, wir sind aus anderen Ursachen hier, und die Sache eines Abtrünnigen wird dem gut katholischen Kaiser nicht sehr am Herzen liegen.«
»Seid nicht böse, Ohm,« lenkte Venne ein, »Ihr wißt, daß ich so gut wie Ihr treu zur alten Lehre stehe. Aber ich kann doch nicht dafür, daß dieser Mann aus Wittenberg einen solchen Eindruck auf mich macht. Ich bin manchmal fast irre an mir selbst. Ich will bei dem Glauben bleiben, dem ich mich als Kind gelobt habe, in dem Vater und Mutter gestorben sind; doch sehe ich, wie alles um mich wankt. Denn auch in Goslar hängen schon viele der neuen Lehre an. Die Masse des Volkes jubelt dem Reformator zu. In vielen Häusern zerfällt die Familie in Zwiespalt, weil die einen noch glauben, was die anderen schon ablehnen. Soll ich da nicht auch schwankend werden. Zu den schweren Sorgen, die mich schon bedrücken, ist jetzt noch diese Herzenspein hinzugekommen. Oh, rettet mich doch aus dieser Not oder, wenn Ihr es könnt, befreit mich von diesem schrecklichen Zwiespalt.«
Ernesti sah sie mitleidig an. »Du tust mir von Herzen leid, mein Kind, helfen aber kannst Du Dir nur selbst. Mit Deinem Gott mußt Du allein fertig werden. Nimm Dein Herz fest in Deine Hand, blicke nicht rechts und nicht links; sage Dir immer wieder: Ich will meinem Glauben treu bleiben! Und Du wirst die Palme erringen.«
In der Herberge gingen sie bald zur Ruhe, denn sie verspürten keine Lust, noch an dem lebhaften Meinungsaustausch teilzunehmen, der über den Mönch und sein Auftreten entbrannt war.
[S. 204]
Vieles war in Goslar vor sich gegangen, seit wir zuletzt Gisela Hardt und Immecke Rosenhagen bemüht sahen, Venne in ihrem Schmerz zu trösten. Der Rat hatte neue Scherereien mit dem Herzog Heinrich dem Jüngeren, der aus dem 1519 erneuerten Schutzvertrage die Verpflichtung für die Stadt ableitete, ihm zur Vollziehung der über den Bischof von Hildesheim vom Kaiser verhängten Acht Mannschaft und Geld zu liefern. Sie mischten sich höchst ungern in diese Sache, denn der Rat hatte mit der Unruhe in der Stadt genug zu tun.
Es gor unter dem gemeinen Volk; die Lehre von Wittenberg war auch nach Goslar gedrungen, und wenn sie noch keine offenen Anhänger fand, zeigte sich doch die Wirkung in dem Verhalten der Einwohner gegen die Pfaffen und die Kirche. Bürger wie Proletarier spotteten laut über die heiligen Reliquien, die zum Peter-Pauls-Tage feierlich gezeigt wurden. Den Priestern tönten höhnende Worte in die Ohren, wenn sie sich sehen ließen, und ein paar Nonnen wurde der Schleier abgerissen und der Rosenkranz weggenommen, als sie in ihr Kloster zurückkehren wollten. Der Rat ließ die Täter gefangensetzen, aber die Quelle der Unruhe war damit nicht verstopft. Auch die Fahrt der Venne Richerdes, die natürlich nicht verborgen blieb, erweckte Unbehagen. Denn, wenn man sich auch im Rechte ihr gegenüber wußte, so blieb es doch unbequem, vor dem Reichstage hingestellt zu werden als eine Stadt, die ihren Bürgern Unbilliges zumute.
[S. 205]
Aber ebenso tief wurzelte in Venne die Überzeugung von ihrem Recht. Ihr Vater war sein Leben lang ein Ehrenmann gewesen, dem niemand nachsagen konnte, daß er fremdes Gut an sich gebracht habe. Auf dem Sterbebette noch beteuerte er, daß der Rat ihm zu Unrecht die Kaufsumme vorenthalte, und sie hörte seine Mahnung: »Vergiß nicht, Dir mein Recht zu holen, daß ich ruhig sterben kann.« Sie hatte zunächst in Goslar alles versucht, um zum Ziele zu kommen.
Die Rechtslage war zweifelhaft. Der Oheim der Hardts nahm sich ihrer an und verfocht ihre Sache vor dem Rate, aber er erreichte nichts. Johannes riet ihr ab, weitere Schritte zu unternehmen; seine Frau Gisela schloß sich ihm an.
»Du gehst daran zugrunde, Liebste, laß den Streit. Komm zu uns, bis Du Heinrich angehören darfst.«
Doch Venne blieb eigensinnig bei ihrer Absicht, alle Mittel zu erschöpfen, um dem Vater ihr Wort zu halten.
Den unmittelbaren Anstoß zu dem Appell an die höchste Stelle im Reich gab ihr eine jener Äußerungen, die Übelgesinnten so leicht und schnell vom Munde gleiten. Mit scheinbarem Mitleid, unter dem sich aber die Schadenfreude nur schlecht verbarg, fragte eine der ewig lästersüchtigen Nachbarinnen Venne, nachdem sie schon jene über dieses und jenes auszuforschen versucht hatte, wovon sie denn eigentlich lebe und weshalb sie sich eine Dienerin halte. Venne, die schon über die ganze Art der Fragestellerin ungehalten war, gab ihr eine kurze, ablehnende Antwort. Darauf antwortete jene sehr spitz: »Nun, nur nicht so hochmütig, Jungfer Obenhinaus, wir haben doch keinen Anlaß, so stolz zu sein, als Tochter eines Bettlers, der noch dazu die Stadt Goslar um viel Geld betrügen wollte.«
[S. 206]
Venne ließ die Boshafte hochmütig stehen, aber als sie nach Hause gekommen war, brach ihre mühsam bewahrte Haltung zusammen, und ein wildes Schluchzen ließ ihren Körper erbeben: So weit war es also gekommen, daß man ihres Vaters Ehrlichkeit anzutasten wagte.
Nun gab es kein Besinnen mehr; sie wollte die höchste Stelle im Reich um ihr Recht angehen. Wieder riet der Oheim Johannes', der Notar, ab, und auch jener widersprach ihrer Absicht, doch dieses Mal blieb sie unbeirrbar bei ihrem Vorhaben. Die Ehre ihres Vaters durfte sie nicht antasten lassen. Die Freunde wußten sich keinen anderen Rat, als Heinrich Achtermann ins Vertrauen zu ziehen. Er war in der letzten Zeit mehrmals im Auftrage des Vaters verreist gewesen und hatte deshalb Venne längere Zeit nicht gesehen. Heinrich zeigte sich sogleich bereit, auf Venne einzureden, denn auch er lehnte innerlich den Plan ab.
Es war eine leichte Entfremdung zwischen den beiden eingetreten, die der Verlobte auf die herbe Zurückhaltung Vennes zurückführte, während diese, in ihrer Empfindlichkeit und in ihrem fast krankhaften Argwohn, überall Geringschätzung und Ablehnung zu wittern, bei ihm die ersten Anzeichen dafür zu merken glaubte, daß auch Heinrich den Einflüsterungen Gehör schenke.
Heinrich gab sich alle Mühe, unbefangen und herzlich zu sein. Auch Venne konnte sich seiner Aufrichtigkeit nicht entziehen und verlor allmählich ihre Verstimmung. Als er aber dann auf den eigentlichen Zweck seines heutigen Besuches zu sprechen kam, nahm sie sogleich wieder eine kriegerische Haltung an. Was er auch gegen ihre Absicht anführte, sie kehrte immer wieder zu dem eigensinnigen Einwande[S. 207] zurück: »Ich habe es dem Vater versprochen und bin es seiner Ehre schuldig.«
»Venne, tue es mir zuliebe«, bat er sie. »Du schaffst nur noch Hindernisse für unsere Vereinigung. Der Vater, der im Rat ist und gewiß an dem Spruch gegen Deinen Vater mitgewirkt hat, wird es sicher als besondere Kränkung empfinden, wenn Du jenen verklagst. Ich bitte Dich herzlich, laß ab von Deinem Vorhaben, dessen Erfolg zudem noch sehr zweifelhaft ist, wie mir auch die Hardts gesagt haben.«
Aber sie blieb unerschütterlich. »Hat Dein Vater gegen uns geurteilt, so muß er überzeugt werden, daß er unrecht tat. Wenn der Spruch, wie ich hoffe, gegen die Stadt ausfällt, wird er als Ehrenmann doch hoffentlich eingestehen, daß er irrte.«
Heinrich sah ein, daß nichts zu erreichen war. Ihm lag daran, mit ihr noch etwas zu besprechen, was vielleicht sie bewegen konnte, doch von ihrem Vorhaben abzustehen. Sein Vater hatte nur noch selten mit ihm über sein Verhältnis zu Venne gesprochen, aber aus allem, was der Ratsherr sagte, konnte der Sohn klar erkennen, daß derselbe an nichts weniger dachte als ein Zurückziehen seines Widerspruches.
In der Tat war Achtermann der Ältere mehr denn je entschlossen, das Verhältnis zu lösen. Einstweilen hoffte er noch, die Zeit werde ihm zu Hilfe kommen; Heinrich wußte indes, daß der Vater zur Not auch vor Gewalt nicht zurückschrecken werde. Die beste Hilfe versprach sich der Ratsherr von einer längeren Trennung der beiden. Und es kam ihm der Gedanke, Heinrich von Goslar zu entfernen. Seine Geschäfte reichten bis London, und es war ihm ein leichtes, einen Grund zu finden, der die Notwendigkeit des Aufenthaltes des Sohnes dort oder in einem anderen, entfernten[S. 208] Ort auch diesem als berechtigt erscheinen lassen konnte. Nun hatte er beiläufig mit Heinrich darüber gesprochen, und dieser, der die wahre Absicht des Vaters durchschaute, stellte Venne vor, daß ihre Anwesenheit ihm am Herzen liege, um dem Vater gegenüber die Festigkeit zu bewahren.
Sie war erschrocken, aber ihr Trotz verbot ihr, nachzugeben. »Wenn Du mich liebst, wie Du beteuerst, wirst Du auch ohne mich dem Vater widerstehen. Vielleicht kommt Dir der Befehl des Vaters ganz gelegen«, schloß sie in wieder erwachendem Argwohn.
Da wurde auch der Geliebte zornig. »Du sprichst wie ein ungezogenes Kind, Venne. Ich habe Dir, denke ich, noch nie den geringsten Anlaß zu Mißtrauen gegeben. Doch Du machst es mir schwer, unsere Sache zu verteidigen. Statt bei Dir Unterstützung zu finden in dem Kampf gegen den Starrsinn des Vaters, setzt auch Du Deinen Trotzkopf auf und behandelst mich, als hätte ich nicht ein Fünkchen vertrauensvoller Liebe verdient. Willst Du nicht auf mich hören, so trägst Du die Schuld an allem, was folgt. Ich gehe jetzt, denn es hat keinen Zweck, gegen Deine Unvernunft noch länger anzureden.«
Da brach Venne in haltloses Weinen aus, daß Heinrichs Zorn in Mitleid zerschmolz. Zärtlich umarmte er sie und sprach ihr tröstend zu. »Ist es denn so schwer, meine gute, süße Venne, das Trotzköpfchen zu beugen?«
»Ach, mein Einziger, sei mir doch nicht böse. Ich bin gewiß oft häßlich und lieblos zu Dir, aber glaube nicht, daß meine Liebe sich gemindert hat. Du kannst ja nicht in mein Inneres sehen und weißt nicht, wie ich unter dieser elenden Lage leide. Laß mich noch diesen einzigen Versuch[S. 209] machen; dann will ich gewiß nichts mehr von der Sache reden.«
Heinrich sah, daß er nachgeben mußte; so sagte er nur: »Gut, Liebste, so wollen wir es gelten lassen. Du mußt jedoch damit rechnen, daß Du mich nicht triffst, wenn Du zurückkehrst. Dann verliere nicht den Mut, das mußt Du mir versprechen. Ich hoffe, daß wir den Widerstand des Vaters eher besiegen, wenn ich ihm jetzt zu Willen bin. Sieht er, daß auch die Trennung unserer Liebe keinen Abbruch tun konnte und bringst Du vielleicht noch einen Dir günstigen Bescheid mit, so muß er zuletzt nachgeben.« So endete der Abend mit einer vollen Versöhnung der beiden, und sie nahmen von einander in alter Zärtlichkeit Abschied.
Venne traf alle Vorbereitungen zur Reise. Johannes Hardt, der Rechtsgelehrte, hatte ihr gesagt, daß man gegen reichsunmittelbare Stände, zu denen die Stadt Goslar als Reichsstadt gehörte, bei dem Reichskammergericht Einspruch und Klage erheben könne. Er riet indes zu dem schneller wirkenden Mittel, sich an den Kaiser selbst zu wenden, was in besonderen Fällen anging.
Der Reichstag in Worms war für das Jahr 1521 angesetzt. Dort mußte sich Gelegenheit bieten, ihre Sache vorzubringen, statt sie vor dem sehr langsam arbeitenden Reichskammergericht zu Frankfurt am Main entscheiden zu lassen.
»Habt Ihr einen Fürspruch an dem kaiserlichen Hofe,« sagte Johannes, »so wird es Euch nicht fehlen, vor den Kaiser gelassen zu werden.«
Wer konnte da besser helfen als der Ohm Ernesti in Soest! Daher beschloß Venne, den Umweg über Westfalen zu wählen, um jenen dort aufzusuchen und ihn zu bitten, sie nach Worms zu begleiten.
[S. 210]
Ernesti war vor geraumer Zeit in Goslar gewesen und hatte verlauten lassen, daß er künftig weniger in der Welt umherreisen werde, da das Alter auch ihn allmählich drücke. Sie durfte also hoffen, ihn zu Hause zu treffen. Und sie zweifelte nicht, daß er ihretwegen sich noch einmal der Mühe einer Reise unterziehen werde.
Venne Richerdes reiste ab. Bald nach ihr verließ auch ihr Bräutigam Goslar. Vor seiner Abreise ereignete sich jedoch noch etwas, was alle Zukunftspläne über den Haufen werfen sollte. Die alte Katharina hatte zwischen dem Wunsch, ihrer Venne zu helfen, und dem Zweifel, ob sie recht tue, der Gittermannschen zu folgen, ihr Vorhaben noch nicht ausgeführt, obwohl die alte Vettel ihr immer wieder zuredete.
Als sie nun aber erfuhr, daß Heinrich eine große Reise antrete, schwanden alle Bedenken. Wer wußte, welche Gefahren draußen auf ihn lauerten, um seine Liebe zu ertöten! Daher besprach sie mit ihrer Freundin im Achtermannschen Hause alles Erforderliche, und diese gab dem jungen Herrn den Zaubertrunk. Doch die Wirkung war eine andere, als Katharina erwartete. Heinrich erkrankte heftig, so daß man an eine Vergiftung glaubte. Das war es wohl auch in der Tat.
Die alte Magd bei Achtermanns erschrak aufs tiefste, denn sie hing an Heinrich nicht weniger als Katharina an ihrer Venne. Von Angst getrieben, bekannte sie, was sie angerichtet habe. Der Vater war außer sich vor Zorn. Er maß natürlich alle Schuld Venne bei.
»Da siehst Du, mit was für einer Person Du es noch hältst«, höhnte er. »Wie eine Troßdirne buhlt sie um Deine Gunst. Sie schämt sich nicht des Umganges mit Hexen und[S. 211] Dunkelmännern. Den Trunk hat ihr gar wohl der Henker gebraut, zu dem ja alle feilen Dirnen in ihrer Brunst laufen. Aber die soll mir wiederkommen und auf Deine Hand Anspruch erheben. Vor das Peinliche Gericht bringe ich sie, den Prozeß lasse ich ihr machen!« so tobte er.
Der Sohn versuchte, seine Braut zu verteidigen. »Vater, Du tust Venne gewiß unrecht. Sie weiß, daß sie sich meiner Liebe nicht erst durch Zauberei zu versichern braucht. Urteile nicht, bis sie selbst sich verteidigen kann.«
Doch da kam er schlecht an. »Meinst Du, das Weibsbild werde ich noch eines Wortes würdigen. Für mich ist die Sache erledigt, und wehe ihr, wenn sie es wagt, an der Vergangenheit zu rühren.«
Heinrich sah ein, daß jetzt nichts zu hoffen war. Nun konnte auch er allein von der Zeit eine Besserung erwarten. Er war von Vennes Unschuld überzeugt, aber er grollte ihr doch, daß sie ihn in dieser Stunde, wo ihr Glück in Scherben zu gehen drohte, allein gelassen hatte. Tief bekümmert traf auch er seine Anstalten zur Abreise. Er sollte in der Tat nach London fahren, um am Stahlhof die Achtermannschen Geschäfte wahrzunehmen. Es galt, sich auf eine lange Abwesenheit einzurichten. Aber er hoffte, daß bei seiner Wiederkehr die Wetterwolken verzogen waren. Er würde jedenfalls, das nahm er sich vor, nicht von Venne lassen.
Der Ohm war bereit, Venne zu begleiten. Auch er entschied sich für Übergehung des Reichskammergerichtes. »Wenn wir die Sache dort anhängig machen, ist Aussicht[S. 212] vorhanden, daß vielleicht Deine Enkel einmal den Entscheid erhalten. Der Gerichtshof ist mit so vielen ungleich wichtigeren Sachen überlastet, daß sich auf die Akten Deines Prozesses der Staub von Jahrzehnten lagern würde. Wir wollen also versuchen, in Worms vorgelassen zu werden. Ist uns das Glück hold, so gelingt es mir, einen der fürstlichen Prokuratoren des Gerichts zu gewinnen, die ja selbstverständlich auf dem Reichstage auch anwesend sein werden.«
Obwohl der Reichstag schon Ende Januar eröffnet worden war, kamen sie doch noch zeitig genug. Zunächst sollten die weltlichen großen Angelegenheiten erledigt werden. Da galt es zuerst eine Sache des Herzogtums Württemberg zu behandeln, dessen Herzog Ulrich der Schwäbische Bund vertrieben hatte; ferner tauchte zum soundsovielten Male die italienische Frage wieder auf.
Zur Abwechselung hielt diesmal der Franzosenkönig Franz I., einer der Mitbewerber Karls um die Kaiserkrone, das Reichslehen Mailand besetzt. Das bedeutete eine Minderung des kaiserlichen Ansehens, die der junge Kaiser nicht hinnehmen wollte. Gegen eine entsprechende Gegenleistung bewilligten ihm die Kurfürsten zwanzigtausend Mann Fußvolk und viertausend Reiter zu einem Römerzuge. Für den Kaiser aber stand im Vordergrunde die religiöse Frage.
Karl V. stand zu dem Vorgehen Luthers anders als sein Vorgänger. Maximilian I., der 1519 starb, hatte die Anfänge der Reformation erlebt. Er fühlte eine gewisse Schadenfreude darüber, daß der römischen Kurie, mit der er nicht besonders stand, durch den Mönchshader eine große Verlegenheit erstand. Den Mönch Luther gegen den Papst auszuspielen, das war die kaiserliche Politik.
[S. 213]
Anders Karl. Er empfand den gewaltigen Zulauf, den der Wittenberger überall fand, als persönliche Kränkung. Zudem darf nicht vergessen werden, daß er, ehe er deutscher Kaiser wurde, König war des streng katholischen Spaniens. Nun war der Mönch gehört worden, er hatte nicht widerrufen. Leider mußte man ihn auf Grund des kaiserlichen Wortes ziehen lassen. Aber schon am 8. Mai erfolgte durch das Wormser Edikt seine Ächtung.
Während Luther auf dem Heimwege von Reisigen des Kurfürsten aufgegriffen und auf die Wartburg entführt wurde, gingen in Worms die Verhandlungen weiter. Noch immer kam Venne Richerdes nicht an die Reihe. In ihrer Herberge wohnte auch der Geheimschreiber des Bischofs von Hildesheim, ein Herr von Woltwiesche, der mit einigen Domherren beim Kaiser wegen Aufhebung der kaiserlichen Acht vorstellig werden sollte. Der Geheimschreiber war ein Mann von bestrickender Liebenswürdigkeit und weltmännischer Gewandtheit.
Die schöne Goslarerin machte auf ihn vom ersten Augenblick an einen tiefen Eindruck. Er hatte bald erfahren, was sie nach Worms führte, und bot ihr seine Unterstützung an zur Förderung ihrer Sache. Insonderheit erklärte er sich bereit, ein Gesuch an den Kaiser abzufassen für den Fall, daß sie nicht Gelegenheit finde, ihre Sache persönlich vorzutragen.
Ernesti sprach die bestimmte Erwartung aus, daß dies doch möglich sein werde; immerhin konnte es nichts schaden, wenn der Fall auch schriftlich geschickt behandelt wurde. Der Geheimschreiber beeilte sich also, das Gesuch niederzuschreiben, und der Ohm gestand Venne, daß es ein Meisterwerk in seiner Art sei. Venne nahm diese Dienste des Herrn[S. 214] von Woltwiesche mit gemischten Gefühlen an. Ihr gefiel der Mann nicht recht, trotz aller höflichen Zuvorkommenheit. Sie fing hin und wieder einen Blick von ihm auf, der voll glühender Begier zu sein schien. Freilich versuchte er immer sogleich mit einer harmlosen Wendung seine Ungebühr zu bemänteln. Nie vergaß er bei einem Wort, das er an sie selbst richtete, die Form peinlichster Höflichkeit und Ritterlichkeit.
Endlich kam der große Tag für Venne.
Sie war sehr befangen, als der Augenblick nahte, da sie vor den mächtigsten Herrscher des Abendlandes treten sollte. Der Oheim sprach ihr Mut zu, und auch Herr von Woltwiesche suchte sie zu beruhigen.
Der Kaiser hatte einen leidenden, gequälten Zug im Gesicht. »Was will dieses Volk der Deutschen eigentlich alles von mir?« so konnte man seinen müden Blick deuten. »Will es mich schon auf diesem einen und ersten Reichstage, den ich abhalte, mit seinen Angelegenheiten zu Tode quälen?« Immerhin bot die Sache eine Abwechselung, da zum erstenmal eine Frau als Beschwerdeführerin auftrat.
Ein Prokurator unterrichtete ihn kurz von dem Inhalt der Beschwerde. »Also soll sie reden!« ordnete er an. Aber zunächst ergriff Ernesti das Wort. Der Kaiser blickte erstaunt auf: »Wer ist der Mann?« — Ein neben ihm Sitzender, es war der Kurfürst-Erzbischof von Mainz, flüsterte ihm zu, es sei ein sehr einflußreicher Deutscher, der auch dem hochseligen Herrn Maximilian wohlbekannt gewesen und ihm manche wichtige Dienste geleistet habe. Geduldig hörte Karl ihn an. Dann erhielt Venne das Wort.
Während der Rede ihres Oheims hatte sie Zeit gefunden, sich zu sammeln. Aber noch jagten sich Erröten und tiefe[S. 215] Blässe auf ihrem Gesicht, als sie mit leiser Stimme zu sprechen begann.
Der Kaiser sah sie unverwandt an, und seine Ratgeber merkten, daß ihm die schöne Frau offensichtlich gefiel. Frei blickte auch Venne dem Mächtigen ins Gesicht. Mehr und mehr gewann ihre Stimme an Festigkeit. Sie schilderte die Demütigungen, die ihr widerfahren, die Armut, der sie durch das Verhalten des Rates von Goslar ausgeliefert sei. Zuletzt schwoll ihre Stimme zu edler Entrüstung an.
»Also klage ich den Rat der Stadt Goslar und insonderheit den Bürgermeister, Herrn Karsten Balder, an, daß sie mir und meinem Vater gegenüber fleißig und absichtlich das Recht gebeugt haben, auch üble Nachrede über meinen ehrenwerten Vater und mich ungehindert haben verbreiten lassen.
Ich bitte Euch, Großmächtigster Herr Kaiser,« schloß sie endlich, »Ihr wollet mir armen Waise Euren gnädigen Schutz nicht versagen und dazustehen, daß mein Recht gewahrt und meines Vaters Ehre wiederhergestellt werde.«
Mit einer tiefen Verneigung trat sie einige Schritte zurück. Der Kaiser blickte ihr einige Augenblicke sinnend nach. Dann besprach er sich kurz mit seinen Räten. Man sagte ihm, die Sache sei wohl juristisch nicht ohne weiteres zugunsten der Bittstellerin zu entscheiden; indes die Verdienste ihres Ohms und die Gutgläubigkeit bei den Vertragsverhandlungen, bei denen der Vater jedenfalls ohne Arglist vorgegangen war, wie auch endlich der Umstand, daß durch den Kauf des Richerdesschen Bergwerksanteils die reiche Stadt Goslar nicht wesentlich geschädigt werde, zumal man ja nicht wissen könne, ob nicht trotz der augenblicklichen Lage doch noch bergbauliche Werte darin enthalten seien, alles dieses lasse[S. 216] es mindestens zu, dem Rate dringend zu empfehlen, die Sache erneut zu prüfen und in einer die Erbin befriedigenden Weise zu Ende führe.
Karl war über diesen Vorschlag erfreut; es hätte ihm leid getan, die kühne und schöne Bittstellerin abschlägig bescheiden zu müssen. Mit leutseligen Worten eröffnete er ihr das Ergebnis, gleichzeitig mit dem Bedeuten, daß sie die schriftliche Ausfertigung schon in aller Kürze aus der kaiserlichen Kanzlei erhalten könne. Außerdem werde der Rat noch durch ein besonderes Schreiben unterrichtet werden.
Voll innigen Dankes eilte Venne zum Kaiser vor, kniete vor ihm nieder und küßte ihm die Hand mit dem großen Siegelring. Karl war überrascht, doch lächelte er ihr huldvoll zu; die Beisitzer blickten ebenso sprachlos drein: so etwas war angesichts der strengen Etikette bis dahin unerhört. Aber auch sie fanden sich mit dem hübschen Zwischenfall ab.
Aufatmend verließ Venne den Saal. Draußen fiel sie in überströmendem Dank dem Oheim um den Hals. »Das habe ich Euch in erster Linie zu verdanken, teurer Oheim!«
»Nun, nun, diese Form der Danksagung lass' ich mir schon gefallen; doch ich glaube,« fuhr er mit einem leisen Lächeln fort, »Dein spitzbübisch hübsches Gesicht hat auch ein wenig Anteil an dem Siege. Und dann vergiß auch hier den Herrn von Woltwiesche nicht, der uns manch trefflichen Wink gab!« — So reichte sie auch diesem die Hand. Ehrerbietig neigte er sich darüber und flüsterte mit leiser, heißer Stimme: »Wollte Gott, ich dürfte noch mehr für Euch tun. Mein Leben sollte ein einziges Dienen um Eure Huld sein.« Da wandte sie sich verletzt von ihm ab.
[S. 217]
Venne trat die Rückreise mit wesentlich leichterem Herzen an, als sie nach Worms gekommen war. Mit dem Spruche des Kaisers, so meinte sie, war alles Unheil ausgetilgt. Nun mußte auch der stolze Patrizier Achtermann seine Bedenken gegen eine Verbindung seines Sohnes mit ihr aufgeben. Die Wolken, die so düster und unheilschwanger über ihrem Haupte hingen, begannen sich zu zerteilen! Ihre Gedanken eilten zu Heinrich: Wo mochte er wohl sein, wenn sie zurückkehrte? Sie gestand sich ein, daß sie ihm doch wohl oft unrecht getan habe mit ihrer ewigen Verärgertheit, und sie nahm sich vor, ihn durch verdoppelte Liebe zu entschädigen.
Bis Frankfurt reiste sie zusammen mit dem Oheim. Dann nahm er Abschied von ihr, um durch das Rheintal den nächsten Weg in die Heimat zu suchen. »Jetzt herrscht hoffentlich bald wieder gut Wetter in Goslar«, scherzte er. »Übers Jahr spätestens hoffe ich eine Einladung zu Deiner Hochzeit zu erhalten.« Errötend nickte ihm Venne zu, er traf ja mit seinen Worten nur ihre eigenen, innigsten Wünsche!
Vor der Abreise empfahl er seine Nichte dem Schutze ihrer Reisegefährten, besonders dem des Hildesheimers. Woltwiesche beeilte sich, zu versichern, daß er sein möglichstes tun wolle, um ihr die Reise so bequem wie möglich zu machen. Er werde auch den kleinen Umweg über Goslar nicht scheuen, um sich zu überzeugen, daß sie heil und unversehrt zu Hause angelangt sei.
[S. 218]
Die Reisegesellschaft war klein. Neben dem Bischöflichen bestand sie aus einigen Kaufleuten und dem alten Ratsherrn Bertold Sachs aus Magdeburg. Dieser würde den Weg mit ihr bis fast in die Heimat zurücklegen. Das war Venne ein wahrer Trost.
Sie wollte dem Oheim nicht ins Wort fallen, als er den Geheimschreiber im besonderen zu ihrem Ritter ernannte. Ohne sich im einzelnen über das Gefühl ihrer Abneigung Aufschluß geben zu können, konnte sie doch diese innere Ablehnung des ganzen Mannes nicht loswerden. War es sein geschniegeltes, geziertes Wesen, stieß sie seine übergroße, fast devote Höflichkeit ab? — Sie wußte es nicht, aber sie war willens, sich ihm so fern zu halten, wie es möglich sei. Deshalb schloß sie sich auch vom ersten Tage an mehr dem Ratsherrn an, dessen väterlich gütiges Wesen ihr Vertrauen weckte.
»Sahet Ihr auch den Wittenberger?« brachte er am ersten Tage das Gespräch auf die Wormser Vorgänge. Venne bejahte und gab ihrer Bewunderung für den unerschrockenen Mönch Ausdruck.
»Euch hat es vor allem, wie es scheint, sein Mut angetan. Der war auch zum Verwundern groß; ich weiß freilich nicht, ob er sich der Gefahr bewußt gewesen ist, in die er sich begab. Er soll ja, so hört man, freies kaiserliches Geleit zugesichert erhalten haben; indes wundern würde es mich nicht, wenn der Mann seine Heimat nicht wiedersieht.«
»So meint Ihr, daß der Kaiser ihm das Wort nicht hält?« fragte sie erschrocken, denn ihrem Herzen gab es einen Stoß, daß derselbe Mann, der sich ihr so gnädig und gütig erwiesen hatte, in diesem Falle gegen seine Ehre handeln könne.
[S. 219]
»Der Kaiser braucht es nicht zu sein,« fuhr der Magdeburger fort. »Es gibt ihrer auch ohne den Kaiser genug, die ihm das Leben nicht gönnen werden, ja sie sind seine Todfeinde. Und ehe sie ihre Macht durch einen armseligen Mönch zertrümmern lassen, werden sie ihn selbst zu beseitigen suchen. Den Kaiser braucht darob nicht einmal der geringste Vorwurf zu treffen; denn wie soll er es verhüten, daß in seinem weiten Reiche ein Menschlein verschwindet. Schade freilich wäre es um diesen Mann.«
»So seid Ihr auch der Meinung, daß er eine gute Sache vertritt?« forschte sie.
»›Auch‹, — demnach hat er es Euch also angetan?« — Venne errötete ein wenig, aber der Ratsherr kam ihr zu Hilfe. »Ihr braucht Euch ob Eurer Teilnahme nicht zu schämen, noch weniger bedarf sie der Erklärung. Wer einer Wallung in seiner Brust fähig ist, dem mußte das Herz bewegt werden bei so viel tapferem Freimut und glühender Begeisterung. Ob er irrt, wer mag es wissen; aber heilige Überzeugung sprach aus jedem seiner Worte, und seine Worte haben die Herzen derer gepackt, die ihn hörten, es sei denn, daß sie sich mit Fleiß dagegen verhärteten.«
»Das trifft auch auf den Oheim Ernesti zu, wie ich merkte«, fügte Venne schüchtern ein. »Er war ganz wild, als ich ihm zu erkennen gab, daß der Luther mich erschüttert habe.« Und dann erzählte sie, wie jener ihre Begeisterung für Luther aufgenommen habe.
»Das glaube ich,« erwiderte Sachs, »hätte es bei ihm, den ich auch kenne, nicht anders erwartet. Er ist ja aber auch mit dem Papst und seiner Sache besonders eng verbunden, wie ich weiß. Und den rechten Starrkopf hat er obendrein.
[S. 220]
Endlich aber ist er, das wollet nicht vergessen, einer von den Alten, die so leicht nicht umlernen. Mir ist's ähnlich gegangen: Man wirft nicht ohne weiteres über Bord, woran man ein langes Leben sein Herz gehängt. Und vollends nun, wenn es das Beste, Heiligste ist, auf das man in dieser irdischen Kümmerlichkeit seine Hoffnung setzte.
Ihr Jungen springt vielleicht mit Jauchzen in das neue Land, aber wir Abgängigen zaudern, den einen Schritt zu tun, der uns Befreiung bringen kann von aller Unwahrhaftigkeit und Seelennot, der uns aber auch trennt von all dem, was uns an das alte Gestade kettet.
Mir ging ein treues Weib dahin, sie starb im alten Glauben. Wir begruben gemeinsam drei prächtige Kinder. Es war der Trost meiner Lebensgefährtin in ihrer Todesstunde, daß sie da oben ihre Lieblinge wiederfinden würde. Sie wartet auf mich mit gleicher Zuversicht. Soll ich sie, darf ich sie enttäuschen? Scheide ich mich für ewig von ihnen, wenn ich den neuen Glauben annehme? Meine Seele drängt zu Luther, mein Herz bebt zurück vor der möglichen Trennung. Wer löst mich von der Pein?«
Wer löst mich von der Pein? — Das war auch die Last, die ihr eigenes Herz bedrückte: Der Vater, die Mutter, sie hatten nacheinander den Pilgerstab aus der müden Hand gelegt und waren durch das dunkle Tor gegangen, das ihnen, wie sie glaubten und hofften, das Wiedersehen in einer lichten Welt schenken würde. Und sie, die Tochter, sollte sie nicht zur Seite ihres Mütterleins stehen, nicht mit dem geliebten Vater die seligen Freuden des Jenseits genießen dürfen? Und noch ein irdisches Bangen hemmte ihren Entschluß: Der Geliebte. Die Achtermanns hingen noch mit aller Zähigkeit am alten Glauben, und Heinrich?[S. 221] Ja, Heinrich liebte sie, und sie hoffte, in Worms die Hindernisse aus dem Wege geräumt zu haben, die sich ihrer Vereinigung entgegenstellten. Errichtete sie nicht eine neue, unübersteigbare Schranke, wenn sie der Regung ihres Innern nachgab? Und dann auch wieder der Zweifel: War das nun auch der rechte Weg? Freilich, gedachte sie der feurigen Worte des Mönches, sah sie seinen weltentrückten Blick vor sich, so fühlte sie sich als seine Jüngerin, und auch in ihr klang es wieder: »Ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!«
Der Ratsherr sah die Kämpfe in ihrem Innern; das junge Weib dauerte ihn, aber Hilfe konnte auch er ihr nicht bringen. »So ist es nun,« murmelte er, »Licht will er uns bringen, Erlösung, der Feuerkopf, und stürzt uns doch in das Dunkel der Herzenskämpfe!« Und er ritt, in ernste Gedanken versunken, fürbaß.
Venne und ihre Begleiter waren eine geraume Zeit nach Luther von Worms aufgebrochen. Er saß längst auf der Wartburg in sicherm Gewahrsam, als man ihn im Reich noch frei wähnte.
In der Umgegend des Überfalls aber, der von Freunden zu seiner Sicherheit ausgeführt wurde, lief das Gerücht um, der Mönch sei aufgehoben und fortgeführt worden, von den Kaiserlichen natürlich, oder Papisten, so wähnte man. Andere wieder mutmaßten, es sei eine Finte, die von Freunden und Gesinnungsgenossen ins Werk gesetzt worden sei, um die Feinde irrezuführen.
Auch die Reisenden erreichte das Gerücht, als sie sich der Grenze des Hessenlandes näherten. Venne war tief niedergeschlagen. Sachs seufzte auf.
»So haben sich meine Befürchtungen schneller erfüllt, als[S. 222] ich annahm. Schade um den Mann! — So schnell also erlosch das Licht, das uns in der Finsternis aufging!«
Bei Venne brach sich der Zorn Bahn. »Das ist abscheulich vom Kaiser, wenn er es veranlaßt hat. Nie hätte ich ihm diese Doppelzüngigkeit zugetraut!«
»Es muß ja nicht der Kaiser gewesen sein«, begütigte der Ratsherr. »Ich sagte Euch: die anderen, die Päpstlichen, sind ihm noch viel ärger gram. Endlich bleibt noch die geringe Hoffnung, daß die recht haben, die da meinen, nicht Feinde, sondern gute Freunde hätten ihn zu seinem Besten den Streich gespielt. Möge es so sein,« schloß er, »sonst ist der Menschheit ein großer Verlust widerfahren.«
»Möchte es so sein!« — das wünschte auch Venne in ihrem Herzen, und ihr Gebet am Abend schloß mit der innigen Bitte: »Lieber Gott, erhalte uns den Mann und errette ihn vor seinen Widersachern!«
Während der ersten Tage war der bischöfliche Schreiber durchaus der aufmerksame Reisemarschall, der sich bemühte, der ihm Anvertrauten das Reisen so angenehm wie möglich zu machen. Aber als in Fulda einige der Reisegefährten zurückblieben und sie nunmehr auf den alten Sachs aus Magdeburg neben Woltwiesche angewiesen war, von dem Diener des Ratsherrn abgesehen, änderte sich sein Benehmen. Daß er den ganzen Tag über fast unausgesetzt an ihrer Seite zu bleiben suchte, konnte er mit dem Auftrage des Oheims begründen, auf seine Nichte Obacht zu geben. Doch er mißbrauchte jede Gelegenheit, um ihr seine Gefühle[S. 223] für sie immer eindeutiger zu zeigen. Für eine andere hätte vielleicht diese Art der Huldigung seitens des adligen Schreibers einen Reiz gehabt, aber Venne, der auch der ganze Mann widerstand, empfand sie als eine Belästigung. Als er ihr dann eines Tages unverblümt seine Neigung gestand, ließ sie ihn sehr ungnädig ablaufen.
Ihre Ablehnung aber stachelte seine Glut noch mehr an. »Was habt Ihr gegen mich?« fragte er. »Kann ich Euch nicht ein angenehmes Leben bieten mit einer Stellung, welche die Eurige in Goslar weit überragt? Und es muß Euch doch auch daran liegen, aus der leidigen Stadt herauszukommen, wo Euch alles auf Schritt und Tritt an erlittene Kränkungen erinnert. Folgt mir nach Hildesheim, Ihr werdet es nicht bereuen.«
»Spart Eure Worte, Herr von Woltwiesche, sie sind vergebens gesprochen, und sie beleidigen mein Ohr. Wollt Ihr aber den Hauptgrund meiner Ablehnung wissen, so denkt an die Äußerung meines Oheims. Ihr wißt, ich bin verlobt, und Ihr habt die Rechte eines Dritten zu achten.«
»Der Teufel hole diesen Dritten, der Euch mir vorweg stahl. Hat er sich um Euch gekümmert, als Ihr in Worms um Euer Recht kämpftet? Ich stand Euch zur Seite, er nicht!« antwortete er grollend.
»Es ist nicht vornehm von Euch gehandelt, mir Eure Dienste, die ich zudem nicht beansprucht habe, so ins Gesicht zu rühmen. Aber meinem Bräutigam tut Ihr unrecht. Hätte er gekonnt, so würde er gewiß dort nicht gefehlt haben. Doch er ist zur Zeit außer Landes«, wies sie ihn zurecht.
»Ha, ha, ha,« lachte der Schreiber höhnisch, »das ist mir der rechte Liebhaber, der auf Reisen geht, während die Braut um ihr Leben kämpft!«
[S. 224]
Zornig fiel ihm Venne ins Wort: »Was erfrecht Ihr Euch, Herr, so über den Mann zu sprechen, dem ich verlobt bin! Was wißt Ihr von den Gründen, die ihn fernhalten? Dankt Eurem Schöpfer, daß er nicht hier ist, Eure Rede würde Euch schlecht zu stehen kommen.«
Da in diesem Augenblick der Ratsherr, der vorangeritten war, hielt, um sich nach ihr umzusehen, brachen sie das Gespräch ab, der Geheimschreiber voller Unwillen, über Venne wie über den Störenfried. Sie hielt sich künftig, soweit das ging, noch mehr in der Nähe des älteren Begleiters. Der Schreiber erkannte ihre Absicht und knirschte mit den Zähnen, voller Wut, daß seine Absicht durchkreuzt wurde. Er war durch die Worte Vennes nicht abgeschreckt, sondern wartete nur auf einen günstigen Augenblick, um seine Pläne wiederaufzunehmen.
Diese Gelegenheit bot sich erst einige Tage später, als man schon in die Nähe des Harzes gekommen war. Unversehens drängte er sein Pferd an das ihrige, und als sie es, unwillig über die erneute Frechheit, antrieb, fiel er ihr in den Zügel.
»Ihr müßt mich anhören, und Ihr werdet mich hören«, sprach er entschlossen und mit wildglühendem Blick.
Venne war erschrocken über die lodernde Gier, die ihr aus seinem Auge entgegenfunkelte; doch sie bezwang ihre Furcht und fragte spöttisch lächelnd: »Habt Ihr an der Absage von neulich noch nicht genug? Ich meine, Eure Würde als Edelmann sollte Euch abschrecken, eine neue Demütigung zu erleiden.«
Aber unbeirrt fiel er ihr ins Wort: »Laßt den Hohn, Venne, Ihr wißt nicht, welch gefährlich Spiel Ihr treibt. Ihr habt es mir angetan, daß ich nicht von Euch lassen[S. 225] kann. Könntet Ihr in mein Herz sehen, so würde Euch mein jämmerlicher Zustand allein schon Mitleid einflößen. Stoßt mich nicht zurück, Venne, Ihr treibt mich sonst zum Äußersten.«
»Ich kann meinem Herzen nicht gebieten, daß es Euch gewogen sein soll«, wehrte Venne ab. »Schämt Euch, daß Ihr Euch von einer flüchtigen Regung des Augenblicks so knechten laßt, um darüber zu vergessen, was eines Mannes und Ritters würdig ist.«
In ihrer Entrüstung erschien sie ihm nur noch schöner und begehrenswerter. Das Blut stieg ihm in den Kopf, und er verlor die Besinnung über sich.
»Was schiert mich Rittertum, was Manneswürde, Dich will ich haben, Du schönstes Weib!« Damit beugte er sich zu ihr herüber und riß sie an sich. Venne fühlte seine Lippen auf ihrem Munde brennen. Aber im nächsten Augenblick riß sie sich los. Zornbebend blitzte sie ihn an und schlug ihn mit der Reitgerte ins Gesicht. »Schuft!« rief sie ihm zu, dann sprengte sie davon zu den übrigen.
Einen Augenblick war der Gezüchtigte wie betäubt, dann aber brannte ihn die Schmach, die er erlitten. »Das sollst Du mir büßen, Teufelsweib! Verschmähst Du meine Liebe, so soll Dich meine Rache um so sicherer treffen!«
Den Ratsherrn bat Venne, mit ihr künftig allein weiterzureisen, da der Geheimschreiber sich ungebührlich gegen sie benommen habe. Sachs wollte jenen zur Rede stellen, aber Venne hieß ihm, davon abzulassen. »Wir wollen voranreiten, er wird uns nicht folgen.« So geschah es.
[S. 226]
Bei ihren Freunden und besonders bei der alten Katharina herrschte freudige Überraschung, als Venne in Goslar wieder eintraf. Kurz vor dem Ende ihrer Reise erlebte sie noch ein Abenteuer, das sich böse anließ, aber doch harmlos verlief. Sie hatte für den letzten Teil des Weges Gesellschaft und Schutz an einer Anzahl von Reisenden gefunden, die über Goslar weiter nach dem Osten wollten.
Jenseits des Städtchens Seesen, wo die Straße am Fuße der Harzberge dahinzog, wurden sie plötzlich am hellen Tage von bewaffneten Reitern angehalten. Da die Angegriffenen sich zur Wehr setzten, wäre es gewiß zu einem Blutvergießen gekommen. Als die Männer noch in erregtem Wortwechsel begriffen waren, trat plötzlich ein neuer Ankömmling auf, der sich durch seine Kleidung von den Angreifern vorteilhaft unterschied. Überrascht sah er auf die schöne Frau, die erblaßt inmitten des Tumultes stand.
Er war der Anführer oder besaß jedenfalls das Ansehen eines solchen, denn bei seinen ersten Worten gehorchten die wilden Männer sogleich. »Hört auf«, befahl er. »Die Leute sollen ungestört weiterziehen.«
Als einer der Räuber nicht sogleich von seiner Beute abließ, fuhr er ihn mit harten Worten an:
»Wirst Du Schuft gehorchen, oder willst Du meine Klinge spüren?«
Sofort stand der Mann von seinem Vorhaben ab. Die[S. 227] Wegelagerer sahen sich erstaunt an: Was war denn in den gefahren? Das war ja das erstemal, daß er ihnen einen schon gelungenen Fang entgehen ließ. Sie murrten leise untereinander, aber, ihm gegenüber an blinden Gehorsam gewöhnt, zogen sie ab.
Die Reisenden wollten für die unerwartete Hilfe danken, doch er wehrte ihnen ab. Sein Auge hing immer noch an Venne: »Vergebt, schönes Fräulein, so darf ich Euch doch nennen, daß Ihr die Belästigung erleiden mußtet; haltet es dem Mangel an Umgang mit Damen zugute, wenn sie sich ungeschliffen und tölpelhaft benahmen. Aber Ihr seht ja, es sind im Grunde nur ungeleckte Bären.«
Nun die Gefahr vorüber war, gewann auch Venne ihre Fassung wieder. Die Sache kam ihr beinahe belustigend vor, und sie antwortete mit einem Lachen: »Ich möchte aber doch diesen Bären nicht begegnen, wenn ihr Führer fehlt. Euch gebührt jedenfalls mein Dank, daß Ihr Euch zur rechten Zeit einfandet, um sie tanzen zu lehren statt zu brummen. Doch ist es nötig, daß ich meinen Dank an Herrn ›Niemand‹ richte, oder darf man Euren Namen wissen, ohne neugierig zu sein?«
»Wollet gestatten, Fräulein, daß ich für Euch der Herr ›Niemand‹ bleibe. Was ist ein Name? Ich führe ihrer viele. Der eine aber, den ich Euch nennen könnte, würde Euch wahrscheinlich schrecken. Also begnügt Euch mit dem Bewußtsein, daß Ihr einem Abenteuer anheimfielet, bei dem ein Unbekannter Euch geringe Dienste leisten konnte, ein Unbekannter,« fuhr er leiser fort, »dem es Eure Schönheit auf den ersten Blick antat und der vieles darum geben würde, könnte er Euch einmal in einer wirklich großen Not beistehen. Ich will nicht hoffen, daß ein solcher Augenblick[S. 228] eintritt. Aber habt Ihr einen Helfer nötig, so ruft mich, und ich bin zur Stelle.«
Venne hörte dem Unbekannten mit einer gewissen Neugier zu. Merkwürdig, die freimütige Art, in der er ihr huldigte, verletzte sie nicht annähernd so, wie die zierlichen Redewendungen des Herrn von Woltwiesche es von Anfang an getan hatten. Sein offener Blick schien trotz des düsteren Handwerks, mit dem er in Verbindung stand, nichts Falsches zu kennen. Als er geendet hatte, sagte sie, immer noch in einem fröhlichen, freundlichen Ton: »Aber wo finde ich denn den Herrn Unbekannt, wenn ich ihn nötig habe?«
Der Fremde neigte sich zu ihr: »Dann fragt nur bei den Brüdern im Kloster zum Grauen Hofe nach; dort wird man Euch bescheiden können. Ihr seht also,« schloß er scherzend, »ich bin nicht immer in so verwahrloster Gesellschaft.«
Als Venne den Goslarer Freunden von ihrem Abenteuer berichtete, wobei sie das Verhalten des Führers, oder was er gewesen, rühmend hervorhob, sagte Johannes Hardt sogleich: »Das war Hermann Raßler. Der hat gewiß geglaubt, uns wieder einen Tort antun zu können. Und Du darfst froh sein, daß Du als Goslarerin so glimpflich davonkamest.« Venne widersprach: »Ich glaube, daß er mich auch gleich ritterlich behandelt haben würde, hätte er gewußt, wer ich bin.«
Die Freude über ihre glücklich erfolgte Heimkehr erlitt einen jähen Stoß, als sie von dem Unfall hörte, der Heinrich Achtermann vor seiner Abreise betroffen hatte. Und sie war vollends entsetzt, als sie die Einzelheiten vernahm, die ihn herbeiführten. Tränen der Scham und der Verzweiflung füllten ihre Augen. »Wie konntest Du mir das antun, Katharina! Nun ist alles aus zwischen Heinrich Achtermann[S. 229] und mir. Was wird er gedacht haben, daß ich ihn an mich kuppeln wollte, wie eine feile Dirne sich ihren Liebhaber sichert!«
Katharina war untröstlich über den Schmerz, den sie, die es doch so gut gemeint hatte, ihrer Herrin bereitete. »Aber ich habe ja längst versucht, die Sache richtigzustellen und will gern mit dem Ratsherrn selbst sprechen, wenn Du es verlangst«, wimmerte sie.
Doch Venne wehrte ab: »Laß um Gottes willen Deine Hände davon. Du würdest nur noch mehr verderben, als schon geschehen ist. Was noch zu tun ist, liegt mir selbst ob.«
Entrüstet und bekümmert erzählte sie den Hardts, was Katharina angerichtet habe. Diese hatten davon noch nichts gehört. Achtermann mußte also verboten haben, darüber zu sprechen. Johannes wollte darin ein günstiges Zeichen sehen, doch Venne teilte diese Auffassung nicht. »Ihr kennt den Mann nicht in seinem Starrsinn, der an Bosheit grenzt. Wäre wenigstens Heinrich da, daß ich mich vor ihm rechtfertigen könnte, dann möchte es sich vielleicht noch zurechtgeben. Aber aufgeklärt werden muß die Sache, und da ich beschuldigt bin, werde auch ich selbst diese Aufklärung herbeiführen.«
Daneben erhob sich die Frage, wie nun ihre Angelegenheit mit dem Rat behandelt werden müsse. Johannes Hardt stellte sich ihr zur Verfügung, riet aber, abzuwarten, bis das Schreiben des Kaisers eingetroffen sei. Inzwischen führte Venne ihren Vorsatz aus und suchte den Ratsherrn Achtermann auf. Es bedurfte ihrer ganzen Willenskraft, um nicht im letzten Augenblick umzukehren. Denn das Bewußtsein, daß sie dem Manne gegenübertreten sollte, der für das Scheitern ihres Lebensglücks verantwortlich zu machen war,[S. 230] lastete mit erdrückender Schwere auf ihr. Sie hatte einige Zeit zu warten, bis der Gefürchtete und beinahe Verhaßte durch eine kleine Seitentür ins Zimmer trat. Sein kühler, abweisender Blick sagte ihr, daß sie nichts Gutes von ihm zu erwarten habe.
»Wie komme ich zu der zweifelhaften Ehre, Euch in meinem Hause zu sehen?« fragte er mit schneidender Kälte. Venne schoß das Blut ins Gesicht.
»Ihr habt kein Recht, mich in dieser verletzenden Art und Weise zu empfangen, Herr Achtermann«, antwortete sie, sich mühsam beherrschend. »Ohne triftigen Grund sähet Ihr mich freilich nicht hier. Aber ich will mich gegen Verleumdungen verteidigen, die man über mich in meiner Abwesenheit in Umlauf setzte und an denen auch Ihr, wie ich höre, nicht unbeteiligt seid.«
»Ich bin gespannt auf diese Verteidigung, wenngleich sie vor mir wenig angebracht ist«, sagte er mit unverändertem Hohn.
Venne beteuerte, daß sie von dem ganzen Vorhaben nichts gewußt und erst jetzt davon gehört habe, zu ihrer großen Beschämung.
»Ihr müßt schon einen Dümmeren suchen, als Ihr in mir findet, der Euer Märlein glaubt. Euch auf die Harmlose hinauszuspielen, steht Euch schlecht an.«
Da verließ auch Venne die Ruhe: »Daß Ihr ein hartherziger Vater waret, wußte ich. Daß ihr ein elender Verleumder und Ehrabschneider seid, erfahre ich zur Stunde. Ich will nicht um Eure Gnade betteln. Sagt mir nur noch eins auf Euer Gewissen: Teilt Euer Sohn Eure Meinung von mir?«
Dem Ratsherrn schwoll bei den kühnen und furchtlosen[S. 231] Worten des Mädchens die Zornesader. »Hütet Euch, mich noch zu reizen, Jungfer Richerdes; es möchte Euch teuer zu stehen kommen. Noch bewahre ich Eure Tat bei mir. Gebt mir nicht Anlaß, sie der Öffentlichkeit preiszugeben; es möchte Euch wenig frommen. Und was meinen Sohn anbetrifft, so könnt Ihr Euch sein Urteil selbst ausmalen. Eins sollt Ihr wenigstens wissen: Ehe Ihr in mein Haus als Schwieger einzieht, töte ich meinen Sohn mit eigener Hand. Aber daß das nicht nötig ist, dafür laßt mich allein sorgen.«
Venne war leichenblaß geworden. »Ich danke Euch trotz allem für Eure Mitteilung. Nun sehe ich wenigstens klar, und Ihr mögt unbesorgt sein, daß ich Euer Haus je wieder betrete; doch für Eure Kränkungen und Beleidigungen«, fuhr sie mit erhobener Stimme fort, »sollt Ihr mir Rechenschaft geben, Herr Achtermann!«
»Versucht das lieber nicht«, antwortete er grollend. »Seid froh, wenn ich Euch dazu nicht auffordere. Ich warne Euch vor unbedachten Schritten; es geht dabei um mehr, als Ihr zu wissen scheint oder wissen wollt.«
Zornbebend verließ Venne das Haus. Sie vermochte kaum die Tränen der Wut und der Empörung zurückzuhalten. Zu Hause aber ließ sie ihrem Schmerz und ihrer Verzweiflung freien Lauf. Es überfiel sie ein Weinkrampf, und ihre klagende Stimme gellte durch das leere Haus. Die gute Katharina wußte sich keinen Rat, und sie weinte aus Erbarmen ebenfalls zum Herzzerbrechen.
Zufällig kam Gisela Hardt um diese Stunde. Sie war zunächst ratlos gegenüber dieser wilden Verzweiflung, ihrem milden Trost und Zuspruch gelang es doch zuletzt, Venne etwas zu beruhigen. Sie hielt die Unglückliche in ihrem Arm und tröstete sie, wie man ein weinendes Kind[S. 232] zur Ruhe bringt. Als sie schied, ging sie mit schwerem Herzen davon. Denn hier versagte zuletzt wirklicher Trost, der auch das Mittel zur Heilung anzugeben weiß.
Als die Botschaft aus Worms eingetroffen war, erhielt Venne eine Vorladung vor den Rat. Sie fühlte sich durch den Vorgang im Hause des Ratsherrn so zermürbt, daß ihr alles gleichgültig geworden war. Aber jetzt feuerte Johannes Hardt sie an, ihr Recht zu wahren. Er erbot sich, ihr mit allen seinen Kräften zur Seite zu stehen, und er hielt dieses Versprechen auch ehrlich bis zuletzt, auf die Gefahr hin, daß sein mannhaftes Eintreten ihm für seine weitere Laufbahn schaden könne.
Das kaiserliche Schreiben an den Rat war maßvoll gehalten, und es ließ die Verhandlung zwischen beiden Teilen zu. Man erwog das Für und Wider, und schon schien es, als ob die Angelegenheit eine für Venne befriedigende Lösung finden werde. Da machte Achtermann alle Geneigtheit zunichte durch seinen rücksichtslosen Widerspruch. Er bewies noch einmal, daß sich die rechtliche Grundlage nicht zugunsten des Richerdesschen Anspruches geändert habe, und forderte unter Hinweis auf die Folgen eines solchen Präzedenzfalles Zurückweisung des Anspruches trotz des kaiserlichen Schreibens. Sein Einfluß siegte, und Venne erhielt den Bescheid, daß man nicht gesonnen sei, zu zahlen.
Das Geld würde sie verschmerzt haben, wenngleich sie für die Zukunft bitterer Armut ausgesetzt war. Daß es ihr jedoch nicht gelingen sollte, die Ehre ihres Vaters rein zu waschen, das erfüllte sie mit namenlosem Zorn. Sie hockte in ihrem Zimmer, allein mit ihrer Verzweiflung und ihrem Grimm. Immer wieder stiegen ihr die Tränen auf in Erinnerung an all die Schmach, die man ihr angetan, und das[S. 233] Unglück, das sie unschuldig traf. Johannes Hardt wies sie zurück, und auch Gisela vermochte mit ihrem sanften Trost nichts über sie. »Laßt mich, Ihr könnt mir nicht helfen. Ich muß versuchen, allein durchzukommen.«
Sie berührte kein Essen, immer tiefer fraß sie sich in ihre verbissene Wut. Von aller Welt kam sie sich verlassen vor, verhöhnt, gehetzt; es war die richtige Stimmung, um den Menschen zu verzweifelten Schritten zu verleiten.
In dieser Stimmung besann sie sich der Worte jenes Fremden, der Hermann Raßler sein sollte. Er haßte gleich ihr den Rat von Goslar. Bei ihm würde sie Verständnis für ihre Lage finden. So machte sie sich auf den Weg zu dem in Waldeseinsamkeit gelegenen Kloster der Grauen Brüder, dem heutigen Grauhof.
Man war dort über ihren Prozeß unterrichtet, und es schien, als ob auch der Fremde schon von ihrer Lage gehört hatte, denn er hatte genaue Anweisung für den Fall gegeben, daß Venne Richerdes nach ihm frage.
»Ihr trefft, den Ihr sucht, in Wolfenbüttel in der Herberge zum ›Anker‹. Fragt dort nach Herrn Starke, so wird Euch weitere Auskunft werden.«
So trat Venne die Reise nach der herzoglichen Residenz an. Daheim und den Freunden gegenüber verschwieg sie alles, was sie vorhatte.
[S. 234]
Im Schlosse zu Wolfenbüttel residierte Herzog Heinrich der Jüngere, wenn er nicht mit seinen Reisigen im Felde lag gegen den Hildesheimer Bischof, gegen die Vettern seines eigenen Stammes im Kalenbergschen, im Göttinger Lande oder wo immer Bellona einen Vorteil verhieß und die Austragung alter Gegensätze erlaubte. Die Mauern und Wälle der guten Stadt Wolfenbüttel dünkten ihm und seinen Vorfahren noch nicht Schutzes genug gegen Gelüste, sich an seiner fürstlichen Person zu vergreifen.
Dem Rat von Braunschweig, wie jedem einzelnen Braunschweiger, traute er ohne weiteres die Frechheit zu, daß sie, wenn sie es vermöchten, ohne ehrerbietigen Gruß bei ihm eindringen und ihn als gute Prise mit sich schleppen würden. So war das Schloß, das sich als ein gewaltiges Gebäudegeviert um einen kleinen Binnenhof lagerte, noch wieder eine Festung für sich, umspült von dem breiten Graben eines Okerarmes und in sich geschützt durch mächtige Mauern und starke Türme, an denen sich diejenigen, die dennoch die Stadt bezwungen hätten, erst noch ihre Dickköpfe einrennen mochten, ehe sie vor ihm selbst mit ihren unhöflichen Forderungen auftreten konnten.
Im Schlosse selbst lag eine starke Guardia, eine Leibwache, einquartiert, unter dem Befehl eines Hauptmanns. An den zwei Toren, die den Einlaß zum Hofe und zum inneren Schlosse freigaben, standen Wachen, die jeden Ein- und Ausgehenden auf seine Zuverlässigkeit hin musterten.[S. 235] Ohne genügenden Ausweis gelangte kein Fremder durch das Tor.
Der Ankömmling, der in diesem Augenblick die Wache unangehalten passierte, mußte also allen wohlbekannt sein, denn weder machte er Anstalt zu einer Legitimation, noch wagte einer der Wachleute ihn zu befragen. Auf dem Kopfe trug er eine dunkle Lederkappe, die mit einem Reiherstoß geschmückt war. An der Seite hing ihm in goldverziertem Gehänge der Degen.
Die Wachen sahen ihm mit schlecht verhehltem Neide und Unwillen nach. »Das spreizt sich, als ob er des Herzogs leibhaftiger Vetter wäre«, murrte der Korporal Schünemann, der Wachthabende, zu dem Doppelsöldner Karsten Süßkind. »Unsereiner ist Luft für den Herrn, als ob man nicht mit Ehren seine Kampagnen hinter sich hätte.«
»Er ist ja auch mehr als Ihr und ich, Korporal«, höhnte Süßkind. »Wir beide haben es noch nicht zum Hauptmann gebracht. Möchte freilich nicht mit ihm tauschen, denn zum Räuberhauptmann ist sich meiner Mutter Sohn doch zu schade.«
»Der Herr Herzog nimmt aber keinen Anstoß daran,« mischte sich ein dritter ein, »ebensowenig wie der Herr Kriegsrat Tewes, der ja oft mit ihm konferiert.«
»Herzog Heinrich wird schon seine Gründe haben, weshalb er den Raßler so oft bei sich sieht,« verteidigte der Korporal seinen Herrn, »und er wird mit dem Manne sich nicht weiter einlassen, als sein Interesse es fordert.«
Der, von dem die Rede war, bog indes rechts ab in das Schloß und stieg die Treppe hinauf. Er mußte genau Bescheid wissen, denn er fand sein Ziel, ohne jemand zu fragen. An dem Zimmer, in welchem der Geheime Kriegsrat[S. 236] Tewes über Akten und Plänen saß, klopfte er kurz an und trat auf das »Herein« sofort mit energischem Schritt ein. Tewes blickte auf. Er ging dem Ankömmling sogleich entgegen. »Sieh da, Herr Raßler,« sagte er höflich, »das trifft sich gut. Wir hatten Sehnsucht nach Euch«, setzte er scherzend hinzu.
Der Herr Kriegsrat galt als hochmütig, und es sprach für die Wertschätzung, welche Herr Raßler in dem Schlosse genoß, wenn er ihm das Prädikat »Herr« zuerkannte.
»Da treffen sich die Wünsche gegenseitig,« entgegnete Raßler, »denn auch mich trieb es hierher.«
»Famos, famos,« hüstelte das vertrocknete Männchen, »da können wir gleich ›in medias res‹, wie der Lateiner sagt, gehen.«
»Nicht doch, Herr Tewes,« unterbrach ihn Raßler kurz. »Dieses Mal will ich zuvor mit dem Herzog sprechen. Nachher stehe ich Euch zur Verfügung.«
Es gab dem Höfling einen Stich durch das Herz, daß der Unverschämte den ihm gebührenden Titel einfach unterschlug; aber er wußte, was der Mann beim Herzog galt, der ein für allemal angeordnet hatte, ihn recht glimpflich zu behandeln. So zwang er seinen Unwillen nieder und sagte höflich: »Der Herr Herzog sind im Augenblick sehr beschäftigt und würden eine Störung unliebsam empfinden. Vielleicht kommt Ihr zu gelegener Stunde morgen wieder.«
»Ich denke, Ihr habt Euch nach mir gesehnt, Herr Rat,« fragte Raßler spöttisch, »da darf doch keine Minute verloren werden; und denkt Euch, was ich auf dem Herzen habe, erlaubt auch keinen Aufschub.«
»So will ich versuchen, den Herrn zu melden«, fuhr Tewes gekränkt fort.
[S. 237]
»Tut das, Herr Tewes, aber nehmt es nicht übel, wenn ich alsdann allein mit dem Herzog zu sprechen wünsche.«
Raßler fand den Herzog mit einem Apparat beschäftigt, der sein ganzes Interesse in Anspruch nahm.
»Sieh da, der Raßler«, sagte er mit kurzem Aufblicken. »Wartet ein Weilchen; ich bin dabei, diese wunderbare Einrichtung zu studieren. Wißt Ihr, was es darstellt« fragte er dann, während seine Hände noch immer an Schrauben und Rädchen drehten und stellten.
»Es muß wohl mit den Sternen zu tun haben, wie ich sehe. Wohl eines der neumodischen Dinger, von denen man jetzt so viel reden hört«, antwortete Raßler.
»Ganz recht,« fiel ihm Heinrich ins Wort, »es ist ein Astrolabium, mit dem man sich und anderen das Horoskop stellt, um das eigene oder fremde Schicksal zu erkunden. Wäre es Abend, so könnte ich Euch ansagen, was Eurer harrt.«
»Ich danke, Ew. Gnaden«, antwortete Raßler. »Gebt Euch die Mühe nicht. Mich verlangt es nicht, im voraus zu wissen, was aus mir wird. Das nimmt nur die Sicherheit und trübt den Blick.«
»Wie Ihr wollt, wie Ihr wollt«, sagte der Herzog etwas gekränkt, daß der Besuch so wenig Gewicht auf seine Neuerwerbung legte. »Mir ist es jedenfalls von hohem Wert, daß ich im voraus weiß, woran ich bin. Ich finde mich leidlich mit dem Apparat zurecht. Lieber freilich wäre es mir, ich hätte einen tüchtigen Astrologen, der würde mir alles noch zuverlässiger deuten können.«
»Vielleicht bleibt mir einmal ein solches Menschenkind im Netz, dann bringe ich ihn spornstreichs hierher.«
»Sehr gut,« erwiderte Heinrich, »und Ihr könnt unseres[S. 238] Dankes sicher sein. Übrigens«, fuhr er fort, »kommt Ihr wie gerufen, wir hatten uns schon nach Euch erkundigt, haben eilige Arbeit für Euch.
Da ist die Hildesheimer Sache. Die will nicht recht vom Fleck. Ihr wißt ja, wir haben die Reichsacht auszuführen gegen den störrischen Bischof. Sehr ehrenvoll, uns den Auftrag zu geben, aber die Mittel zu finden, überließ man großmütig uns. So sitzt der Herr mit seinem Krummstab ruhig in Hildesheim und lacht uns aus. Der vertrackte Rat von Goslar leistet nur widerwillige und mangelhafte Hilfe. Werden uns der Herren Pfeffersäcke wieder einmal etwas annehmen müssen, um sie kirre zu machen. Inzwischen sollt Ihr uns helfen, sollt dem Bischof mit Euren Leuten eine Laus in den Pelz setzen, daß er sich vor Jucken nicht zu helfen weiß.«
»Ich stehe Euch zu Diensten, Herr Herzog«, antwortete Raßler. »Ich habe gerade einen tüchtigen Wurf entschlossener Männer zur Hand, mag sich wohl rund auf ein Fähnlein belaufen. Doch ich habe dieses Mal auch einen besonderen Wunsch an Eure Gnaden.«
Der Herzog, der fürchten mochte, daß er besonders zahlen solle, wehrte ab.
»Ihr wißt, Raßler, daß bei dem Handel für uns nichts weiter als die Ehre abfällt. Eure Leute mögen sich am Beutemachen schadlos halten.«
Aber Raßler entgegnete: »Ihr irrt, Herr Herzog. Mir selbst ist es zeitlebens wenig um Schätze zu tun gewesen. Wo ich zuschlug, hatte es andere Gründe. Doch ich bin es müde, wie ein Wegelagerer durch das Land zu fahren. Ich habe mich immer als ein ehrlicher Kriegsmann gefühlt und als solcher gehandelt. An meinen Händen klebt kein Blut, das[S. 239] nicht in ehrlichem Kampfe Mann gegen Mann verspritzt wäre, und auch meine Leute hielt ich an, so zu verfahren. Taten sie es nicht immer, so ist es mir leid, und wo ich es erfuhr, bin ich übel dreingefahren, das dürft Ihr mir glauben. Nun aber bin ich der Sache überdrüssig. Und ich will fürderhin auch äußerlich sein, was ich innerlich immer gewesen bin. Kurz, ich bitte Euch, Herr Herzog, leiht mir Euren Beistand dazu und macht mich zu Eurem Hauptmann.«
Der Herzog war überrascht. Das zu hören, hatte er nicht erwartet. Aber die Sache kam ihm sehr ungelegen. »Das wird doch seine Schwierigkeiten haben. Seht, Raßler, wir haben doch Rücksichten zu nehmen. Ihr wißt doch ...«
»Ich weiß, Herr Herzog.« fiel ihm jener ins Wort, »daß ich als Räuberhauptmann gelte. Doch Ihr habt nie Bedenken gehabt, mit diesem zu verhandeln, und ließet Euch seine Dienste gern gefallen. Kommt es zuletzt auf den Namen an und erscheint Euch der Name ›Raßler‹ zu abgenutzt, nun, Ihr habt Vollmacht und Namen genug, um einen solchen auszuwählen, mit dem sich Euer neuer Hauptmann sehen lassen kann.«
»Aber das ist ja Unsinn, den Namen ändern, Hauptmann werden«, zürnte der Herzog. »Plagt Euch denn der Ehrgeiz auf einmal, daß Ihr etwas Besonderes prästieren wollet, oder hat es sonst einen Grund?«
»Einen Grund hat es schon,« antwortete der Gefragte, »aber Ehrgeiz ist es nicht oder doch nur zu einem Teil.«
»Nun so wird er auch wieder vergehen«, meinte Heinrich. »Über ein kurzes werdet Ihr selbst über Euren Unsinn lachen.«
[S. 240]
»Seid überzeugt, Herr Herzog, daß ich das nicht tun werde. Und nun Eure Antwort.«
»Und wenn ich ›Nein‹ sage?« forschte Heinrich.
»So müßt Ihr Euch zur Stunde einen anderen suchen, der Euch hilft. Ich rühre keine Hand mehr für Euch.«
»Teufel,« fluchte der Fürst, »das nenne ich dreist. Ich kann Euch zwingen und werde Euch zwingen, zu gehorchen.«
»Das glaubt Ihr selbst bei Hermann Raßler nicht, Herr Herzog«, fiel jener spöttisch ein. »Also noch einmal, Eure Antwort! Erfüllt meine Bitte, und Ihr sollt Eure Freude an mir haben. Der Herr Bischof soll fluchen lernen, als ob er nie das Vaterunser gebetet habe, und Eure Freunde in Goslar sollen sich ärgern, daß sie platzen. Mit ihnen habe ich zwischendurch sogar noch ein besonderes Stücklein zu erledigen. Aber erst Eure Antwort!«
»So schert Euch an die Arbeit. Ist sie getan, so werde ich Euren Wunsch erfüllen.«
»Euer Wort?« versicherte sich Raßler.
»Auf mein Fürstenwort«, antwortete Heinrich. Da ging Hermann Raßler vergnügt davon.
Im »Anker« erfuhr Raßler, daß ein Frauenzimmer nach ihm gefragt habe. Das Fräulein, oder was es sei, habe den Anstand und das Auftreten einer Dame. Er dachte sogleich an Venne, und sein Herz schlug freudig erregt, daß er sie wiedersehen und ihr vielleicht Hilfe bringen sollte. Bald darauf kehrte Venne zurück und wurde zu ihm gewiesen. Er begrüßte sie mit ehrerbietiger Freude.
[S. 241]
»Das nenne ich eine frohe Überraschung, Jungfer Venne Richerdes«, sagte er mit glänzenden Augen.
»Ihr kennt meinen Namen?« fragte sie überrascht.
»Wie Ihr merkt«, antwortete er. »Seit ich Euch sah, bin ich nicht müßig gewesen, zu erkunden, wer die schöne Unbekannte sei, der ich unweit Seesen begegnete.«
»So wißt Ihr wohl auch schon, was mich zu Euch führt?« forschte sie weiter.
»Ich glaube es zu wissen«, erwiderte er ernst. »Und Ihr mögt glauben, daß ich Euch zur Verfügung stehe mit allem, was ich habe und kann.«
Dann erzählte Venne, wie übel man ihrem Vater und ihr mitgespielt habe. Raßler unterbrach sie nicht, aber die Ader schwoll auf seiner Stirn, und seine Fäuste ballten sich bei jeder Kränkung, die ihr widerfahren war.
»Das ist abscheulich, das ist gemein gehandelt,« rief er, als sie geendet, »und dieser Achtermann ist der größte Schuft, den ich je gesehen. Aber gnade Gott ihm, wenn er mir unter die Fäuste gerät. Euch wird Euer Recht werden, Jungfer Venne, glaubt es mir, und sollte ich es vom Himmel herabholen!«
Hermann Raßler war indes nicht der Mann langer Gefühlsergüsse, wenn es die Tat galt. Und so fand er sich von seinem Zornesausbruch sehr bald wieder zum praktischen Leben zurück.
»Was soll nun geschehn? Habt Ihr schon einen Plan gefaßt?« fragte er Venne.
»Nein,« antwortete sie bedrückt, »ich kam zu Euch, um mir Rat zu holen.«
»Den sollt Ihr haben, und zwar kurz und bündig. Er lautet: Sagt der verfluchten Stadt auf, werft ihr den Fehdehandschuh[S. 242] hin, und ich werde das Werkzeug sein, sie Eure Rache fühlen zu lassen.«
Venne erschrak vor dem Vorschlag: sie sollte ihre Heimatstadt mit Krieg und Kampf bedrohen? Der Gedanke kam ihr zu fürchterlich vor. Aber Raßler verstand es, ihre Bedenken zu zerstreuen. Wieder und wieder ließ er die Demütigung vor ihren Augen erstehen, deren Opfer sie unschuldigerweise geworden war. Und außerdem beschwichtigte er sie über das Blutvergießen, das bei dem Austrag der Fehde eintreten könnte.
»Nicht darauf kommt es an, daß Menschenleben verlorengehen, sondern daß den reichen Protzen der Geldsack geschmälert wird. Laßt mich nur machen. Wo ich sie fassen kann, sollen sie bluten. Ob es nun ihre Herden sind oder ihre Waren. Nichts, nichts soll sich jetzt noch ungestraft außerhalb ihrer Mauern sehen lassen. Und selbst in ihrem Neste will ich ihnen einheizen, daß ihnen der Atem ausgeht.«
»Aber dann bin ich ja für allezeit von meiner Heimat ausgeschlossen«, wandte Venne ein.
»Für längere Zeit ja, für immer aber braucht das nicht zu sein. Ihr wäret nicht die erste, die einem Orte aufsagt und später doch wieder in seinen Mauern wohnt. Doch ich sollte meinen, Euch wäre der Appetit auf Goslar vergangen. Auf jeden Fall sehe ich keinen anderen Weg, Euch zu Eurem Rechte zu verhelfen, als den der Gewalt.«
»Vergebt nur, Herr Raßler, wenn ich mich unvernünftig benehme, aber ich kann nicht so schnell von meinen Gefühlen loskommen. In Goslar ist alles, was sich für mich mit dem Begriff ›Leben‹ verbindet; dort sind die Gräber meiner Eltern, dort leben mir auch jetzt noch wahre, treue[S. 243] Freunde. Alles das soll ich aufgeben, um heimatlos in der Welt zu stehen? Nein, das kann ich nicht, kann ich wenigstens im Augenblick nicht. Ich muß, ehe das Schlimme vor sich geht, was Ihr vorschlagt, alles geordnet haben, will auch noch versuchen, ob ich nicht wenigstens eine Ehrenrettung des Vaters in irgendeiner Form erreichen kann. Schlägt auch das fehl, so bin ich zum Äußersten bereit.«
»Ich kann Euch nicht halten, aber ich will Euch nicht verschweigen,« entgegnete Raßler, »daß ich in Sorge um Euch bin, solange Ihr in Goslar weilt. Was Ihr mir von Achtermann erzähltet, läßt mich noch Schlimmeres befürchten, als es der Zwang ist, den sie Eurem Recht antaten. Auf jeden Fall bleibt nur so lange dort, als es unerläßlich nötig ist. Ich warte Eurer indessen. Und wenn Ihr die Stadt verlaßt, so begebt Euch zum Kloster Riechenberg. Dort werdet Ihr einigermaßen sicher sein. Dort findet Ihr auch mich selbst oder erfahrt den Ort, wo ich zu treffen bin. Es wird in der Nähe sein.«
Venne Richerdes kam nicht dazu, aufs neue Verhandlungen anzuknüpfen mit dem Rate oder der Stadt. Von Johannes Hardt erfuhr sie, daß inzwischen ein Schreiben des Geheimschreibers vom Bischof von Hildesheim, Woltwiesche, eingetroffen sei, in welchem er sie beschuldigte, den Rat von Goslar, insonderheit den Bürgermeister Karsten Balder, vor dem Kaiser in Worms gröblich verleumdet und beschuldigt zu haben.
»Der Schuft!« das war alles, was Venne zu dieser Niedertracht[S. 244] sagte. Aber Johannes war in großer Sorge um sie. »Ihr müßt die Stadt verlassen, denn ich fürchte, daß der Rat Euch verklagen und Euch den Prozeß machen wird. Und das geistliche Gericht wird Euch vollends seine Macht fühlen lassen!«
»Diese schlimmen Männer,« klagte Gisela, »wollen sie denn die arme Venne gar nimmer in Ruhe lassen? Können wir sie nicht bei uns verbergen?« meinte sie dann zu Johannes gewendet.
»Das würde ein schlechtes Versteck sein«, erwiderte ihr Gatte. »Bei uns sucht man sie zuerst, wenn sie auf der Bergstraße nicht zu finden ist. Ich fürchte, man wird sie noch anderer, schlimmerer Dinge bezichtigen. Man will Venne in Wolfenbüttel gesehen haben und vermutet, daß sie mit dem Herzog konspirierte. Auch murmelte Achtermann noch von besonderen Sachen, die er vorzubringen habe. Wir mögen uns vorstellen, was er meint. Und rücksichtslos und nachträglich, wie er ist, kann er allein aus der Zaubertrankgeschichte Venne ein schlimmes Gebräu zurichten. Ich rate also, Venne, verlaßt die Stadt, sobald Ihr könnt, am besten noch heute, ehe man nach Euch fragt.«
Venne war erblaßt, aber aus ihren Augen blitzte düstere Entschlossenheit. »Ich danke Euch, Johannes, und Dir, liebe Gisela, für alles, was Ihr für mich getan habt. Ihr habt recht, Johannes, mir bleibt nichts übrig, als zu fliehen. Was ich hier vernehme, erleichtert mir allerdings den Entschluß, den ich zu fassen habe. Ich breche alle Brücken hinter mir ab, und der Rat mag die Verantwortung für das tragen, was kommt.«
»Was hast Du vor?« fragte Gisela ängstlich, und Johannes warnte: »Venne, begeht keine Unbesonnenheit. Es[S. 245] handelt sich jetzt nur darum, Euch in Sicherheit zu bringen. Ich werde Eure Sache vertreten und hoffe, daß Ihr über ein kurzes wieder friedlich unter uns weilen könnt.«
Venne lächelte düster zu den Worten Johannes'. »Was ich plane, Gisela, muß ich für mich behalten. Ich fürchte, die Heimat verliere ich für immer mit dem Augenblick, wo ich jetzt Goslar verlasse. Aber einmal muß ich noch in die Bergstraße, um vom Vaterhause und der guten Katharina Abschied zu nehmen. Ich sah sie noch nicht, seit ich zurückkehrte, und sie soll wissen, daß ich hier war. Um sie tut es mir besonders leid. Wollt Ihr mir einen letzten Dienst erweisen, so nehmt Euch der treuen Seele an, wenn ich fort bin.«
Die gute Alte war außer sich, als sie hörte, Venne wolle von ihr fort. »Und ich bin allein schuld an dem ganzen Unheil«, klagte sie sich mit bitteren Tränen an.
»Meine gute Katharina,« beruhigte sie Venne, »Du bist nicht schuldig. Schuld trägt die Bosheit und Schlechtigkeit unserer Feinde und Widersacher. Soll ich mich denn wehrlos in deren Hände geben? Das kannst Du nicht wollen, also gib Dich zufrieden und mache mir den Abschied nicht zu schwer. Ich hoffe, daß wir uns bald wiedersehen. Inzwischen halte hier gut haus. Und was Du auch über mich hören wirst, Du weißt, Deine Venne tut nichts, was sie nicht glaubt vor ihrem Gewissen verantworten zu können.«
Sie nahm die arme Alte fest in die Arme und streichelte die haltlos Schluchzende. Dann verließ sie das Haus ihrer Väter. Um ganz sicherzugehen, wartete sie die Dämmerung ab und schlüpfte dann durch das Mauerpförtchen an der Frankenberger Kirche, wo sie die Frau des Wärters ohne Arg hinausließ.
[S. 246]
Ein kurzer Weg führte sie über die Landwehr nach dem Kloster Riechenberg. Dort wartete ihrer beim Pförtner die Nachricht, daß Raßler im Kloster sei. Er wurde geholt. In seinen Augen glomm die Freude über ihre Ankunft.
»Ich hatte schon Sorge um Euch. Aber nun ist alles gut. Wir werden noch eine Strecke heute abend zurücklegen müssen, da Euch als Frau der Zutritt zum Kloster verwehrt ist. Im Amtshause zu Langelsheim, eine Wegstunde von hier, finden wir Unterschlupf für die Nacht, und morgen bringe ich Euch an einen Ort, wo wir in aller Sicherheit und Ruhe erwägen können, welche Schritte zu unternehmen sind.«
So geschah es. Der herzogliche Vogt in Langelsheim zeigte sich beflissen, alles nach den Wünschen Raßlers einzurichten. Man merkte, auch hier galt dessen Wille fast ebensoviel wie das Wort des Herzogs selbst.
Am nächsten Morgen brachen sie zu Pferde auf. Venne achtete nicht darauf, daß einige Reiter nach ihnen ebenfalls aus dem Orte ritten. Es war die Nachhut, die Raßler sich folgen ließ, um gegen jede Überraschung gesichert zu sein. Bei dem Dorfe Dolgen verließen sie die Landstraße und bogen rechts ab, einem kleinen Weiler zu, der in Waldeinsamkeit träumte. Es war Rohde, eine Siedlung, die aus einigen Häusern bestand. Auf dem einzigen Hofe kehrten sie ein. Wieder zeigte sich die Fürsorge Raßlers, denn die Leute waren unterrichtet und hatten ein Zimmer hergerichtet, in dem trotz aller Einfachheit das Behagen wohnte.
Ermattet von dem Ritt in der Sonne, ließ sich Venne am Tische nieder. Raßler empfahl sich: »Ich lasse Euch allein, damit Ihr Euch ausruhen könnt. Wenn Ihr etwas nötig habt, ruft nur, die Wirtin wird Euch zur Verfügung stehen.[S. 247] Mich selbst könnt Ihr zu jeder Stunde erreichen. Beliebt es Euch, werde ich die Mahlzeit mit Euch einnehmen. Wollt Ihr allein speisen, so sagt es ruhig. Mir liegt daran, daß Ihr wieder ins Gleichgewicht kommt. Morgen sprechen wir über alles Weitere.«
Venne war ihm dankbar, daß er sie allein ließ. Müde streckte sie sich auf das bereitete Lager nieder. Wild stürmten die Gedanken auf sie ein, aber allmählich schlief sie infolge der Müdigkeit ein. Doch es war kein erquickender Schlummer. Wilde Träume durchjagten ihr Gehirn, und zuletzt wachte sie mit einem Schrei auf. Es hatte ihr geträumt, sie solle gefoltert werden. Achtermann war der Henker und näherte sich ihr mit glühender Zange, um sie zu brennen. Auf den Schrei trat die Wirtin herein und fragte, ob ihr etwas fehle. Venne schämte sich ihrer Schwäche und bat um das Abendbrot, da sich der Tag dem Ende neigte. Es war ihr noch ganz unheimlich zumute von dem bösen Traum, und die Einsamkeit und Stille lastete auf ihr wie ein Druck. Deshalb ließ sie Raßler ersuchen, er möge mit ihr zusammen essen.
Raßler bewies, daß er über durchaus gute Manieren verfügte. Er fiel weder durch eine ungeschickte Bewegung, noch durch ein Wort auf. Zwar konnte er es nicht hindern, daß sein Blick immer wieder mit Bewunderung auf ihr ruhte, aber diese Huldigung offenbarte sich so achtungsvoll, daß sie nichts Verletzendes für Venne enthielt. Es kam bei ihr noch das Gefühl des Dankes für den Mann hinzu, der sich ihrer in dieser Stunde der höchsten Not uneigennützig annahm.
Am nächsten Tage legte er ihr einen Absagebrief an Goslar in aller Form vor. Er lautete:
[S. 248]
»So sagen wir Euch denn, Stadt und Rat von Goslar, auf; erklären auch, Euch fleißig heimsuchen zu wollen, wo immer wir können. Auch beauftragen wir mit der Ausübung unserer Absage den Herrn Hermann Raßler, als welcher von heute ab, als dem Tage nach St. Antonius, in meinem Dienste zu stehen sich erkläret.
Datum zu Rohde, am 10. Tage des Mondes Maji 1500 und im zwanzigsten und zweyten Jare,
Venne Richerdes.«
Dieser Fehdebrief haftete schon am nächsten Morgen am St.-Viti-Tore zu Goslar und rief in der Stadt ungeheure Aufregung hervor. Man wußte, wessen man sich von Raßler zu versehen hatte, und Fluchen und Klagen erscholl überall. Im Rate vernahm man die Absage mit Wut und Grimm, und Achtermann schwur, wenn man Venne Richerdes ergreife, sie dem Henker als gemeine Hexe übergeben zu wollen. Wie ernst es dieser aber, wie vor allem Raßler mit der Ausübung der Fehde war, zeigte sich schon am Abend, als vor dem Breiten Tore zwei Feldscheunen in Flammen aufgingen. Man schimpfte auf den Rat, man fluchte auf Venne Richerdes und Hermann Raßler, aber man hatte sie nicht, um Vergeltung zu üben.
Venne erfuhr gar nicht, wie inzwischen ihr Beauftragter sein Amt ausführe. Sie saß im stillen Rohde und ließ die Einsamkeit und Ruhe auf sich wirken. Am Tage beschäftigte sie sich auch gern mit den Kindern des Bauern, die, nachdem sie die erste Scheu überwunden hatten, mit stürmischer Zärtlichkeit an ihr hingen. Das Kleinste saß auf ihrem Schoß und hielt die Ärmchen um sie geschlungen, als einmal Raßler dazukam. Überrascht blickte er auf die liebliche Gruppe, dann aber quoll es heiß in ihm auf: Das war das Bild,[S. 249] das ihm vorschwebte für die Zukunft. Wenn er diese Frau gewönne, wäre alles ausgetilgt, was ihm an Häßlichem und Niedrigem im Leben widerfuhr. Dieser Traum war auch der Anlaß gewesen, weshalb er den Herzog bat, ihn zum ehrlichen Kriegsmann zu machen. Alles Edle in ihm drängte zum Licht. Er wollte heraus aus dem Schmutz, in dem er bis an die Knie gewatet hatte, seitdem man ihn wegen der Jugendstreiche aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
»Venne, werde die Meine«, das war sein Sehnen. Aber er zwang das Wort nieder, das sich ihm auf die Lippen drängte. Er wollte das Mädchen nicht beunruhigen, das sich vertrauensvoll in seinen Schutz begeben hatte. Erst für sie kämpfen, ihr Recht verschaffen, dann würde er vor sie hintreten und sie um sein Urteil bitten, das ihn zum glücklichsten Menschen machen oder der Verzweiflung für immer in die Arme treiben mußte. Das alte Leben würde er nicht wieder aufnehmen, eine Kugel im ehrlichen Kampfe sollte auch ihm dann die Erlösung bringen.
[S. 250]
Vier Wochen schon weilte Venne in dem stillen Rohde. Kein Lärm störte die Einsamkeit. Für die Sicherheit sorgten Posten, die in unauffälliger Weise den Ort bewachten. Nichts gemahnte sie daran, daß sie im Kampf lag mit ihrer Heimatstadt. Raßler kam, so oft er konnte. Auf ihre Frage, wie es in Goslar stehe, antwortete er nur immer kurz.
»Es steht gut. Alles andere mag Euch nicht bekümmern. Ist es an der Zeit, so sollt Ihr schon hören, was vor sich geht. Jetzt denkt nur daran, Euch zu pflegen. Ihr seht mir immer noch etwas mitgenommen aus.«
Venne blickte ihn sinnend an: »Was seid Ihr nur für ein Mensch, daß Ihr Euch für mich aufopfert. Und Euch sagt man so viel Schlechtes nach! Könnte ich Euch doch meinen Dank abstatten. Aber ich werde immer in Eurer Schuld bleiben.«
»Vielleicht mache ich einmal meine Forderung geltend. Hoffentlich schreckt Ihr dann nicht vor der Größe derselben zurück!« antwortete er. Dabei sah er ihr mit einem innigen Blick ins Auge. Venne errötete, sagte aber nichts.
In Goslar war derweilen ihr Name und der Raßlers auf aller Lippen. Fast keine Woche verging, in der man nicht über irgendeinen Schaden zu klagen hatte. Da war ein Warenzug trotz reisiger Bedeckung überfallen und weggenommen worden, dort ein Teil der Herde weggetrieben. Klagen und Jammern, wohin man hörte; es wagte sich fast niemand mehr aus der Stadt heraus. Johannes Hardt und[S. 251] sein Weib waren tief bekümmert über die Vorgänge, denn Venne versperrte sich damit den Weg der Rückkehr für alle Zeit. Und es erschütterte sie, daß jene sich in die Hand des Räubers gegeben und so viel Unheil über ihre Vaterstadt gebracht hatte und noch anrichtete.
»Das hätte sie nie und nimmer tun dürfen,« sagte Johannes. »Lieber Unrecht leiden, denn Unrecht tun. Sie kann sich jetzt nicht mehr beklagen, daß man ihr übel mitgespielt habe. Was sie der Stadt angetan hat, wiegt den Schaden hundertfältig auf, den sie erlitt. Sie soll sich nur hüten, sich noch einmal in die Hände des Rates zu geben; ihr kann niemand mehr helfen.«
Auch Gisela war tieftraurig, daß die Freundin diesen Weg gegangen. Und auch ihre selbstlose Liebe fand kaum noch eine Entschuldigung für Venne.
Bei dieser selbst regte sich langsam die Sehnsucht nach der Heimat.
»Oh, könnte ich nur einmal noch die Türme meiner Heimat sehen; einmal nur noch die trauten Räume des Vaterhauses betreten!« seufzte sie in stillen Stunden. Noch zwang sie das Heimweh nieder, aber es pochte immer gebieterischer an ihr Herz.
Als sie Raßler eine Andeutung machte, wehrte er erschrocken ab: »Ihr ahnt nicht, welche Stimmung in Goslar gegen uns herrscht. Man würde Euch steinigen, bekäme man Euch zu Gesichte.«
Da schwieg sie betrübt, doch die Sehnsucht war nicht verflogen.
Wieder verstrichen die Wochen, und immer tiefer wurden die Seufzer und immer größer der Schmerz um die verlorene Heimat. Da sagte sie eines Tages entschlossen zu Raßler:[S. 252] »Ich halte es nicht länger aus. Schafft, daß ich nur einmal, und sei es nur auf eine Stunde, nach Goslar komme und die alte Katharina sehe und spreche, dann will ich gern wieder still sein.«
Raßler wehrte mit aller Entschiedenheit ab. »Um Gottes willen, Venne, steht ab von Eurem Vorhaben. Es ist Euer Verderben. Die Goslarer sind mehr denn je auf der Hut und werden Euch erkennen. Ich kann Euch nicht Euren Feinden ausliefern, denn Euer Tod wäre auch der meinige.« Verzweiflung klang aus seinem Wort, und die treueste Hingebung war auf dem Grunde seiner Augen zu lesen.
»Und dennoch bitte ich Euch, laßt mich hin. Ich verspreche Euch, alles zu tun, wie Ihr es für gut befindet, und mich der größten Vorsicht zu befleißigen. Nur laßt mich hinein nach Goslar!«
»Hinein kommt Ihr schon, Venne Richerdes,« sprach er erschüttert, »aber heraus findet Ihr nicht. Man wird Euch greifen, Euch töten, und das, Venne, überlebe ich nicht. Venne, tut es mir zuliebe. Ihr ahnt nicht, was ich in Euch verliere!« In wilder Angst fast wurden die Worte ausgestoßen. Venne traten die Tränen in die Augen: »Hermann Raßler, es schmerzt mich, daß ich Euch Kummer mache. Ihr habt es wahrlich nicht um mich verdient, Ihr, der Ihr mir der treueste, uneigennützigste Freund waret in dieser Zeit. Glaubt nicht, daß ich Euch das je vergesse. Noch sind die Wunden frisch, die man mir geschlagen, aber es kommt wohl einmal die Zeit, wo sie verharscht sind. Dann will ich auch Euch Antwort geben auf Eure stumme Frage.«
»Venne«, jubelte er, doch dann bezwang er sich. »Ihr habt recht, noch ist es nicht Zeit, Wünsche zu äußern. Aber laßt mir die Hoffnung, dann will ich mich gern gedulden.
[S. 253]
Ich werde Euch selbst nach Goslar begleiten und in die Stadt bringen. Mir sind die Wege bekannt, wie man ungesehen hineingelangt.«
Das Käuzchen schrie in der sternlosen Septembernacht vor dem Thomaswall am Dicken Zwinger. Einmal, zweimal, zehnmal wiederholte es seinen klagenden Ruf, daß die guten Bürger hinter der Stadtmauer sich gruselnd die Decken über die Ohren zogen, denn den Todesvogel hört niemand gern. Aber bald öffnete sich leise und geräuschlos ein Mauerpförtchen, und ein verschlafener Kopf lugte heraus. »Wer ist's, der Einlaß begehrt?« war die leise Frage. »Gut Freund«, hieß es ebenso leise. Zwei Gestalten schlüpften durch die Lücke und folgten dem Öffnenden in die warme Stube. Dort traf das Licht der trübe brennenden Kerze die Gäste. Erschrocken fuhr der Wärter zusammen. »Um Gott, Herr Raßler, Ihr hier? Wißt Ihr nicht, was man Euch zugedacht hat? Und Eure Begleiterin?« Damit leuchtete er der zweiten Gestalt unter die Kapuze. »Alle Teufel, Ihr seid ein nettes Paar. Euch, Venne Richerdes, gilt es fast noch mehr als diesem da. Macht nur eilends, daß Ihr wieder aus dem Loche kommt, das ich Euch öffnete, sonst ist's um Euch geschehen.«
Raßler ließ sich ganz behaglich in dem gichtbrüchigen Sessel nieder. »Vorerst denken wir nicht daran, die gute Stadt Goslar zu verlassen. Wir fühlen uns bei Dir sicher wie in Abrahams Schoß.«
»Aber um Gottes willen, wenn man Euch bei mir findet,«[S. 254] wimmerte er ängstlich, »dann geht es auch mir an den Kragen.«
»So sorge dafür, daß wir nicht gefunden werden, dann kannst Du Dein edles Haupt weiter durch die Straßen von Goslar tragen«, fuhr Raßler gemütlich fort. »Jetzt aber wollen wir ruhen, denn unsere Besorgungen können wir doch erst morgen verrichten.« Der Wächter sah schon, hier war nichts mehr zu ändern, daher bereitete er oben im Turm schnell ein Lager.
Am nächsten Tage wurde er mit geheimer Botschaft zu Katharina geschickt. Eilfertig und zitternd kam das alte Weiblein angetrippelt. Der Bote hatte ihr wohl schon gesagt, wen sie treffen werde, denn mit allen Zeichen der Aufregung und Angst trat sie in das Zimmer. »Venne, meine Venne,« schluchzte sie, »wie konntest Du mir das antun!«
»Still,« herrschte Raßler, »wollt Ihr zum Verräter werden?« Da bezwang sie ihre Erregung, aber noch lange zitterte ihr gebrechlicher Körper unter verhaltenem Schluchzen. Dann begann das Fragen hin und her. Venne wollte wissen, wie es Hardts gehe, wie der guten Immecke Rosenhagen und ihren Kindern, und Katharina wieder forschte, wie und wo ihr Herzblatt lebe. Darüber war die Zeit verflossen, und es schlug die Stunde des Abschieds. Wieder konnte die gute Alte sich nicht fassen, bis Raßler nachdrücklich zum Aufbruch mahnte. Noch eine letzte Umarmung, dann schritt die Alte davon, gebeugt von ihrem Gram und das Weinen mühsam bekämpfend.
War die Einladung Katharinas auch mit aller Vorsicht erfolgt, es konnte doch nicht unbemerkt bleiben, daß die Magd der Richerdes in der stillen Gasse auftauchte. Neugierige Blicke folgten ihr, als sie in das Haus des Wächters[S. 255] hastete, und neugierige Augen geleiteten sie, als sie wieder fortging. Was hatte die hier zu tun, und was verursachte ihre Tränen? Hatte sie Nachricht von ihrer Herrin, der verruchten Venne, bekommen? Die Zungen ruhten nicht. Wußte der eine, daß sie die Nachricht vom Tode der Richerdes erhalten habe, so fügte der zweite und dritte schon hinzu, daß sie jene selbst gesprochen, und sie wußten doch nicht, wie nahe sie der Wahrheit kamen!
Es dauerte nicht lange, und die Menschen versammelten sich vor dem Hause, Stadtsoldaten marschierten auf, das Gebäude war von den freien Seiten umzingelt.
Die beiden beabsichtigten, mit dem Anbruch der Dunkelheit wieder zu verschwinden. Sie unterhielten sich noch mit dem Mann, der sie eingelassen hatte, da traf Stimmgewirr ihr Ohr. Raßler warf einen Blick durch das kleine Fensterchen und fuhr erschreckt zurück. »Wir sind verraten«, flüsterte er. Venne erblaßte. An sich dachte sie zuletzt. »Oh, nun habe ich Euch auf dem Gewissen«, klagte sie.
»Sorgt Euch nicht um mich,« wehrte er ab, »Euch gilt es zu retten, denn ich fürchte, Ihr seid ihnen im Augenblick wichtiger als ich.«
Verzweifelt spähte er umher: Gab es denn gar keinen Ausweg aus der Falle? Es war ausgeschlossen, denn auf der Rückseite, nach dem Walle zu, lehnte sich das Häuschen an die Stadtmauer. Verflucht, so war man den Pfeffersäcken ins Garn gegangen, ohne daß sie es ausgespannt hatten! — Fieberhaft arbeitete sein Gehirn: Sollte er versuchen, durchzubrechen? Er allein würde sich nicht besonnen haben. Aber Venne. Kein Ausweg, keine Rettung! Wieder irrte sein Blick über den Platz, wieder überlegte er, doch es ging nicht, er mußte Venne für den Augenblick aufgeben,[S. 256] nicht um sie den Goslarern zu überlassen, sondern um sie bald, morgen, in wenigen Tagen zu befreien. Er teilte ihr seinen Entschluß mit.
»Verzagt nicht. Solange noch ein Atemzug in mir ist, wartet Euer die Rettung.« Dann traf er die Anstalten zum Durchbruch.
Absichtlich zeigte er sich an einer Giebelöffnung, als ob er von dort aus entkommen könne. Sofort erhoben sich die Stimmen: »Da ist er, dort will er entfliehen!« In wenigen Sätzen stand er an der Tür, riß sie auf und warf sich auf die überraschten Nächststehenden. Es war ihm ein leichtes, sie zu überrennen. Ehe noch die Menge wußte, was geschehen, rannte er davon und verschwand. Venne aber wurde ergriffen und im Triumph in festes Gewahrsam geführt.
[S. 257]
Luthers kräftige Stimme wider den Ablaßmißbrauch, die zuerst im Jahre 1517 ertönte, fand in Goslar vielstimmigen Widerhall. Denn auch hier hatte man Tetzel reichlich gespendet, und ein in der St.-Jakobi-Kirche stehender Armenkasten führte noch lange den Namen ›Tetzelkasten‹. Aber noch bekannte man sich nicht offen zu der neuen Lehre. Der Rat im besonderen hielt noch einmütig am alten Glauben fest. Als jedoch im Sommer 1521 die heldenmütige Standhaftigkeit Luthers zu Worms vor Kaiser und Reichstag bekannt wurde, da war auch in Goslar die Bewegung nicht mehr einzudämmen. Es fanden die ersten Predigten in lutherischem Geiste statt, und der Vikar Johann Klepp lieh ihm von der Kanzel der St.-Jakobi-Kirche das Wort. Der Oheim Hardts, der Pleban an dieser Kirche, setzte beim Rate durch, daß jenem das Predigen in dieser Kirche verboten wurde. Da zog Klepp in die Kirche zum Heiligen Grabe, und seine Anhänger mehrten sich von Tag zu Tag.
Zuletzt wurde ihm das Reden in allen Kirchen verboten, doch der Stein, der ins Rollen gekommen war, konnte nicht mehr aufgehalten werden. An Klepps Stelle traten andere, und was man in den Gotteshäusern nicht mehr verkünden durfte, fand auf den öffentlichen Plätzen das Ohr einer noch größeren Zuhörerschaft. Magister Schmiedecke predigte auf dem Lindenplan, und seine Anhänger, ›die Lindenbrüder‹, gewannen ihm neue Gefolgsleute. So groß war der Zulauf, daß die Kirchen und Kapellen bald leer standen.
[S. 258]
Die Stadt war voll innerer Unruhe; die Masse des niederen Volkes stand gegen die Besitzenden, besonders den Rat, in ablehnender Kampfstimmung. Der Funken glühte; wer ihn zu entfachen vermochte, konnte große Verwirrung über die Stadt bringen.
Hermann Raßler war über diese Zustände wohlunterrichtet, und er baute darauf seine Befreiungspläne. Seit einigen Tagen lebte er wieder unerkannt in den Mauern der Stadt, und seine Agenten bearbeiteten das Volk, um es für seine Ziele einzuspannen. In geschickter Weise wurde die Stimmung aufgepeitscht durch die Verquickung der religiösen Spannung mit dem wirtschaftlichen Elend. Raßlers Plan ging dahin, einen Auflauf des Volkes zu verursachen und während dieser Zeit die Gefangene zu befreien. Die Zusammenrottung fand planmäßig statt. Große Mengen schreienden und brüllenden Volkes drängten sich auf dem Marktplatz zusammen. »Fort mit den Pfaffen! Heraus mit dem Rat! Brot! Brot! Der Bürgermeister soll kommen!« so tobte und schrie es durcheinander. Nur Achtermann verlor die Ruhe nicht. »Laßt die Kartaunen abbrennen, schickt ihnen Vollkugeln auf den Wanst, daß sie satt werden«, riet er höhnisch.
Das Gesicht Karsten Balders war in ernste Falten gelegt. Er übersah das Unwetter, das heraufzog, in seiner ganzen Schwere. Es handelte sich nicht nur darum, die Ruhestörer vom Marktplatz zu verscheuchen, einigen Dutzend Schreiern den Mund zu stopfen, sondern eine Bewegung zu bekämpfen, die das gesamte Volk bis in seine Tiefen hinein erregte und die, wenn sie Wurzel faßte, die Stadt in ausgesprochenen Gegensatz zu Kaiser und Papst bringen und damit den katholischen Herzögen den Weg frei machen mußte,[S. 259] um ihr Mütchen an ihr zu kühlen. Er entschloß sich, auf den Altan zu treten und beruhigend zu der Menge zu reden.
Als er erschien, schrien einige: »Still, der Bürgermeister will zu uns reden. Ruhe für Karsten Balder!«
»Soll das Maul halten!« brüllten andere. Es drohte zu einem Handgemenge zwischen den beiden Parteien zu kommen.
Die Leute Raßlers, geschickt auf den Platz verteilt, hetzten die einen gegen die anderen, und der Tumult schien sich in sich selbst verzehren zu wollen. Der Bürgermeister, der ein paarmal vergeblich versuchte, sich Gehör zu verschaffen, wollte wieder wegtreten.
Während des Lärmens und Tobens hatte Raßler selbst sich mit einigen handfesten Leuten Eintritt von der Seite der Marktkirche ins Rathaus verschafft, in dessen Keller Venne Richerdes schmachtete. Da er durch seine Späher auch über die Örtlichkeit genau unterrichtet war und alles vorgesehen hatte, um bis zu ihr vorzudringen, stand er bald in ihrem Kerker. Sie war schon oft zum Verhör vorgeführt worden und glaubte, man wolle sie wieder vernehmen. Da erklang es hastig: »Kommt, die Befreiung naht.«
Venne erkannte Raßler und warf sich ihm aufschreiend in die Arme. »Gott sei Dank, daß Ihr kommt. Ich glaubte schon, ich sei von allen verlassen.«
Einen Augenblick ruhte sie an seinem Herzen, und seine Arme umschlossen die geliebte Gestalt; dann aber ermannte er sich. »Fort, keinen Augenblick verlieren!«
Durch Gänge und Türen stolperte sie an seiner Hand bis auf den Hof hinauf. Das Licht der Sonne, das sie seit Wochen nicht geschaut hatte, blendete so, daß sie die Augen mit der Hand schützen mußte.
[S. 260]
Noch hatte niemand die Flucht bemerkt, denn aller Aufmerksamkeit war den Vorgängen auf dem Markt zugewandt, und sie wäre auch wohl weiter zunächst unbeachtet geblieben, wenn nicht zufällig ein Ratsherr aus der rückwärts mit Fenstern versehenen Stube gesehen hätte, wie das Paar eilig aus dem Hofe hastete. Er schlug sofort Lärm, und der Ruf: »Venne Richerdes ist entflohen!« ertönte weithin. Dieser Ruf, ins Volk geworfen, bewirkte, was weder der Bürgermeister noch andere erreichen konnten: Der ganze Haufe setzte sich nach dem Hohen Wege in Bewegung, wohin das Paar gelaufen war.
Die beiden hatten einen ziemlichen Vorsprung, und es wäre Raßler bei seiner Kenntnis aller Winkel und Ecken wohl gelungen, sie in dem Gewirr der Gassen am Liebfrauenberge in Sicherheit zu bringen, wenn nicht Venne von der langen Haft geschwächt gewesen und ihre Kleider ihr beim Laufen hinderlich gewesen wären. Einige leichtfüßige Burschen hefteten sich an ihre Fersen. Um sie abzuwehren, mußte Raßler sich wiederholt umkehren. So verlor er kostbare Minuten. Der Haufe kam immer näher, die Wut funkelte aus aller Augen, dumpfe Schreie tönten an ihr Ohr.
Einige Leute Raßlers, die in Erkenntnis der Gefahr mit der Menge vorgestürzt waren, warfen sich ihr entgegen; auch Raßler selbst zog sein Schwert. Aber ihre Tapferkeit zerschellte an der Wucht der Masse. Ein klobiger Rademacher, der ein Stück Holz am Wege aufgegriffen hatte, schmetterte es auf Raßlers Kopf hernieder, daß er zu Boden sank. Alles war verloren; da wollten die Knechte wenigstens ihren Hauptmann retten. »Laßt das Weib, der Hauptmann ist uns mehr wert.«
Während die einen noch kämpften, schleppten die anderen[S. 261] den todwunden Mann davon. Venne blieb in den Händen ihrer Verfolger und wurde im Triumph zum Rathaus zurückgebracht. So endete der Befreiungsversuch, und der Rat trug fortan durch verdoppelte Wachsamkeit Sorge, daß man nicht ohne seinen Willen wieder zu ihr gelangen konnte.
Johannes Hardt bewahrte seine Treue gegen Venne auch jetzt noch, obwohl sie ihn durch ihre Verbindung mit Raßler schwer enttäuscht hatte. Er übernahm die Verteidigung der Angeschuldigten, und er unterließ nichts anzuführen, was zu ihrer Entlastung dienen konnte, verhehlte sich indes nicht, daß keine Aussicht bestand, sie zu retten. Gisela, die von tiefem Kummer über das Los der Freundin erfüllt war, beschwor ihn, nichts unversucht zu lassen. Sie erwog sogar den Plan, Venne heimlich freizulassen durch Bestechung der Wärter. Auch Immecke Rosenhagen und Erdwin Scheffer waren dafür gewonnen, aber Johannes erhob nachdrücklich Einspruch. Sein Pflichtgefühl litt es nicht, daß er, der im Solde der Stadt stand, etwas duldete oder sogar förderte, was ihn mit seinem geschworenen Eide in Konflikt brachte. Außerdem erkannte er, daß der Plan doch zum Scheitern verurteilt war. »Ich habe nur noch eine Hoffnung,« sagte er zu Gisela, »sie beruht auf Ernesti, an den ich schon vor langer Zeit eilige Botschaft schickte. Er ist mächtig und einflußreich; sein Wort gilt auch bei dem Rate viel. Gelingt es ihm nicht, Venne frei zu bekommen, so weiß ich keinen Rat mehr.« Seufzend ergab sich Gisela in das Unabänderliche.
[S. 262]
Ernesti kam; Johannes besprach mit ihm alles, und auch jener erkannte den furchtbaren Ernst der Lage. Doch er wollte nichts unversucht lassen. Schon am nächsten Tage begab er sich auf das Rathaus und hatte mit Karsten Balder eine ernste Besprechung.
»Herr Karsten Balder,« sagte er, »ich verstehe Euren Zorn gegen mein Niftel; ich will auch zugestehen, daß sie sich schwer gegen die Stadt vergangen hat. Aber laßt ihr auch Gerechtigkeit widerfahren. Bedenkt, wie schwer sie gekränkt war, wie man sie und ihren Vater gehetzt hat, bis sie so weit kam. Ihre Begriffe von Recht und Unrecht mußten sich verwirren; die Hauptschuld trägt der Ratsherr Achtermann, wie Ihr nicht bestreiten werdet. Ich will von dem Geschwätz absehen, das er über sie ausstreute, sie sei eine Hexe. Ihr selbst als vernünftiger Mann werdet das nicht glauben, denn Heinrich Achtermann war ihr in treuer Liebe zugetan, und es steht fest, daß er bis zuletzt nie an ihr gezweifelt hat. Wie sollte also dieses reine, keusche Mädchen dazu kommen, sich solcher buhlerischen Mittel zu bedienen, um etwas zu gewinnen, was sie schon besaß? Ein anderes ist es um den Schaden, den sie oder Raßler, vielleicht ohne ihre Kenntnis und Einwilligung, Eurer Stadt zugefügt hat. Er mag groß sein, aber er ist zu ersetzen, und ich bin reich genug, um dafür einzustehen.«
Karsten Balder hatte ihn sprechen lassen; unbewegten Antlitzes hörte er ihm zu. Dann nahm er mit ernster Stimme das Wort: »Ihr wißt, Herr Ernesti, daß Venne Richerdes wie ihr Vater mir die Hauptschuld an dem beimessen, was sie an Ungemach betraf. Sie taten mir bitter unrecht damit, aber ich habe geschwiegen. Meine Hand ist rein von Schuld gegen sie. Mein Mund hat nichts geredet, das ich[S. 263] nicht verantworten könnte. Sie taten mir unrecht, aber es soll ihnen nicht vorbehalten bleiben. Doch anders ist es mit dem, was der Stadt widerfuhr. Für diese tat ich, was jene mir als persönlich gemeinte Kränkung auslegten; für diese muß ich geschehen lassen, was jetzt über die Tochter kommt. Sie tut mir leid, die Venne, ich will es Euch gestehen, und was der Achtermann ihr antut, mag kleinlich, verächtlich, verabscheuungswürdig sein. Aber es steht mir nicht zu, über ihn zu Gericht zu sitzen. Hätte sie sich früher an mich gewandt, so wäre vielleicht manches anders geworden; jetzt ist es zu spät.«
»Herr Bürgermeister,« entgegnete Ernesti, der noch nicht alle Hoffnung aufgeben wollte, »ich bin, wie Ihr wißt, ein Freund Eurer Stadt. Ihr selbst nanntet mich so. Ich habe — wiederum gebrauche ich Eure Worte — ihr Dienste geleistet, für die mir Dank zugesichert wurde. Wohlan, jetzt ist die Stunde der Vergeltung gekommen. Ich begehre nichts als die Befreiung Venne Richerdes'. Sie soll Euch Urfehde schwören; ich will sie mit mir nehmen, daß Ihr sie nie wieder zu Gesicht bekommt, aber laßt sie gehen.
Ich habe Euch geholfen, ich werde Euch helfen. Ich sorge, Ihr werdet diese Hilfe gut gebrauchen können. Gebt sie mir. Sie ist nur mein Niftel, aber Ihr seid selbst Vater, habt eine blühende Tochter. Sagt, wie täte es Euch, wenn man sie töten wollte. Würdet Ihr nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sie zu retten?«
»Wenn ich an Eurer Stelle wäre, Herr Ernesti, sicher. Wäre ich der Bürgermeister Karsten Balder, nein! Ich stehe hier für die Stadt, der ich geschworen habe. Ihr mahntet mich an die unruhige Zeit, in der wir leben; wie sollte ich es verantworten, gäbe ich die Schuldige frei, um vielleicht[S. 264] demnächst ein Dutzend armer Schelme dem Gericht zu überantworten. Solange ich über Recht und Gerechtigkeit in der Stadt Goslar zu wachen habe, wanke ich nicht. ›Fiat justitia, pereat mundus!‹ Die Gerechtigkeit soll ihren Lauf haben auch in diesem Falle.«
Bleich waren beide Männer, die sich jetzt gegenüberstanden.
»Ihr hattet meine Freundschaft, Karsten Balder,« sagte Ernesti mit düsterer Stimme, »so nehmt meine Feindschaft. Daß ich einen Fehdebrief schreibe, wollet nicht erwarten, aber die Absage sollt Ihr merken!«
»Ich muß es gelten lassen«, sagte Karsten Balder tiefernst; damit schieden die beiden Männer.
Den Hardts berichtete er von seinem Mißerfolge. Venne wollte er nicht mehr sehen. »Es geht über meine Kraft, vor sie zu treten«, sagte er, »mit dem Bewußtsein, daß der Tod hinter ihr steht, und ihr leere Trostworte zuzuraunen. Sagt ihr auch nicht, daß ich hier gewesen.«
Dann brach er auf. Von Goslar fuhr er geradeswegs nach Wolfenbüttel, um mit dem Herzog zu verhandeln; darauf kehrte er in seine Heimat zurück.
Auch Herzog Heinrich versuchte noch einmal, zugunsten Vennes zu vermitteln; es war vergebens. Mit fast ingrimmiger Festigkeit lehnte der Bürgermeister die Einmischung des Welfen ab. So nahm der Prozeß gegen Vene Richerdes seinen Lauf.
[S. 265]
Auf dem Rosenberge, in einsamer Lage, wohnte der Henker der Stadt Goslar, Meister Henning Voß, mit Weib und Kind und mit seinen Knechten. In den Akten der Stadt führt er den harmlos klingenden Namen »Suspensor«. Für den armen Delinquenten, der ihm überantwortet wurde, war es indes gleich, ob der Rat Meister Henning seine sechzehn Groschen lötigen Silbers als »Henker« oder als »Suspensor« zahle.
Die Amtseinnahmen des Henkers waren nicht immer glänzend. Zwar flossen ihm neben den Einnahmen aus seinem blutigen Beruf auch sonst noch manche Sporteln zu, die ihm für allerlei unsaubere Arbeit zustanden, wie Reinigen der Gruben bei den Herren Ratsleuten, Abholen und Vernichten der Kadaver gefallener Tiere; aber es wäre doch in manchem Jahre Schmalhans Küchenmeister bei ihm gewesen, wenn sich ihm nicht noch andere einträgliche Einnahmequellen erschlossen hätten. Er war bekannt als Besitzer mancher dunklen Wissenschaft, geheime Tränke zu brauen, krankes Vieh zu besprechen, Liebe zu sichern und zu stören zwischen jungen Pärchen. Das alles fiel in den Bereich seiner Kunst. An manchem dunklen Abend pochte es an das Tor des Gehöfts, und ein zitternd Jüngferlein oder ein beherzterer Bursche holte sich Rat bei Meister Voß.
Als bestellter Henker hatte er auch dem Peinlichen Gericht seine Dienste zur Verfügung zu stellen. Und mancher, dem seine Rute den Rücken gestrichen oder dem er das Schandmal[S. 266] aufgebrannt hatte, sandte ihm im stillen und aus der Ferne seine Segenswünsche zu. Jetzt stand wieder einmal eine große Sache an, bei der es etwas zu verdienen gab. Daß es sich dabei um die Tochter eines Vornehmen handelte, erhöhte noch den Reiz der Arbeit.
Das Peinliche Gericht tagte in der Stadtfronei, die zur Zeit unter der Sankt-Ulrichs-Kapelle in der Kaiserpfalz untergebracht war. Dort hingen an den Wänden all die Geräte, mit denen man schweigsame Leute zum Reden brachte. Und dort bereitete jetzt auch Meister Voß und seine Leute alles vor, um die Angeklagten gehörig behandeln zu können. Es waren eingezogen außer Venne die alte Katharina und die Gittermannsche. Die beiden letzteren traf der Vorwurf des Zauberns und der Beihilfe zu diesem Verbrechen. Venne Richerdes hatte sich außerdem wegen Hochverrats und Mordes, begangen an ehrsamen Bürgern, zu verantworten, wie auch dafür, daß sie mit Hermann Raßler, der Stadt abgeschworenem Feinde, gemeine Sache gemacht habe.
Noch war der Henker mit seinen Knechten allein in dem düsteren Raume. Die Folterkammer entbehrte nicht des frommen Apparates, um auch keines der Mittel unversucht zu lassen, die auf das schon über die Maßen erregte Gemüt des peinlich zu Befragenden von Wirkung sein konnte. Der Freitag, der Sterbetag des Heilandes, galt den Inquisitoren als furchtbarster Erntetag. So wählte man ihn auch in Goslar. Das Gemach war schwarz ausgeschlagen; ein riesengroßes Kruzifix an der Wand trug nicht minder zur Erhöhung der düsteren Stimmung bei.
Meister Voß war ein frommer Mann, so ungereimt das auch manchem vorkommen mag. Er hatte das Geschäft vom Vater überkommen, wie dieser vom Großvater. Morgens[S. 267] sprach man in seinem Hause den Frühsegen, und der Abend fand nicht sein Ende, ohne daß dem lieben Gott gedankt wurde für das Gute, das er den Tag über beschert hatte, und war auch etwas Ungemach dazwischen gewesen. Daß dem Herrn der Heerscharen seine kleinen außerberuflichen Nebenbeschäftigungen vielleicht nicht ganz genehm sein möchten, kam ihm in seiner christlichen Einfalt nicht in den Sinn.
Lag ein besonderes Werk vor, so folgte dem Morgengebet noch ein zweites, in dem er den Herrn um eine sichere Hand anflehte und den Himmel bat, ihm die Tat nicht vorzubehalten, die er im Namen eines wohlweisen Rates zu tun berufen war. So geschah es auch heute, obschon es nur galt, die peinliche Frage zu tun, wenn die Angeklagten nicht jetzt vor dem Gericht geständig waren. Er nahm die Kappe ab, die Knechte taten ein gleiches, der eine ein wenig langsam und grinsend. Da unterbrach Meister Voß für einen Augenblick die schon begonnene Andacht, und seine Faust saß dem Säumigen im Nacken. »Willst Du Hund unserem Herrgott nicht den nötigen Respekt erweisen?« Der Gemaßregelte ließ sich willig belehren, und das Gebet verlief nach dem Fürspruch des Meisters.
Während dieser Zeit tagte über ihnen noch in einem Gemach das Gericht. Hinter einem schwarzbehangenen Tische, auf dem ein großer Kruzifixus zwischen zwei Kerzen stand, saßen schweigsamen und düsteren Antlitzes der Inquisitor und die Schöffen. An der Seite wartete der Aktuarius mit sorgsam zugeschnittenem Federkiel darauf, die Angaben niederzuschreiben. Es läutete dem Herkommen gemäß gerade die Angelusglocke, als die Beschuldigten von dem Büttel hereingeführt wurden. Das Malefizverfahren schrieb[S. 268] vor, daß die Tortur, die sich etwa anschließen konnte, die Übeltäter mit nüchternem Magen antreffe. So war es auch hier.
Als erste kam die Gittermannsche. Das häßliche Weib überfiel den Gerichtshof sogleich mit einem Schwall von Beteuerungen ihrer Unschuld. Die Magd habe ihr überhaupt nicht gesagt, daß der Trank für einen Menschen sei; er gelte einem Hunde, so sei ihr gesagt worden. Der Richter unterbrach sie strenge und ermahnte sie, zu schweigen und nur auf die Fragen zu antworten. Da sie bei ihrer Behauptung blieb, brach man das Verhör ab.
Katharina gestand unumwunden, daß sie zur Gittermannschen gegangen sei, um sich einen Liebestrank für Heinrich Achtermann zu holen. Die Gittermannsche, welche ihr empfohlen sei, habe durchaus gewußt, wem es gelte. Sofort fiel diese mit einem Schwall von greulichen Flüchen und Verwünschungen über sie her, so daß das Gericht ihr schon jetzt mit Auspeitschen drohen mußte, wenn sie das Verhör noch weiter störe. Da begnügte sie sich, den beiden anderen Frauen giftige Blicke zuzusenden. Die alte Magd beteuerte bei allen Heiligen, daß ihre Herrin nichts von der ganzen Sache gewußt habe.
Auch Venne erzählte den Vorgang so. Der Richter schüttelte den Kopf. »Und Ihr behauptet allen Ernstes und mit Vorbedacht, daß Ihr von dem ganzen bösen Handel nichts wußtet?«
Venne antwortete kurz und bestimmt: »Nein.«
»Bedenkt, es steht ein gewichtiger Zeuge gegen Euch, der Ratsherr Achtermann. Er behauptet das gerade Gegenteil.«
»So spricht er die Unwahrheit«, beharrte Venne trotzig.
»Ich warne Euch«, drängte der Vorsitzende. »Euch kann[S. 269] allein ein offenes Geständnis vor der peinlichen Frage bewahren.«
»Soll ich etwas gestehen, was ich nicht tat«, entgegnete sie mit Tränen.
»Das ist Eure Sache«, antwortete der Richter geschäftsmäßig kühl. Da drängte sich die alte Katharina vor. »Aber ich schwöre Euch, sie ist unschuldig. Wie könnt Ihr glauben, daß Venne Richerdes dazu jemals ihre Zustimmung gegeben haben würde!«
»Führt sie hinaus«, befahl der Unerbittliche streng. »Sie mag reden, wenn sie wieder befragt wird. Und die andere, die Anstifterin, nehmt auch mit.«
»Also, Ihr wollt nicht gestehen?« wandte er sich wieder an Venne. »Gut, so brechen wir damit ab.«
»Man redet Euch auch nach, daß Ihr gegen den wahren Glauben unserer Kirche gesprochen, Euch auch zu dem Apostaten, dem sündigen Mönch Luther, bekannt habet. Wie steht es damit?«
»Das ist der schuftige Schreiber des Bischofs, der uns belauschte und Halbgehörtes entstellte.«
»Ich nehme es für eine Absage,« entgegnete der Richter mit einem stummen Lächeln. »Doch darüber wird Euch etwa noch ein anderer vernehmen. Aber nun erklärt Euch zu Hermann Raßler«, fuhr er dann mit erhobener Stimme fort. »Leugnet Ihr auch hier die Gemeinschaft?«
»Ich leugne nicht, was ich getan habe«, antwortete Venne ruhig. »Ich nahm ihn mir zum Helfer, um mir mein Recht zu verschaffen, das der Rat mir vorenthielt. Daß er Goslar und seinen Bürgern so zugesetzt, wußte ich nicht, und es tut mir leid. Hätte ich es gewußt, ich würde meine Zustimmung nimmer gegeben haben.«
[S. 270]
»Und die Beleidigung des Rates und Bürgermeisters Karsten Balder vor des Kaisers Majestät? Wie steht es damit? Leugnet Ihr oder gesteht Ihr?«
»Ich leugne nicht, daß ich sie in Worms vor Kaiser und Reichstag der Beugung des Rechts geziehen habe gegen mich und meinen Vater. Ist das eine Sünde, so muß ich sie tragen. Aber sagt selbst, konnte ich anders, da man mir hier in Goslar die Türen verschloß?«
»Auf meine Ansicht dabei kommt es nicht an«, wehrte der Inquisitor kühl ab. »Also Ihr gesteht. Bleibt noch eins, nicht minder sündhaft. Man sagt Euch nach, daß Ihr den Schädling Hermann Raßler durch listige Überredung gewonnen, auch Euch ihm hingegeben und buhlerisch mit ihm gehauset habt. Stimmt das?«
Flammende Röte schoß Venne ins Gesicht. »Das ist gemein, das ist so niederträchtig, daß ich darauf nichts entgegnen will«, schloß sie mit Zusammenraffen des letzten Stolzes, obschon alles in ihr zitterte.
»Also schreibt, Aktuarius«, fuhr der Grausame ungerührt und kalt fort. »Die Angeklagte Gittermann gesteht ein, den Zaubertrunk bereitet, leugnet aber, ihn für Menschen bestimmt zu haben. Die Angeklagte Katharina, Magd der Venne Richerdes, hat den Trunk geholt, leugnet aber, ihrer Herrin davon Kenntnis gegeben zu haben. Und Venne Richerdes endlich will von dieser Angelegenheit nichts wissen, leugnet auch die Buhlschaft mit Hermann Raßler, wie die beleidigenden Äußerungen vor des Kaisers Majestät. Sie gesteht indes zu, mit selbigem Hermann Raßler der Stadt Goslar aufgesagt und derselben fleißig Schaden zugefügt zu haben.«
Venne wurde abgeführt; darauf beriet das Gericht, wie[S. 271] weiter zu verfahren sei. Man kam sehr bald zu dem einstimmigen Urteil, daß die drei über die bestrittenen Punkte peinlich zu befragen seien. Es wurde die Reihenfolge festgesetzt, beginnend mit den leichteren Graden.
Wenn all der Scharfsinn, den man im dunklen Mittelalter darauf verwendet hat, Werkzeuge zu ersinnen, welche die eigenen armen Mitmenschen bewegen sollten, Schandtaten zu gestehen, die sie doch niemals begangen haben konnten, wenn diese Tüfteleien darauf eingestellt worden wären, der Menschheit nützliche Dinge zu ersinnen, manche der Erfindungen, deren unsere aufgeklärte Zeit sich rühmt, wären uns von jenen schon vorweggenommen. Die ›Daumenschrauben‹, der ›Spanische Stiefel‹, die ›Pommersche Mütze‹, der ›Halskragen‹, der ›Leibgürtel‹, ein mit Eisenstacheln besetztes Korsett, in welches die Büste der Angeklagten hineingepreßt wurde, der ›Bock‹, ein in scharfer Schneide auslaufender Holzbock, auf welchen die ›Hexe‹ rittlings gesetzt wurde, stellen nur eine kleine Auslese der Marterinstrumente dar, mit deren Anwendung man die Armen zum Geständnis zu bringen suchte.
Man begann bei den Angeklagten mit dem Auspeitschen. Gräßlich hallte das Geschrei der Gittermannschen durch den Raum. Unbeweglich sahen der Richter und die Schöffen zu. Das Weib wand sich unter den unbarmherzigen Streichen, die ihren Rücken zerfetzten. Sie schrie, sie wolle gestehen, sie widerrief, und wieder sausten die Streiche herab. Da brach ihr Widerstand endlich.
Venne kämpfte mit einer Ohnmacht während des gräßlichen Schauspiels, und doch galt es bisher nur einer Fremden, einem widerwärtigen alten Weibe, dem mit dieser grausamen Behandlung vielleicht eine gerechte Buße auferlegt wurde für viele heimliche Sünden.
[S. 272]
Als aber ihre alte Katharina, ihre treue Pflegerin und Behüterin seit den Tagen der sonnigen Kindheit, an den Pfahl gebunden und ihr Rücken sich unter den Streichen des Henkers blutig rötete, da war sie zu Ende mit ihrem Widerstand.
»Haltet ein, haltet ein, sie ist unschuldig, ich will gestehen!«
Katharina hatte bis dahin alles ertragen, nur ein Ächzen rang sich über die welken Lippen; jetzt aber, da die Herrin sich für sie opfern wollte, schrie sie dazwischen: »Glaubt ihr nicht, sie sagt die Unwahrheit; ich war's allein.«
Der Richter kehrte sich nicht an ihr Geschrei. Ihm lag vielmehr an dem Geständnis der einen, der Hauptperson, die als ein ruchloses Scheusal dem Volke vorgeführt werden mußte, sollte die Strafe allen als gerecht erscheinen.
Ihre Freunde waren bei dem Prozeß zu der Rolle der ohnmächtigen Zuschauer verurteilt. Immecke Rosenhagen saß voller Ingrimm im ›Goldenen Adler‹. Die Gäste litten unter ihrer Laune. In ihrer alten Entschlossenheit suchte sie den Bürgermeister auf und bedeutete ihm, er könne doch unmöglich an das hirnverbrannte Zeug glauben; sie wies darauf hin, daß es nicht guttue, ein Mitglied einer alten Patrizierfamilie in dieser Weise bloßzustellen, denn die gemeine Masse ziehe daraus leicht ihre Schlüsse auf die Qualität der Vornehmen überhaupt. — Es war vergebens. Noch höher stieg ihr Groll, wenn sie darauf kam, daß der Ratsherr Achtermann, der am meisten Schuldige, triumphiere.
Erdwin Scheffer, der Stadtweibel, fraß seinen Grimm in sich hinein, wenigstens draußen. Zu Hause mußten die Kinder seine Laune büßen, wenn sie sich irgendwie laut machten.
Johannes Hardt war in seiner Rolle als Verteidiger sehr beschränkt. Bei der vorgefaßten Meinung der Richter verhallten[S. 273] seine eindringlichen Worte. Man wollte ein Opfer, und Venne sollte es sein!
Schon als die Folter bestimmt wurde für den Fall, daß sie nicht gestehe, erwies sich die Voreingenommenheit. Nach der bestehenden Gerichtsordnung konnten graduierte Personen, wie Doktoren, Lizentiaten, Professoren, Advokaten, und Leute von Stand, wie aus vornehmen Bürgergeschlechtern, die denen des Adels gleichzusetzen seien, von der Folter befreit werden; man ließ die Vergünstigung für Venne nicht zu. Als das Urteil gefällt war, das für die Gittermannsche auf den Feuertod, für Katharina auf erneutes Auspeitschen und Verweisung aus der Stadt und für Venne Richerdes endlich auf den Tod durch das Schwert lautete, versuchte Johannes Hardt noch einmal, sie zu retten. In einer Eingabe an den Rat wies er darauf hin, daß ein Appell an den Kaiser Begnadigung erwirken könne. Man verweigerte es. Die Stadt habe das Recht über Leben und Tod, also lasse sie sich von niemand dreinreden. Mutlos kehrte Johannes zu den Seinen zurück. Unaufhörlich flossen die Tränen Giselas; das harte Los Vennes konnte sie nicht ändern. Es wurde von dem Rate als eine besondere Vergünstigung hingestellt, daß man sie nicht wie eine gemeine Hexe verbrennen lasse, sondern sie durch das Schwert aburteilen wolle.
Venne Richerdes saß in strenger Haft. Man suchte einen abermaligen Befreiungsversuch durch geeignete Maßnahmen unmöglich zu machen. Sie war jetzt in Wahrheit von aller Welt abgeschlossen und bekam Menschen nur bei gelegentlichen[S. 274] Verhören noch zu sehen, die aber immer von kurzer Dauer waren, da ihr Geständnis vor dem Inquisitor als ausreichend angesehen wurde. Auch wollte man keinerlei Gelegenheit zu einem Widerruf bieten.
Venne dachte allerdings gar nicht an einen solchen, denn er würde das gräßliche Schauspiel erneuern, das ihr fast die Besinnung nahm. Lieber wollte sie aber den Tod selbst erleiden, ehe sie ihre alte, gute Katharina noch einmal den Henkersknechten auslieferte! Der Tod aber war ihr gewiß, so viel wußte auch sie von der grausamen Rechtspflege ihrer Zeit. Keine Rettung, nachdem Raßlers Versuch gescheitert war.
Der Keller des Goslarer Rathauses, der heute noch in seiner Urform zu sehen ist, ist vor anderen Anlagen gleicher Art ausgezeichnet durch seine ungewöhnlichen Höhenausmaße. Wie gewaltige Höhlen erstrecken sich die Gewölbe unter dem alten Gebäude dahin. Das Auge sieht die Wölbungen in unerreichbarer Höhe über sich, das Tageslicht dringt durch schmale, fast ebenso hoch liegende Schlitze in geiziger Sparsamkeit hinein und läßt das Dunkel des Raumes nur noch um so gespenstiger und grauenhafter erscheinen.
In einem dieser schauerlichen Verließe saß Venne Richerdes und wartete auf ihren Spruch. Kein Mensch nahte ihr als der Kerkermeister, der ihr die Speisen brachte und grußlos und schweigsam kam und ging. Kein Laut der Außenwelt drang zu ihr, sie war schon jetzt für ihre Mitmenschen tot.
Auch Johannes Hardt erhielt nicht länger Zutritt zu ihr, aber einer vergaß sie nicht, die Kirche. Sie, die sich von ihr als Abtrünnige gekränkt glauben konnte, wollte doch versuchen, die irrende Seele zu retten. So schickte sie ihren[S. 275] Boten, und bei der Auswahl erwies sich's, daß sie die Seelenkunde als vornehmste Waffe gegen den Unglauben zu verwenden verstand. Es kam nicht ein Eiferer, nicht ein ungestümer Hitzkopf, der mit dem Donner seines Wortes die Arme zu gewinnen suchte, sondern ein alter, würdiger Pater, ein Franziskaner, bei dem sie, wie die Mutter, bisweilen gebeichtet hatte. Aus seinem Wesen sprachen Güte und Nachsicht.
Mit einem freundlichen, milden Wort begrüßte er sie, als er ihr die Hand reichte. Nichts von Vorwurf, nichts von Geringschätzung.
»Auf Dir lastet ein schweres Geschick, meine Tochter. Wie findest Du Dich damit ab?« begann er teilnehmend.
»Wie man etwas Unverdientes hinnimmt, ehrwürdiger Vater. Man grollt dagegen und kann es doch nicht ändern. Man möchte die ganze Welt verderben und weiß doch, daß sie darob nur hohnlacht«, murrte sie düster. Seine Hand glitt tröstend über ihr Haar. »Wer kennt Gottes Wege, und wer weiß, wohin das zielt, was er uns schickt? — Wir meinen vor anderen zum Leiden ausersehen zu sein, wähnen uns zu Besonderem bestimmt, ungerecht aus der Bahn gerissen, und sind doch nur Staubkörnlein auf seinem Wege. Und eins, mein Kind, vergessen wir gar zu gern ob der Klagen: die Selbstanklage.
Ich bin nicht gekommen, Dich anzuklagen, ich will Dich aufzurichten suchen. Aber so Du auch gegen die anderen haderst, wie mir scheint, prüfe auch, ob Du vor Dir selbst gerechtfertigt dastehst. Ich bin ein alter Mann, der manches von der Welt gesehen hat. Vielerorts habe ich die Ungerechtigkeit triumphieren sehen, ohne dagegen einschreiten zu können. Auch in Deinem Falle liegt es, wie mir scheint,[S. 276] ähnlich. Deine Widersacher haben sich gegen Dich verschworen. Was Du dabei zur Gegenwehr gegen Deine Heimatstadt unternahmest, ist ebenso verwerflich, aber es mag mit Deiner Verlassenheit und Hilflosigkeit zum Teil erklärt und entschuldigt werden. Doch was Dir als schwere Schuld anzurechnen bleibt, ist Deine Einstellung zu den Schwarmgeistern, als deren schlimmster und ruchlosester jener wortbrüchige Mönch anzusehen ist, den Du in Worms zu Deinem Verderben hörtest.«
»Ihr habt es von dem schuftigen Schreiber des Bischofs«, warf Venne mit zuckenden Lippen, verächtlich lächelnd, ein. »Gegen solche Zeugen mag ich mich nicht verteidigen.«
»So sagt, daß er lügt,« fiel ihr der Mönch ins Wort, »und auch ich will ihn für einen Schuft erklären und aller Welt Eure Reinheit verkündigen.«
»Das vermag ich nicht zu sagen«, bekannte sie freimütig. »Zwar hat er nur halb aufgefangene Worte hämisch und tückisch weitergetragen, aber in der Sache hat er nicht unrecht. Ich will bekennen, daß der Wittenberger einen gewaltigen Eindruck auf mich machte. Und was Ihr ihm nachsagt von Ruchlosigkeit und Schlimmerem, vermag ich nicht zu glauben. Wenn Ihr den Mann gesehen hättet mit seiner lodernden Begeisterung, seinen überzeugenden Worten, denen die Wahrheit auf der Stirn geschrieben stand ...«
— »Höre auf,« rief der Pater, »ich sehe, Du bist schon völlig in die Netze dieses Apostaten verstrickt. Kehre um, solange es noch Zeit ist. Ich beschwöre Dich bei Deiner Seligkeit. Oder ist es dazu schon zu spät, hast Du Dich ihm mit Leib und Seele verschrieben?«
»Eure Sorge ist verfrüht«, entgegnete Venne. »Und«, fuhr sie bitter fort, »hättet Ihr vor meiner Fahrt nach[S. 277] Worms nur einen Bruchteil Eures Eifers um mich aufgebracht, so fändet Ihr mich wohl gar nicht in dieser Stimmung und auch nicht in dieser Lage. Noch ist nicht geschehen, was Ihr befürchtet; aber ich bin auf dem Wege zu ihm, dem Wahrheitskündiger und Seelenarzt. Das sollt Ihr wissen.«
Der Mönch lenkte ein: »Du machst die Kirche und uns, ihre Diener, zu Unrecht für das verantwortlich, für die Unbill, die Dir widerfuhr. Wir mischen uns nicht in weltliche Händel, wie Du weißt.«
»Nun, so laßt mich diese weltlichen Händel auch austragen mit all dem, was sie im Gefolge haben«, schloß sie bitter.
Aber der Pater wagte noch eine letzte Mahnung.
»Meine Tochter, vergiß, was man Dir zufügte, vergiß aber nicht, was Deiner im Jenseits wartet! Höllenqual und ewige Verdammnis, und vergiß nicht den Schmerz, den Du Deinen Eltern zufügst durch Deine Tat. Sie warten Deiner in ihren lichten Höhen. Willst Du Dich von ihnen scheiden?«
Sanft, mit zarter Güte war es gesprochen, und wie früher verfehlten diese Worte ihren Eindruck nicht. Venne begann bitterlich zu weinen.
»Das ist ja das qualvolle, daß ich nicht ein noch aus weiß in meiner Not. Wie oft habe ich schon daran gedacht, und doch zieht es mich immer wieder nach jener Seite, wo der Wittenberger steht!«
Der Besucher sah, daß er dem armen Mädchen jetzt nicht weiter zusetzen dürfe, deshalb schickte er sich zum Aufbruch an. »Du zweifelst noch, meine Tochter, da ist nicht alles verloren. Ich will jetzt gehen und Dich mit Gott und den Heiligen allein lassen. Mögen sie Dir das Herz erleuchten[S. 278] und Dir zurückhelfen auf den rechten Weg. Und vergiß nicht: Dem Reuigen behält die heilige Kirche seine Sünden nicht vor.«
Der Mönch ging. Venne war wieder allein in ihrer trostlosen Einsamkeit. Und dann sank der Abend herab, und die Nacht drohte, die grauenvolle Nacht ohne Schlaf. Venne sah es an dem Verblassen des Lichtstreifens, der in ihren Kerker fiel.
Verzweiflungsvoll irrte sie in dem engen Gefängnis hin und her. Sie wurde erneut ein Raub der widerstreitendsten Gefühle. Die Worte des Mönches hatten alles in ihr aufgewühlt, was sie zur Ruhe gekommen glaubte. Wie gierige Wölfe fielen die Gedanken sie an, ihre irdische Not, die Trennung von dem Geliebten, der ihr auf immer entrissen war, die ihr angetane Schmach; ihr ganzes verpfuschtes Dasein stieg vor ihr auf. Und dann die grausige Vorstellung, daß sie dem Henker verfallen sei. »Wehe, wehe, so jung und schon sterben müssen!« — Und mit dem Tode war es noch nicht zu Ende, selbst in das Jenseits hinein belastete sie noch die Erdenschwere: »Was harrt Deiner dort?«
In namenlosem Jammer rang sie die Hände. »Herr mein Gott, erleuchte mich! Vater, Mutter, gebt mir einen Wink, wo der rechte Weg ist!«
Keine Antwort in der erdrückenden Stille, schwarze Nacht ringsum! — Doch da schleicht sich ein Schimmer in ihr Gefängnis und trifft ihr ruhelos irrendes Auge. Ein Sternlein sendet sein bescheidenes Licht durch den Fensterschlitz. Aus erdenweiter Ferne gleitet sein milder Glanz herab in den Raum, wo irdische Unbill sie ummauert hält. Und ein zweites steht ihm getreulich zur Seite, und ein drittes. In sanfter Stetigkeit blicken die Augen des Himmels auf sie[S. 279] herab. Und Venne klimmt mit ihrem leidgeprüften Herzen zu den Seligen empor, die da oben in den himmlischen Sphären wandeln und leben. Vielleicht wohnt auf eben dem Sternlein das Mütterlein und der Vater, und sie sehen herab auf ihre Tochter, die in dieser furchtbaren Einsamkeit dem frühen, harten Tode entgegenlebt.
»Mutter, Mutter, erbarme Dich meiner. Gib mir ein Zeichen, daß Du mir nicht zürnst, daß ich nicht von Dir geschieden bleibe!« Und ihre Seele sucht in brünstigem Gebet die Ferne, Selige.
Da fließt es wie ein linder Trost ihr ins Herz. Das verklärte Antlitz der Mutter blickt auf sie hernieder, und sie spricht zu ihr: »Fürchte Dich nicht, meine Venne, ich bin bei Dir jetzt, und ich umschwebe Dich in Deiner letzten, großen Not. Du suchtest Gott, Du hast ihn gefunden; bleibe ihm treu, höre nicht auf Menschenwort. Und alles, was das Herz Dir bedrückt, das wirf auf ihn, den Eingeborenen, den er uns sandte, uns zu heilen und zu lösen. Jesus Christus, Dein Stab! An ihn halte Dich, mit ihm tritt die Wanderung an durch das dunkle Tal, das Dich zu mir, zu uns führt!«
»Jesus Christus, Dein Heil, Deine Zuversicht!« — wie milder, heilsamer Balsam legte es sich auf ihre zweifeldurchwühlte Brust. »Jesus Christus, Dein Stecken und Dein Stab!« — mit einem Seufzer unendlichen Glücksgefühls wandte sich ihr Blick von den schwindenden Sternen, die ihre Bahn durch die Ewigkeit fortsetzten.
»Jesus Christus!« — Der Name schwebte noch auf ihren Lippen, als die Augen sich schlossen zum Schlummer auf hartem Lager.
Am nächsten Tage schon kehrte der Franziskaner wieder.[S. 280] Er fand Venne in gelassener Ruhe. Der Friede in ihrer Stimme, der ihm bei seinem Gruß entgegenklang, erfüllte ihn mit Unruhe und Sorge.
»Hast Du Dich zurückgefunden, meine Tochter?« fragte er mit milder Stimme.
»Wie Ihr es versteht,« entgegnete Venne, »zurückgefunden oder zurechtgefunden zu meinem Gott und Erlöser; von ihm soll mich nichts mehr scheiden.«
»Wie soll ich das verstehen?« forschte er. »Dachtest Du auch an das, was ich Dir von den Eltern und dem Jenseits sagte?«
»Seid gewiß,« erwiderte sie zuversichtlich, »ich fand sie und hörte ihren Rat, der aber weist mich zu Jesum. Ihm will ich folgen und nur ihm.«
»Und die Kirche und die lieben Heiligen, baust Du nicht auf ihre gnadenbringende Fürsprache?«
»Ich habe meinen Heiland, habe Jesum Christum, was brauche ich sie!«
»So bist Du verloren für die Zeit und Ewigkeit!« Grollend erklangen seine Worte.
»Zürnet nicht, ehrwürdiger Vater«, bat Venne mit sanfter Stimme. »Es schmerzt mich, daß ich Euch kränken muß, der mir nur Gutes erwies. Aber Gottes Gebot geht vor Menschenwunsch. Und Gott befiehlt mir durch mein Mütterlein: ›Bleibe getreu und halte Dich an Jesum Christum!‹«
Da schied der Mönch zum andern Male von ihr, und er ging mit wehem Herzen, daß er die verirrte Seele nicht zurückgewinnen solle. Traurig war sein Blick, und Trauer durchzitterte seine Stimme, als er murmelte:
»So leb' denn wohl für diese Zeit und für die Ewigkeit!«
[S. 281]
Während in Goslar Venne Richerdes der Prozeß gemacht wurde, lag ihr Bewunderer und Helfer todwund in Rohde, wohin er gebracht war, sobald sein Zustand das zuließ. Lange hielt ihn das Fieber im Bann, und es schien, als ob der willensstarke Mann seinen Meister gefunden habe. Immer wieder gellte der Name »Venne« durch seine Fieberträume, und oft fuhr er auf mit dem Rufe: »Laßt mich zu ihr, ich habe ihr Hilfe versprochen, ich darf nicht wortbrüchig an ihr werden.« Aber dann sank er wimmernd zusammen.
Von den Vorgängen in Goslar wurde er dauernd unterrichtet durch seine Spione. Er hörte von dem Fortgang des Prozesses und erfuhr, daß Venne zum Tode verurteilt sei. Da gab es für ihn kein Besinnen mehr. Ein Befehl rief alle seine Männer zusammen. Es galt einen Überfall auf Goslar, der in allen Einzelheiten sorgsam durchdacht war. Während ein Teil einen Angriff von der Westseite her unternehmen sollte, der die Aufmerksamkeit der Goslarer fesselte, würden die anderen von Südosten her, von wo man am wenigsten Feindseligkeiten erwartete, in die Stadt einzudringen suchen. Hermann Raßler war noch immer nicht wiederhergestellt, aber es galt ihm als selbstverständlich, daß er bei diesem Zuge, der ihm die Erfüllung seines höchsten Sehnens bringen sollte, zugegen sein mußte.
Der Tag der Hinrichtung Vennes stand fest und damit auch die Stunde, die zur Befreiung zu führen bestimmt war.[S. 282] Am Abend vorher näherten sich die Mannen Raßlers der Stadt. Jedes Geräusch wurde vermieden, die Landwehr an Stellen überschritten, die abseits der Wege lagen. Mitgeführte Leitern wurden an die Mauer gelegt; die Ersten gelangten über sie hinweg und überwältigten die Wache im Torturm. Dann brach der Haufe in die Stadt ein.
Schon war durch den Lärm, der sich bei der Erzwingung des Eingangs nicht vermeiden ließ, dieser und jener Bürgersmann geweckt. Verschlafen rieb er sich die Augen, dann aber besann er sich auf seine Pflicht, die ihn zu jeder Stunde zum Schutze der Stadt aufrufen konnte. Inzwischen drang der Haufe der Bewaffneten bis zum Marktplatz vor, wo im Rathaus Venne befreit werden sollte. Die Türen wurden mit Gewalt erbrochen, mit fliegender Eile stürmte Raßler zu dem Verlies, in dem er die Geliebte wußte.
»Venne, die Befreiung ist nahe! Venne!« rief er noch einmal, — niemand antwortete. Eine Fackel tauchte auf, sie wurde dem Träger entrissen, und Raßler leuchtete in den Raum: leer! — — Er wußte nicht, daß man vor wenigen Stunden die Gefangene in die Stadtfronei gebracht hatte, um sie bei der Hinrichtung nicht weit führen zu müssen. »Vergebens, verloren!« stöhnte er. Tränen der Wut traten ihm ins Auge, und dann brüllte er auf wie ein Tier, dem man seine Beute entrissen hat.
»Venne, Venne!« schrie er einmal über das andere. Aber schon drängten die Genossen zum Rückzug. In der Stadt heulte die Sturmglocke, die Bürger sammelten sich in Haufen und drangen gegen das Rathaus vor. »Feind in der Stadt! Raßler ist da!« schrie und brüllte es durcheinander. Der Wilde stürzte sich auf sie: »Wo habt Ihr Venne Richerdes? Gebt sie heraus!« tobte er. Aber sie höhnten ihn in[S. 283] ihrer Übermacht. »Seht da, der Räuberhauptmann will sich sein Liebchen holen, um mit ihm auf dem Blocksberge Hochzeit zu halten. Auf ihn, der uns so sehr geschädigt hat, greift ihn, den Lump!«
»Auf sie!« brüllte auch Hermann Raßler mit blutunterlaufenen Augen. Wuchtig sausten seine Hiebe auf die Angreifer herab, und mehr als einer wälzte sich in seinem Blut. Aber immer größer wurde die Zahl der Verteidiger, und Schritt um Schritt wichen die Raßlerschen zurück. Dem Führer lag nichts an seinem Leben, immer und immer wieder stürmte er vor. Zuletzt rissen ihn die eigenen Leute zurück und führten den Widerstrebenden davon, während andere den Rückzug deckten. Das Schicksal Vennes war besiegelt.
Ein strahlend schöner Herbsttag brach nach der unheimlichen Nacht über die alte Reichsstadt herein. Leise, ganz leise kündigte sich das Sterben in der Natur an. Hier ein rotes Blättchen, das vom wilden Wein der Laube langsam zur Erde sich senkte, dort ein roter Schein über einen alten Ahorn oder eine Linde gehaucht, dazwischen dunkles Gold und lichtes Gelb, all die wunderbaren Farbentöne, mit denen der Meister der Schöpfung sein Werk noch einmal verklärt, ehe er ihm den Schmuck des Lenzes und Sommers nimmt und sie mit dem starren Gewande des Winters umkleidet. In den Büschen und Bäumen noch das lustige Gezwitscher der kleinen Sänger, die sich um das Morgen nicht kümmern, bis die Stimme in ihnen mahnt, daß es an der Zeit sei, sich zur Wanderung anzuschicken.
[S. 284]
Auf den Straßen jubelten die Kinder bei ihren Spielen, unbekümmert um das Unheimliche, das geschehen war, und das Gräßliche, das bevorstand. Sie hatten von den Erwachsenen einen Vers übernommen, den sie zu ihren Ringelreihen lustig zwitscherten:
»Venne Richerdes und Raßler der Böse,
Von beiden der Himmel uns balde erlöse!«
Vor der Pfalz, die von ihrer einsamen Höhe auf das Häusergewirr herabblickte, erhob sich das Schafott, auf dem Venne Richerdes büßen sollte. Eine ungeheure Volksmenge umlagerte den Platz. Selbst die Firste der näher liegenden Häuser waren mit Neugierigen bekränzt, die sich keine Einzelheit des schrecklichen Schauspiels entgehen lassen wollten.
Es ist der Ämter edelstes und opferwilligstes, das der Diener Gottes, dem Menschen in seiner letzten Not zur Seite zu stehen, wenn alle ihn verlassen müssen in seiner Qual. Bis dahin hielt ihn die Sorge um die Erhaltung des irdischen Lebens gefangen, jetzt lastet die furchtbare Seelennot auf ihm: Was wird aus mir im Jenseits?
Venne Richerdes stand außerhalb dieser Fürsorge, denn von der alten Gemeinschaft hatte sie sich losgesagt; die neue aber, die lutherische Familie, war, in Goslar zum wenigsten, noch ohne Heimat. Ihre Kinder und Jünger lebten der Obrigkeit zum Ärgernis und wurden von ihr nicht geduldet. So hätte sie allein den dunklen Weg gehen müssen. Aber der gute, alte Pater Franziskaner brachte es nicht über das Herz, sein Beichtkind ohne Tröstung den letzten Gang antreten zu lassen. Vor seinen Oberen beschönigte er sein Vorhaben mit dem Hinweise, daß Venne doch zuletzt noch widerrufen[S. 285] möchte, und auch im innersten Winkel seines Herzens lebte diese Hoffnung.
Als die Stunde gekommen war, trat er bei ihr ein.
»Ich bin gekommen, mit Dir zu beten«, sprach er mit ernster, milder Stimme. »Bist Du bußfertig, bereust Du Deine Sünden?«
»Ich bereue alles, was ich gesündigt, und bitte Gott, er wolle es mir nicht ansehen um Jesu Christi willen«, antwortete sie leise.
»Willst Du nicht zu uns zurückkehren?«
»Ich bitte Euch, ehrwürdiger Vater, laßt mich, wo ich bin. Ich habe den Grund gefunden, auf den ich baue, Jesum Christum. In ihm will ich sterben!«
»So möge Gott Dir gnaden!« murmelte der Mönch betrübt.
Das Armsünderglöcklein setzte ein mit seinem wimmernden Stimmchen. Aus der Fronei trat die todblasse Venne Richerdes, ihr zur Seite der Pater. Er murmelte die Sterbegebete; Vennes Lippen bewegten sich, ohne Worte formen zu können. Mit wankenden Schritten näherte sie sich der Richtstätte. Der Prokurator verlas das Urteil und brach den Stab über die Verurteilte, Venne Richerdes gehörte dem Henker.
Noch eine letzte, leise Bitte wagte der Mönch: »Widerrufe!«
Statt der Antwort nahm ihm Venne das Kruzifix aus der Hand. Ihr Auge suchte das Antlitz des Gekreuzigten. »Jesus Christus, mein Erlöser!« Ihre Lippen hauchten einen Kuß auf das Kreuz, dann ließ sie es in die Hände des Paters zurückgleiten.
Noch einmal umfaßte ihr Blick die Heimat mit den Türmen[S. 286] und Giebeln und den ragenden Bergen. Dann kniete sie nieder und empfing den tödlichen Streich.
Venne Richerdes hatte geendet, nicht erloschen war das Rachegefühl in der Brust Hermann Raßlers. Als die Nacht hereingebrochen, näherten sich wieder Gestalten der Stadt und gewannen heimlich Einlaß. Der Wächter rief die Mitternachtsstunde, da flammte es an allen Enden Goslars zugleich blutigrot auf. Der rote Hahn spreizte seine feurigen Flügel. Die Bürger schreckten aus dem Schlafe auf durch das gefürchtete »Feuerjo! Feuerjo!« Prasselnd stiegen die Flammen in den dunklen Himmel, die Nachbarschaft weithin mit grellem Schein übergießend; dahinter gähnte die Nacht nur um so schwärzer und unheimlicher. Hermann Raßler brachte Venne Richerdes sein Totenopfer!
Er selbst, der Wilde, Rachedürstende, war daran nicht beteiligt, er hatte ein anderes, letztes Werk in Goslar zu vollbringen: noch lebte der, von dem all das Unheil ausging, das über die unglückliche Venne hereingebrochen war, der Ratsherr Heinrich Achtermann.
Der Rächer nahm niemand mit auf seinem Wege. Was er vorhatte, war sein eigenstes Werk, kein Unberufener sollte ihn dabei stören, was er mit seinem Todfeinde zu erledigen hatte.
Das Haustor war bald geöffnet, er drang zu dem Zimmer vor, in dem der Gehaßte weilte. Eine Magd, die ihm mit einer Kerze entgegentrat, verscheuchte er mit barschem Befehl. Da trat ihm der Gesuchte entgegen, notdürftig gekleidet.[S. 287] Entsetzen ergriff ihn, als er den Gefürchteten vor sich auftauchen sah. Das Licht zitterte in seiner Hand.
»Zurück in Euer Zimmer!« herrschte Raßler. Mechanisch wich Achtermann zurück. Jener folgte ihm auf dem Fuße.
Achtermann wußte, daß sein letztes Stündlein geschlagen habe. Hilfesuchend glitt sein Blick zum Fenster. Raßler sprach düster: »Gebt Euch keiner Hoffnung hin, für Euch gibt es keine Rettung! Bereitet Euch zum Sterben vor. Aber zuvor noch eine Frage: Was tat Euch Venne Richerdes, diese Edle, Reine? Habt Ihr auch nur einen einzigen triftigen Grund, so mögt Ihr Euer elendes Leben weiterschleppen. Euch bleiben noch genug der Gewissensbisse, daß Ihr darunter zusammenbrechen müßt.«
Der Ratsherr brachte nur lallende Laute hervor. »Sprecht!« heischte der Unerbittliche, aber kein Wort entrang sich den blassen Lippen. Stieren Auges blickte er auf den Peiniger.
»Willst Du nicht, so fahre ohne Bekenntnis zur Hölle!« schrie er. »Doch daß ich es an christlicher Gesinnung selbst Dir gegenüber nicht fehlen lasse, so sei Dir noch ein letztes Gebet gegönnt. Nieder auf die Erde!« brüllte er, als Achtermann noch immer schwieg, und damit riß er ihn auf den Boden. Da entrang sich den Lippen seines Opfers ein furchtbarer, wilder Schrei. Mit eiserner Faust hielt Raßler ihn nieder, während die Rechte den Dolch zum Stoß bereithielt. Wimmernd, mit verglasten Augen lallte der Alte einige Worte. Es wurde laut im Hause. Durch das Geschrei der Magd und den Angstruf des Ratsherrn waren Nachbarn aufmerksam gemacht worden und drangen ins Haus.
»Stirb, Du Hund«, zischte Raßler und hob die Rechte zum Stoß. Da flog die Tür auf, und die Helfer drangen ein.[S. 288] Ehe noch der Dolch sein Ziel erreicht hatte, sank Hermann Raßler unter dem Streiche eines Bürgers. Seinem Leben ward ein Ende gesetzt an dem Tage, da Venne, die er zu gewinnen hoffte, unter des Henkers Schwert starb.
Heinrich Achtermann hatte das Bewußtsein verloren; als er wieder zur Besinnung gebracht war, schlug ein blöder Greis die Augen auf. Die schreckliche Stunde hatte ihm die Sinne verwirrt.
[S. 289]
Durch die hochgehenden Wogen der Nordsee pflügte sich eine hansische Kogge mühsam ihren Weg. Oft war sie verschwunden zwischen den grünen Wellenbergen, dann schwebte sie auf der Höhe des nächsten Wasserschwalles. Der weiße Gischt flutete über das niedrige Verdeck, alles mit seiner salzigen Flut übergießend. Aufmerksam standen Kapitän und Steuermann auf ihrem Posten; keinen Blick verloren sie von dem Wege, den der Kompaß vorschrieb.
Das Schiff hatte eine schwere Fahrt hinter sich, seitdem es von der Mole in London losmachte. Wild jagte der Novembersturm hinter ihm drein und heulte brüllend durch die gerefften Segel und Stengen. Aber wacker stampfte es dahin, unentwegt dem fernen Ziele zu. Die Kogge war in Hamburg beheimatet, und dorthin ging ihre Reise.
Ungeduldig blickte einer der Schiffsgäste auf Schiff und See, deren Wogen, wie es schien, unter dem Fahrzeug eilig davonglitten dem Ziel zu, das sie selbst erstrebten. Ja, er war voller Ungeduld, Heinrich Achtermann, der mit der guten hansischen Kogge die Heimfahrt von London antrat, nachdem dort die geschäftlichen Angelegenheiten zu seiner und, wie er hoffen durfte, auch zu seines Vaters Zufriedenheit geregelt waren. Aus der Heimat hatte ihn in dem knappen Jahre, das er von Goslar fern weilte, Nachricht nicht erreicht außer einem Schreiben des Vaters, das geschäftlichen Inhaltes war und die Dinge, die ihn interessierten, nicht berührte. Venne selbst wußte er in Worms;[S. 290] wie lange ihr Aufenthalt dort dauern würde, war ihm unbekannt. Zwischen ihm und ihr war also in dieser Zeit der Faden gänzlich abgerissen.
Er freute sich von Herzen auf das Wiedersehen, denn die Aufregung der letzten Tage in Goslar mit dem unleidlichen Zwischenfall hatte sich gewiß gelegt, und er durfte hoffen, daß auch bei dem Vater eine mildere Stimmung eingezogen sei. Seine Gefühle für die Geliebte waren durch die lange Trennung geklärt, sie hatten an Innigkeit nicht verloren, sondern waren gefestigt worden durch die Vergleiche, die er zwischen fremden Frauen und der keuschen, züchtigen Geliebten ziehen konnte. Er war entschlossen, sein Glück festzuhalten und sich durch nichts darum betrügen zu lassen.
Viel zu langsam für seine Ungeduld setzte das Schiff seine Fahrt durch die schwere See fort. Heinrichs Gedanken eilten ihm voraus und übersprangen den Weg von Hamburg nach Goslar. Er sah sich zur Bergstraße eilen und die Geliebte an sein Herz sinken. Das Gefühl des großen Glückes, das seiner wartete, drohte ihm die Brust zu zersprengen. Endlich lief die Kogge in die Elbe ein und legte im Hafen von Hamburg an. Es hielt ihn dort keinen Tag länger, unverweilt brach er nach Goslar auf. Noch hieß es sich Tage gedulden, aber süßer Lohn winkte ihm daheim und brachte ihm Entschädigung für die lange Zeit der Sehnsucht!
Armer Heinrich, Du ahnst das Schreckliche nicht, das Deiner wartet!
Von Braunschweig ab fand er Gesellschaft in einem Reisegenossen, einem Kaufmann, der in Goslar Station machen und dann weiter nach Halberstadt wollte. Von dem Gespräch über die Zeitläufte kam man auch auf die Geschehnisse in der Heimat. Da der Reisende hörte, daß Heinrich[S. 291] lange abwesend gewesen sei, berichtete er über vieles, das ihm in den Sinn kam.
»Dann wißt Ihr wohl auch nichts von dem großen Hexenprozeß, der vor wenigen Monden alle Gemüter in Eurer Heimat in Spannung hielt?« Heinrich verneinte.
»Nun, da werdet Ihr staunen. Es war nämlich keine gewöhnliche Hexe, sondern ein vornehmes Fräulein.«
Heinrich schnürte ein unerklärliches Angstgefühl die Kehle zu. »Wie hieß die Frau?« fragte er mit halberstickter Stimme.
»Ja, wie war doch der Name? Laßt sehen. Venne, Venne Richard oder so ähnlich.«
»Venne, Venne? Doch nicht Richerdes?« fragte er heiser. »Doch, das ist der Name.« »Ihr lügt«, schrie der Gepeinigte, daß der Fremde erschrocken zusammenfuhr. »Ihr lügt«, wiederholte er noch einmal.
»Nun, ich kann mich ja irren, aber ich meine, so hätte der Name geklungen; doch nichts für ungut. Was erregt Euch denn so bei dem Namen?«
Was ihn erregte! Er hätte dem Mann ins Gesicht schreien können: »Meine Braut ist es!« aber er schwieg mit zusammengebissenen Zähnen. Nur kurze Zeit ritt er noch mit dem Weggenossen, dann entschuldigte er sich: »Nehmt es nicht übel, aber mich zwingt die Unruhe vorwärts.« Damit gab er seinem Pferde die Sporen.
In Goslar ritt er durch das Breite Tor ein. Qualvolle Ungewißheit erfüllte sein Herz. Es schien ihm, als blickten ihn alle Leute mit neugierigen, mitleidigen Augen an. Bekannte begegneten ihm nicht. Ehe er noch das väterliche Haus aufsuchte, ging er zur Bergstraße, um von der schrecklichen Pein erlöst zu werden. Das Haus der Richerdes war[S. 292] verschlossen, niemand rührte sich drinnen. Es öffnete sich ein Nachbarfenster: »Aber was wollt Ihr denn da? Wißt Ihr nicht, daß die Hexe ...?« Da jagte er davon wie von Furien gehetzt.
Im Vaterhause alles still. Die Magd blickte ihn an, als ob sie ein Gespenst sehe. »Herr Heinrich«, schrie sie dann laut auf. Auf den Ruf trat die Mutter aus dem Zimmer. Aber ... war denn das seine Mutter? Eine rüstige, stattliche Frau, so hatte sie ihm den Abschiedskuß auf die Stirn gedrückt, und jetzt eine gebeugte, zitternde Greisin?
»Mutter,« schrie er, »Mutter, ist es wahr, was man mir erzählt? Venne ...?«
Sie lehnte sich gegen den Türpfosten, als drohten ihr die Kräfte zu versagen. »Ja, mein Sohn, mein armer Junge, es ist wahr.«
Da schrie er auf wie ein zu Tode getroffenes Wild. »Venne!« und noch einmal »Venne!«
»Und wer hat sie mir geraubt« rief er heiser vor Wut. »Hat etwa der Vater daran Anteil?«
Die Mutter schwieg. Das Schweigen war ihm Antwort genug.
»So hat der Unhold in seiner Rachsucht alles zerstört, was mir teuer war. Alles, alles«, fuhr er mit versagender Stimme fort. »Aber wo ist er?« schrie er erneut auf. »Wo ist er, daß ich ihn zur Rechenschaft ziehe?«
Die Mutter schluchzte still vor sich hin. »Wo ist er?« fragte der Sohn wiederum drohend.
»Du wirst ihn nicht zur Rechenschaft ziehen, weil Du es nicht kannst, armer Junge«, sagte sie leise.
»Weshalb nicht? Ist er tot? Ist alles tot und verhext hier bei Euch?«
[S. 293]
»Er ist nicht tot,« antwortete sie mit bitteren Tränen, »er ist schlimmer als tot, er ist wahnsinnig.«
»Ha, ha, ha«, lachte Heinrich in grellem Hohn. »So ist's recht, die Braut getötet, der Täter ein Narr!«
»Du sprichst vom Vater!« mahnte die Mutter verzweifelt.
»Ich fluche ihm,« schrie der Sohn, »ich fluche allen, die an der grausigen Tat mitschuldig. Ich erwürge sie alle«, schäumte er.
»Fasse Dich, mein Sohn,« mahnte sie, »lästere nicht wider Gottes Gebot, das Dich heißt, den Eltern Ehrfurcht zollen.«
Wieder lachte er schrill auf. »Ehrfurcht zollen diesem blöden Mordbuben! Nein, nein, ich ziehe ihn dennoch zur Rechenschaft; er soll mir büßen.« Er trat einen Schritt auf das Zimmer zu, in dem er den Vater mutmaßte. Da stellte sich ihm die schwergeprüfte Mutter entgegen. »Willst Du nicht Gottes Gebot achten gegen Deinen Vater, so achte mich oder schreite über mich weg, wenn Du es vermagst.«
Da brach der Zorn des Sohnes zusammen. Er sank auf einen Sitz und schluchzte in haltloser, wilder Verzweiflung. Leise legte sich die Hand der Mutter auf seinen Scheitel: »Gott hat Dir und mir die Prüfung geschickt, laß sie uns gemeinsam tragen, daß nicht der einzelne ihr erliegt.«
So nahm Heinrich Achtermann sein Joch auf sich. Oft meinte er, darunter zusammenzubrechen. Wenn er den Vater sah, quoll die wilde Verzweiflung aufs neue in ihm empor. Er ballte die Fäuste in der Tasche, um sich nicht an dem wehrlosen Narren zu vergreifen.
[S. 294]
Der stolze Ratsherr Achtermann war zum Kinde geworden, zum blöden Kinde, das vor sich hinlallte und greinte und lachte, wie die Eindrücke von außen, der Hunger, die Kälte, Tag und Nacht ihn trafen. Geduldig pflegte die Mutter das große Kind. Mit einem Gefühl der Bewunderung blickte der Sohn auf diese Frau, die in stiller, selbstloser Liebe dem Gatten die Treue hielt, auch jetzt, wo er für die Welt zum gemiedenen, verachteten Geschöpf geworden war: Das war die Liebe, die echte, große Liebe, die, von Gott in der Menschen Herz gesenkt, nicht erlosch und sich am Erbarmen mit dem Geschlagenen stärkte und immer reiner und verklärter ihre Äußerung fand.
Mählich, ganz mählich zog auch Mitleid in sein Herz. Der Vater selbst hatte alles vergessen, was zwischen einst und dem schrecklichen Tage lag, da durch seine Schuld die edle Venne dahinsank.
In ihm lebte sie, so oft seine Gedanken sich zu ihr zurückfanden, als die schöne, liebliche und geliebte Schwieger. Er fragte nach ihr, er greinte, daß sie nicht komme, und dann führte ihn sein schwacher Geist wieder in das Kinderland zurück, das dem Greise noch einmal sich aufgetan hatte.
Heinrich gewann es allmählich über sich, den Mann zu ertragen, der ihm so Schweres zugefügt hatte; nur wenn der Schwachsinnige in seiner kindischen Sehnsucht ihren Namen nannte, wenn er sie als Tochter grüßte und rief, brannte das Weh in alter Schärfe.
Noch einmal wurde der Ratsherr Achtermann Herr seines Verstandes. Das war in der Stunde, da der Tod schon zu seinen Häupten stand. Da büßte er alles, was er gesündigt hatte. »Vergib mir, mein Sohn, was ich Dir tat. Vergib mir, Venne, geliebte Tochter, in Deiner lichten Höhe. Ich[S. 295] komme und will den Saum Deines Gewandes küssen. Herr, Herr, behalte mir die Sünde nicht vor.«
Erschüttert stand der Sohn daneben. Sein Groll schmolz dahin. Er legte die Hände des Sterbenden zusammen und betete mit ihm: »Herr, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern.«
Es starb der Vater, es starb ihm die Mutter. Nun lebte er ganz allein. Es war ein stiller, einsamer Mann, der zu der Stelle an der Kirchhofsmauer wallfahrtete, wo sie Venne Richerdes gebettet hatten. Lieblicher als Menschenhand schmückte Mutter Natur die Ruhestätte, die von den Menschen gemieden wurde.
Man lockte ihn mit hübschen, schönen Jungfrauen, die bereit waren, an der Seite des Einsamen durch das Leben zu pilgern; er achtete ihrer nicht. Früh bleichte sein Haar. Man schalt ihn einen Menschenfeind und Sonderling; er hörte es nicht. Nur dem kleinen Kreise derer, die Venne Richerdes bis zum Tode die Treue gewahrt hatten, blieb er ein Freund. Im Hause der Hardts fand auch sein Mund wieder Worte. Man gedachte der ihm Entrissenen.
Mit wehmütiger Freude traf der Blick Heinrichs das junge, blühende Geschlecht, das dort in der Unschuld seiner Kindheit heranreifte. Seine Hand glitt wie segnend über den Scheitel des Töchterchens, das sich vertrauensvoll an ihn schmiegte. Seine Gedanken suchten das Dunkel zu durchdringen, das ihre Zukunft verhüllte: Was wird ihrer harren hier auf Erden?
Und er fand die Antwort, wie sie lauten mußte: Liebe und Kampf und Kampf und Liebe in der ewigen Wiederholung des Menschenschicksals!
Anmerkungen zur Transkription:
Die erste Zeile entspricht dem Original, die zweite Zeile enthält die Korrektur.
S. 132
Sie alle feierten
Sie alle froren